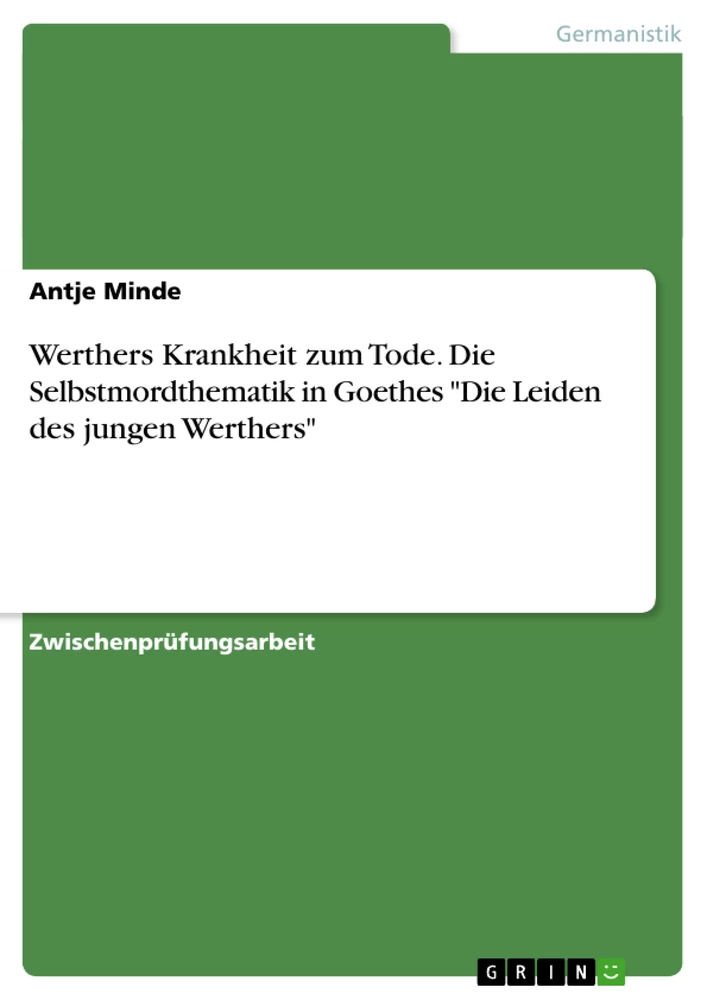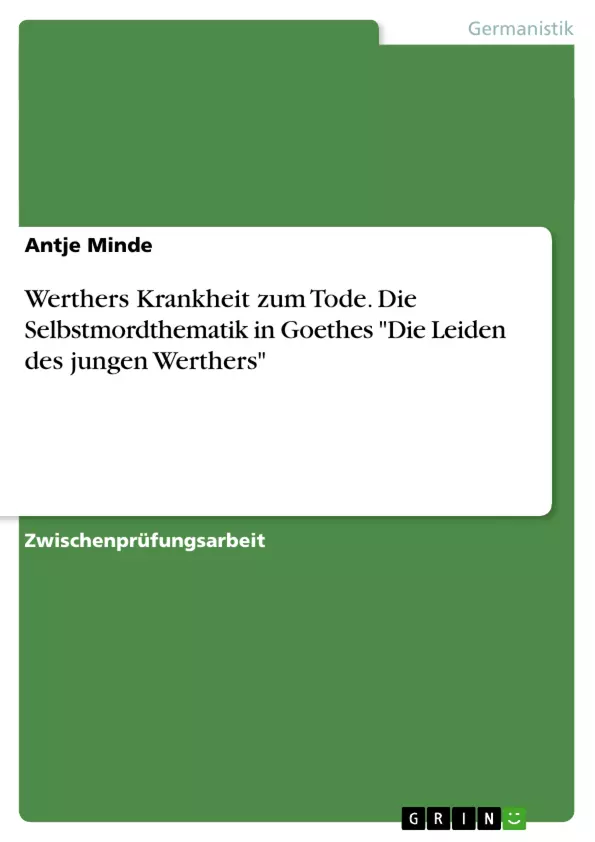Die Selbstmordproblematik in Goethes "Die Leiden des jungen Werther" gehört mit zu den interessantesten Themenbereichen in dem Briefroman. Sie lässt sich nicht nur textimmanent erschlüsseln, sondern auch die Kontroverse, die Goethe mit dem dramatischen Ende seines Protagonisten hervorrief, verdient einer Betrachtung. Um den Aufruhr, den Goethe verursachte, zu verstehen, bedarf es eines kleinen Überblicks über die Auffassung der damaligen Gesellschaft in Bezug auf den Freitod. Die Bürger des ausgehenden 17. Jahrhunderts durchliefen einen Wandel in ihrem moralischen Denken und der Suizid entwickelte sich von einem Werk des Teufels zu einer schweren psychischen Krankheit.
Der Titel der Abhandlung "Krankheit zum Tode" deutet bereits auf die langwierige persönliche Entwicklung Werthers hin, die von einer anfänglichen Depression über eine schwermütige Melancholie hin bis zum Wahnsinn und Todeswunsch verläuft. Besonderer Beachtung bedürfen dabei die Vorausdeutungen in Hinblick auf Werthers Selbstmord, die zeigen, dass seine Entscheidung sich das Leben zu nehmen von langer Hand geplant und kein spontaner Akt war.
Zur Vervollständigung der Suizidthematik dient die Ausarbeitung über die Rezeptionsgeschichte des Werkes, das als Meilenstein des Sturm und Drang angesehen werden kann und als solcher die Meinung der Gesellschaft auf das Extremste teilte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Selbstmord im Wandel der Zeit
- Die Philosophie und der Selbstmord in der Epoche der Aufklärung
- Werthers Krankheit zum Tode
- Die Rezeptionsgeschichte des Werthers
- Die Leiden des Werthers im Visier der Obrigkeit
- Der Wertherkult
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Selbstmordthematik in Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ im Kontext des gesellschaftlichen Wandels der Auffassung von Selbstmord vom 17. bis zum späten 18. Jahrhundert. Sie analysiert die Vorzeichen des Suizids in Werthers Verhalten und beleuchtet die Rezeptionsgeschichte des Werks.
- Der Wandel der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Selbstmord
- Die philosophischen Debatten um Selbstmord in der Aufklärung
- Die Darstellung der psychischen Erkrankung Werthers
- Die gesellschaftliche Reaktion auf Goethes Werk
- Die Vorboten von Werthers Selbstmord im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Untersuchung der Selbstmordthematik in Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ und den gesellschaftlichen Kontext dieser Thematik. Es wird deutlich, dass der Fokus auf dem Wandel der gesellschaftlichen Auffassung von Selbstmord liegt und wie dieser Wandel die Interpretation des Romans beeinflusst.
Der Selbstmord im Wandel der Zeit: Dieses Kapitel verfolgt die historische Entwicklung der Wahrnehmung von Selbstmord. Von der frühchristlichen Verurteilung als Teufelswerk bis hin zur aufklärerischen Betrachtung als mögliche Folge psychischer Erkrankung wird die Veränderung der gesellschaftlichen und rechtlichen Reaktionen auf Suizid nachgezeichnet. Beispiele für die historische Bestrafung von Suizidenten und die schrittweise Änderung der Bestattungspraktiken veranschaulichen den Wandel. Die Bedeutung von Werken wie Blackstones „Commentaries on the Laws of England“ und Burtons „The Anatomy of Melancholy“ wird im Kontext der sich ändernden Sichtweisen auf Selbstmord herausgestellt.
2.1 Die Philosophie und der Selbstmord in der Epoche der Aufklärung: Dieses Kapitel vergleicht die unterschiedlichen philosophischen Positionen zur Frage des Selbstmords während der Aufklärung. Es werden die kontrastierenden Ansichten von David Hume, der das Recht auf Selbstbestimmung über das eigene Leben postuliert, und Immanuel Kant, der den Selbstmord als moralisch verwerflich ansieht, gegenübergestellt. Die gemäßigtere Entwicklung der deutschen Position im Vergleich zu England und Frankreich wird ebenfalls diskutiert, wobei der Einfluss von Philosophen wie Christian Wolff hervorgehoben wird.
Werthers Krankheit zum Tode: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Analyse der im Roman selbst enthaltenen Hinweise auf Werthers bevorstehenden Selbstmord. Anstatt die Ursachen für Werthers Unglück zu ergründen, verfolgt der Text chronologisch die im Roman dargestellten Entwicklungen von Werthers psychischer Verfassung, vom Frühling bis zum Winter, welche letztendlich in seinem Selbstmord gipfeln. Das Vorwort des Romans und die frühen Briefe Werthers werden als Indikatoren für seinen melancholischen Zustand und seine anwachsende Verzweiflung interpretiert.
Die Rezeptionsgeschichte des Werthers: Dieses Kapitel widmet sich der Reaktion der Gesellschaft auf Goethes Werk. Es werden sowohl die Reaktionen der Obrigkeit als auch der Entstehung eines „Wertherkults“ untersucht, um die weitreichende Wirkung des Romans und dessen Einfluss auf die öffentliche Meinung zu beleuchten. Die Aufteilung in die Reaktionen der Obrigkeit und den Wertherkult ermöglicht eine differenzierte Betrachtung der Rezeption des Werkes.
Schlüsselwörter
Selbstmord, Aufklärung, Goethe, Die Leiden des jungen Werthers, Melancholie, Suizidprävention, gesellschaftliche Moral, Rezeptionsgeschichte, psychische Erkrankung, philosophische Ethik.
Goethes "Die Leiden des jungen Werthers": Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Thematik des Selbstmords in Goethes "Die Leiden des jungen Werthers" vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels der Auffassung von Selbstmord vom 17. bis zum späten 18. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf der Analyse der Vorzeichen des Suizids in Werthers Verhalten und der Untersuchung der Rezeptionsgeschichte des Werkes.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Selbstmord, die philosophischen Debatten um Selbstmord in der Aufklärung, die Darstellung von Werthers psychischer Erkrankung, die gesellschaftliche Reaktion auf Goethes Werk und die Vorboten von Werthers Selbstmord im Roman.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel "Einleitung", "Der Selbstmord im Wandel der Zeit" (inkl. Unterkapitel "Die Philosophie und der Selbstmord in der Epoche der Aufklärung"), "Werthers Krankheit zum Tode", "Die Rezeptionsgeschichte des Werthers" (inkl. Unterkapitel "Die Leiden des Werthers im Visier der Obrigkeit" und "Der Wertherkult") und "Fazit". Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung. Das Kapitel "Der Selbstmord im Wandel der Zeit" verfolgt die historische Entwicklung der Wahrnehmung von Selbstmord. Das Kapitel "Werthers Krankheit zum Tode" analysiert die im Roman enthaltenen Hinweise auf Werthers Selbstmord. Das Kapitel "Die Rezeptionsgeschichte des Werthers" untersucht die gesellschaftliche Reaktion auf Goethes Werk.
Welche philosophischen Positionen zum Selbstmord werden diskutiert?
Die Arbeit vergleicht die kontrastierenden Ansichten von David Hume (Recht auf Selbstbestimmung) und Immanuel Kant (Selbstmord als moralisch verwerflich) zum Selbstmord während der Aufklärung. Die gemäßigtere Entwicklung der deutschen Position im Vergleich zu England und Frankreich wird ebenfalls diskutiert.
Wie wird Werthers psychische Verfassung im Roman dargestellt?
Die Arbeit verfolgt chronologisch die Entwicklung von Werthers psychischer Verfassung vom Frühling bis zum Winter, basierend auf den im Roman dargestellten Entwicklungen, um die Vorboten seines Selbstmords aufzuzeigen. Das Vorwort und die frühen Briefe werden als Indikatoren für seinen melancholischen Zustand interpretiert.
Wie wird die Rezeptionsgeschichte des Werthers beschrieben?
Die Rezeptionsgeschichte wird in zwei Aspekte unterteilt: die Reaktionen der Obrigkeit und die Entstehung eines "Wertherkults". Dies erlaubt eine differenzierte Betrachtung der weitreichenden Wirkung des Romans und seines Einflusses auf die öffentliche Meinung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Selbstmord, Aufklärung, Goethe, Die Leiden des jungen Werthers, Melancholie, Suizidprävention, gesellschaftliche Moral, Rezeptionsgeschichte, psychische Erkrankung, philosophische Ethik.
- Quote paper
- Antje Minde (Author), 2004, Werthers Krankheit zum Tode. Die Selbstmordthematik in Goethes "Die Leiden des jungen Werthers", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37707