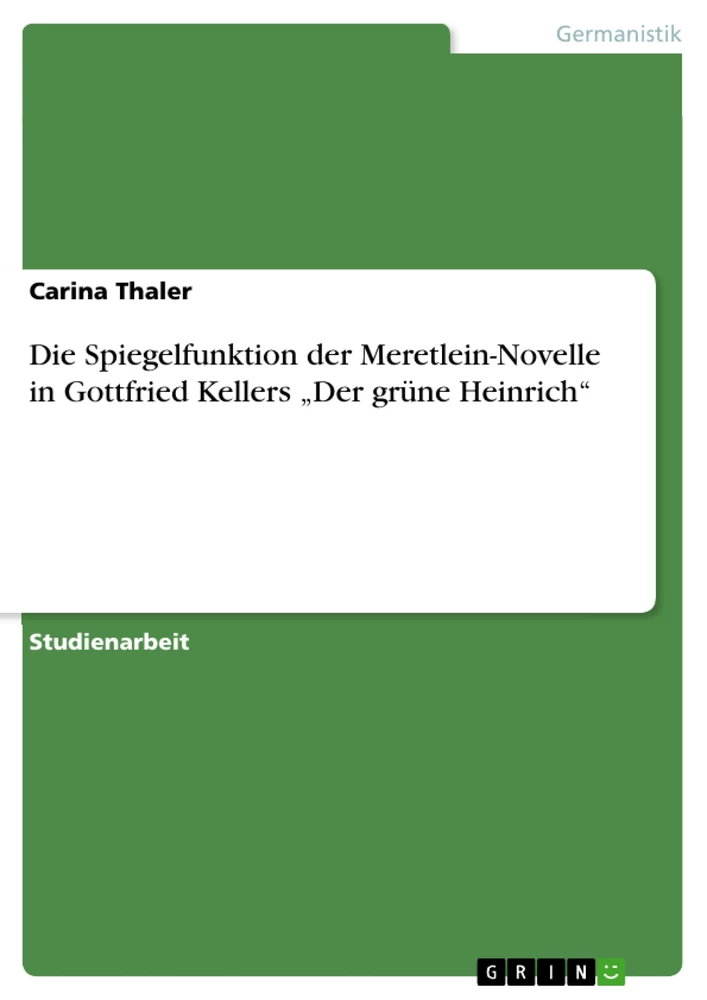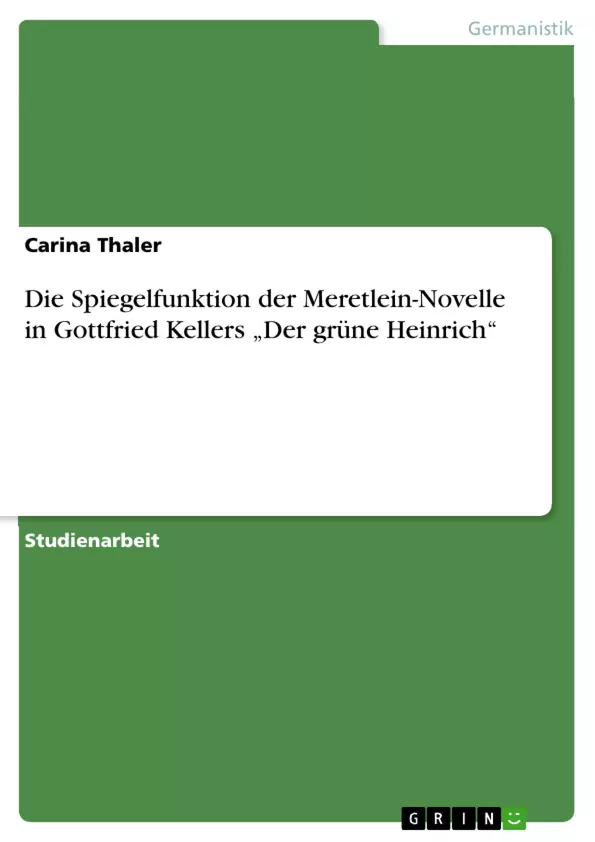Die weitgehend autobiographische Erzählung "Der grüne Heinrich" des Schweizer Autors Gottfried Keller zählt zu den bedeutendsten Romanen des 19. Jahrhunderts und gilt als Kellers Hauptwerk.
Einem besonders sozial- und religionskritischen Abschnitt des grünen Heinrich widmet sich die vorliegende Arbeit. Sie befasst sich mit der Sage des „Hexenkindes“ Meret, die von einem Pfarrer von ihrer „Gottlosigkeit“ und „Hexerei“ geheilt werden sollte, jedoch unter der „Correction“ des „wegen seiner Frömmigkeit und Strenggläubigkeit berühmten Pfarrherrn“ verstarb.
Als vergleichsweise sehr kurze Binnenerzählung innerhalb der wiedergegebenen Jugendgeschichte Heinrichs stellt sie dennoch einen faszinierenden und gleichzeitig befremdenden Mittelpunkt des Romans dar, dessen besondere Funktion und Wirkung die folgende Untersuchung analysiert.
Dabei wird der Text zuerst erzähltheoretisch untersucht, um seine außerordentliche Darstellung und Einbettung im grünen Heinrich darzulegen. Das Hauptaugenmerk der Arbeit liegt auf dem verweisenden und vernetzenden Charakter der Meret-Episode und ihrer romaninternen Spiegelfunktion, die anhand einiger Beispiele veranschaulicht wird. Ziel dieser Arbeit soll es somit einerseits sein, die exzeptionelle Stellung der Novelle im Roman aufzuzeigen und andererseits die Bedeutung der Erzählung als Knotenpunkt für den grünen Heinrich darzustellen. Darüber hinaus wird die Episode auch inhaltlich in Bezug auf ihre scharfe Gesellschafts- und Religionskritik analysiert, die sich zwar im gesamten Werk Kellers zeigt, in der Meretlein-Novelle jedoch durch die große zeitliche Abhebung distanziert dargestellt und hervorgehoben wird und somit eine besondere Aufmerksamkeit erweckt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der grüne Heinrich (1854/55)
- Die Meretlein-Novelle
- Inhalt der Erzählung
- Erzähltheoretische Analyse
- Einbettung der Erzählung im Roman
- Die Spiegelfunktion der Meretlein-Novelle
- Anna, Judith und Dortchen
- Frau Lee
- Gesellschafts- und religionskritische Aspekte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Meretlein-Novelle innerhalb Gottfried Kellers Romans „Der grüne Heinrich“ (1854/55) und analysiert ihre besondere Funktion und Wirkung im Kontext der gesamten Erzählung. Die Arbeit befasst sich mit der erzähltheoretischen Analyse der Novelle, ihrer Einbettung im Roman und ihrer Spiegelfunktion, die durch Verweise und Vernetzungen auf andere Figuren und Aspekte des Romans deutlich wird. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit die gesellschaftliche und religionskritische Dimension der Meretlein-Novelle und zeigt ihre besondere Bedeutung im Gesamtkontext des Romans.
- Erzähltheoretische Analyse der Meretlein-Novelle
- Spiegelfunktion der Novelle im Roman
- Einbettung der Meretlein-Novelle im Gesamtkontext des Romans
- Gesellschafts- und religionskritische Aspekte der Novelle
- Bedeutung der Meretlein-Novelle als Knotenpunkt im „Grünen Heinrich“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt den Kontext der Meretlein-Novelle im „Grünen Heinrich“ dar. Sie beleuchtet die Bedeutung des Romans für die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts und fokussiert auf die Lebensgeschichte des titelgebenden Heinrich Lee sowie die zentrale Rolle der Meretlein-Novelle im Werk.
Kapitel 2 bietet eine Zusammenfassung der ersten Fassung von „Der grüne Heinrich“ (1854/55), einschließlich des Vorwortes und der vier Bände. Es werden die wichtigsten Themen und Figuren des Romans vorgestellt, wie zum Beispiel Heinrichs Jugendgeschichte und seine Auseinandersetzung mit Religion und Phantasie.
Kapitel 3 analysiert die Meretlein-Novelle im Detail. Es werden der Inhalt der Erzählung, ihre erzähltheoretische Struktur und ihre Einbettung in den Gesamtkontext des Romans betrachtet.
Kapitel 4 beleuchtet die Spiegelfunktion der Meretlein-Novelle im „Grünen Heinrich“. Es werden Beispiele dafür gegeben, wie die Novelle auf andere Figuren und Ereignisse des Romans verweist und wie sie in einem komplexen Netzwerk von Beziehungen steht.
Schlüsselwörter
Gottfried Keller, Der grüne Heinrich, Meretlein-Novelle, Spiegelfunktion, Erzähltheorie, Gesellschaftskritik, Religionskritik, Jugendgeschichte, Bildung, Phantasie, Realität, Religion, Glaube, Gesellschaft, Moderne, Kunst, Literatur, 19. Jahrhundert, Deutschland, Schweiz.
- Quote paper
- Carina Thaler (Author), 2017, Die Spiegelfunktion der Meretlein-Novelle in Gottfried Kellers „Der grüne Heinrich“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377208