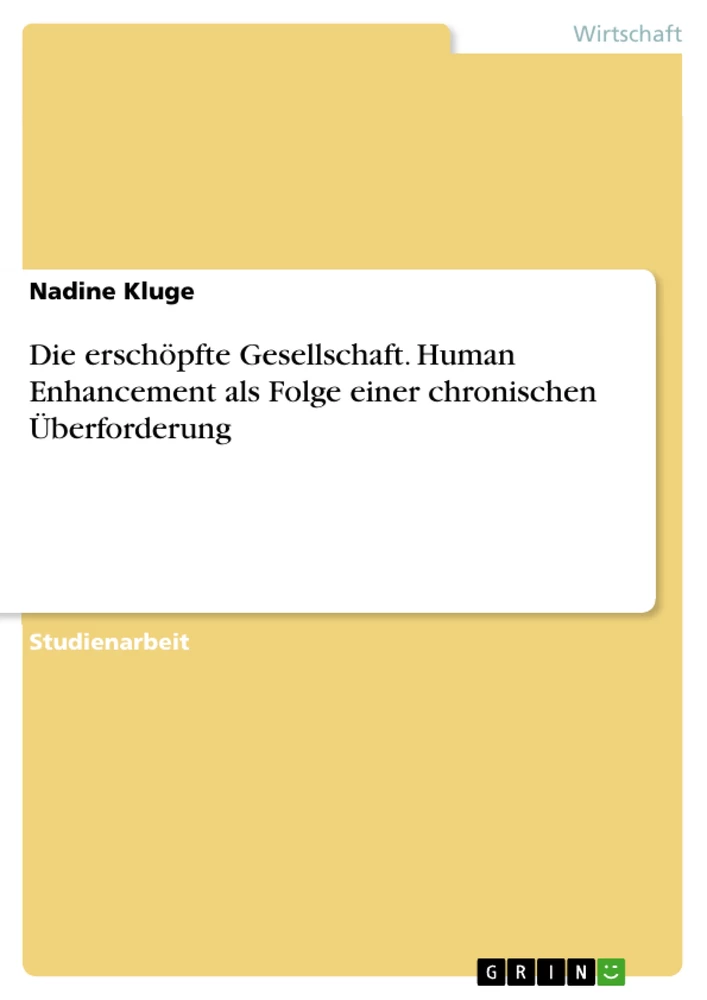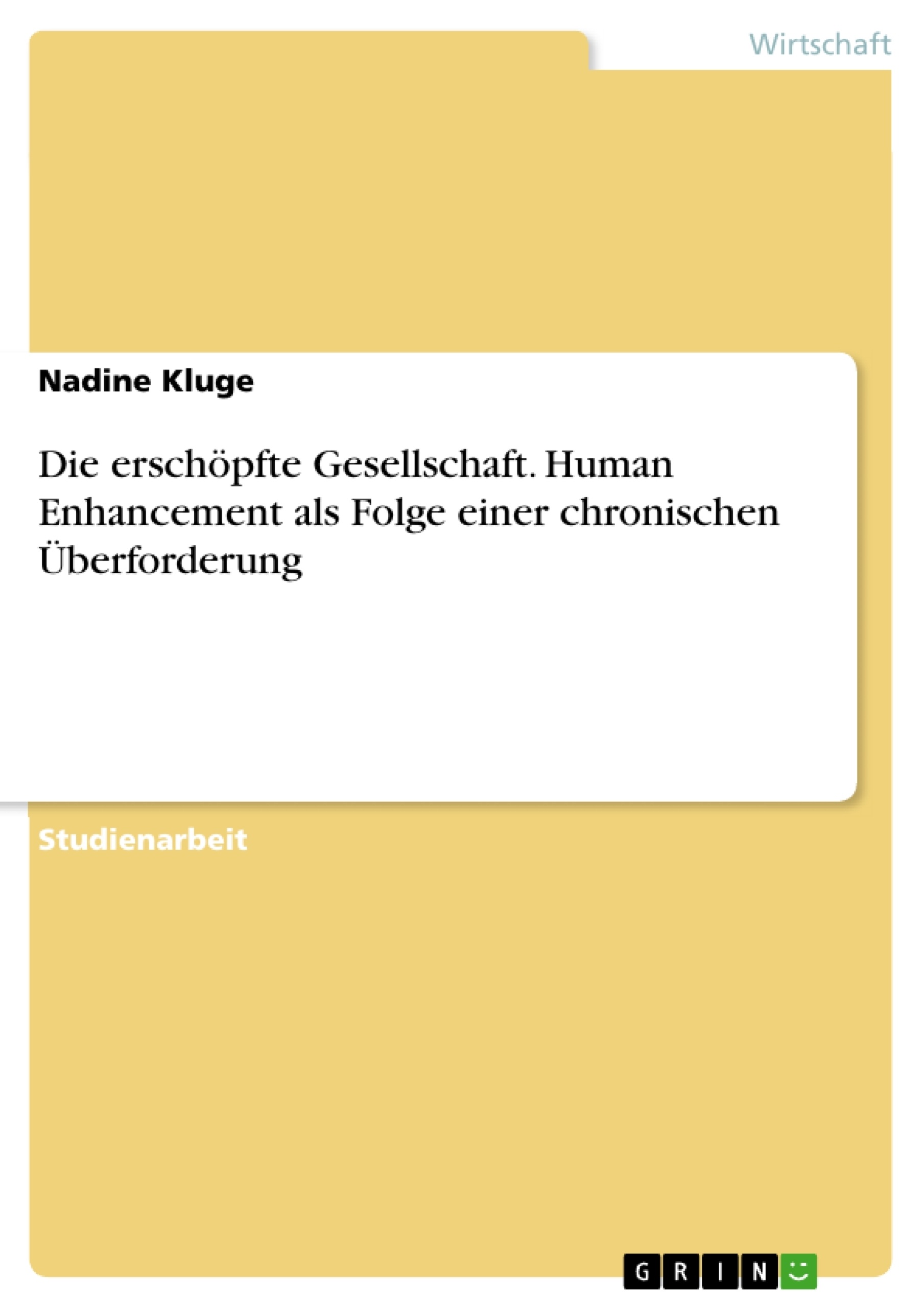In gegenwärtigen Diskussionen wird oft die Thematik des Dopings im Leistungssport, der Schönheitsoperationen und die Einnahme von Ritalin durch Menschen behandelt. Diese genannten Themenbereiche beschäftigen sich alle mit dem Begriff "Enhancement".
Human Enhancement bedeutet auf Deutsch so viel wie menschliche Verbesserung bzw. menschliche Weiterentwicklung und meint die medizinischen und biotechnologischen Eingriffe in den menschlichen Organismus. Die Menschen möchten durch Human Enhancement die individuelle Leistungsfähigkeit durch biomedizinische Verfahren verbessern.
Bei Human Enhancement geht es um eine Verbesserung oder Erweiterung der psychischen und physischen Leistungen eines gesunden Menschen und nicht um eine Therapie bestehender Krankheiten. Dabei versucht ein gesunder Mensch, die eigene Lebenszeit zu verlängern, die Stimmung aufzuhellen, die Wahrnehmungsfähigkeiten des eigenen Spektrums zu vergrößern oder die psychischen, geistigen und sozialen Fähigkeiten zu erhöhen. Das Human Enhancement soll folglich dazu beitragen die individuelle Leistungsqualität zu erhöhen.
Was genau unter Human Enhancement verstanden wird und wie Human Enhancement eingeteilt werden kann und warum der Begriff "Anthropotechnik" eine wichtige Rolle spielt, wird in dieser Arbeit behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anthropotechnik
- Definition Human Enhancement
- Die Enhancement-Arten
- Neuro-Enhancement
- Pharmakologisches Neuro-Enhancement
- Neurobionisches-Enhancement
- Genetisches Enhancement
- Physisches Enhancement
- Die erschöpfte Gesellschaft
- Gesellschaftliche Anforderungen
- Persönliche Anforderungen
- Ethische Bewertung von Human Enhancement
- Die vier Positionen in den Human Enhancement Debatten
- Der Transhumanist
- Der liberale Ethiker
- Der konservative Ethiker
- Der Skeptiker
- Ethische Argumente die gegen Human Enhancement sprechen
- Persönliche Einschätzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beleuchtet die Thematik des Human Enhancements und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft. Er analysiert die verschiedenen Arten des Human Enhancements und beleuchtet die ethischen Fragen, die mit der Anwendung dieser Technologien verbunden sind. Der Text widmet sich auch der Frage, ob Human Enhancement eine Folge einer chronischen Überforderung der Gesellschaft ist.
- Definition und Einordnung von Human Enhancement
- Verschiedene Arten von Human Enhancement
- Ethische Aspekte und Debatten zum Thema Human Enhancement
- Die Rolle von Anthropotechnik im Kontext von Human Enhancement
- Der Zusammenhang zwischen Human Enhancement und der erschöpften Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Human Enhancements ein und definiert den Begriff im Kontext aktueller Diskussionen über Dopingsport, Schönheitsoperationen und Ritalineinnahme.
Das Kapitel "Anthropotechnik" beleuchtet die materielle Sichtweise der Anthropologie und erklärt, wie sich der Mensch durch die Anwendung von Technik selbst verändert. Der Autor bezieht sich auf die Theorien von Peter Sloterdijk und unterscheidet zwischen primären und sekundären Anthropotechniken.
Im Kapitel "Die Enhancement-Arten" werden verschiedene Arten von Human Enhancement wie Neuro-Enhancement, Genetisches Enhancement und Physisches Enhancement vorgestellt. Diese werden in Unterkapiteln näher erläutert und anhand von Beispielen illustriert.
Das Kapitel "Die erschöpfte Gesellschaft" analysiert die gesellschaftlichen und persönlichen Anforderungen, die zu einer Überforderung des modernen Menschen führen können.
Das Kapitel "Ethische Bewertung von Human Enhancement" beschäftigt sich mit den ethischen Aspekten der Human Enhancement-Technologien und diskutiert die Positionen verschiedener ethischer Strömungen.
Schlüsselwörter
Human Enhancement, Anthropotechnik, Neuro-Enhancement, Genetisches Enhancement, Physisches Enhancement, ethische Bewertung, Überforderung, Gesellschaft, Individuum, Technologie, Fortschritt, Lebenszeit, Leistung, Selbstbestimmung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Human Enhancement?
Human Enhancement bezeichnet medizinische oder biotechnologische Eingriffe in den menschlichen Körper, um die Leistungsfähigkeit gesunder Menschen über das normale Maß hinaus zu steigern.
Was ist Neuro-Enhancement?
Dabei geht es um die Steigerung kognitiver Leistungen (z.B. Konzentration, Gedächtnis) durch Medikamente wie Ritalin oder technische Verfahren wie Hirnstimulation.
Warum wird von einer "erschöpften Gesellschaft" gesprochen?
Der Begriff beschreibt den Zustand einer Gesellschaft, in der Individuen unter ständigem Leistungsdruck stehen und Enhancement nutzen, um der chronischen Überforderung standzuhalten.
Welche ethischen Positionen gibt es zum Enhancement?
Es wird zwischen Transhumanisten (Befürwortern), liberalen Ethikern, konservativen Skeptikern und generellen Kritikern unterschieden, die vor Ungleichheit und Selbstentfremdung warnen.
Was versteht Peter Sloterdijk unter Anthropotechnik?
Anthropotechnik beschreibt die Techniken und Verfahren, mit denen der Mensch sich selbst formt, diszipliniert und verändert – von der Bildung bis zur Gentechnik.
- Arbeit zitieren
- Nadine Kluge (Autor:in), 2017, Die erschöpfte Gesellschaft. Human Enhancement als Folge einer chronischen Überforderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377296