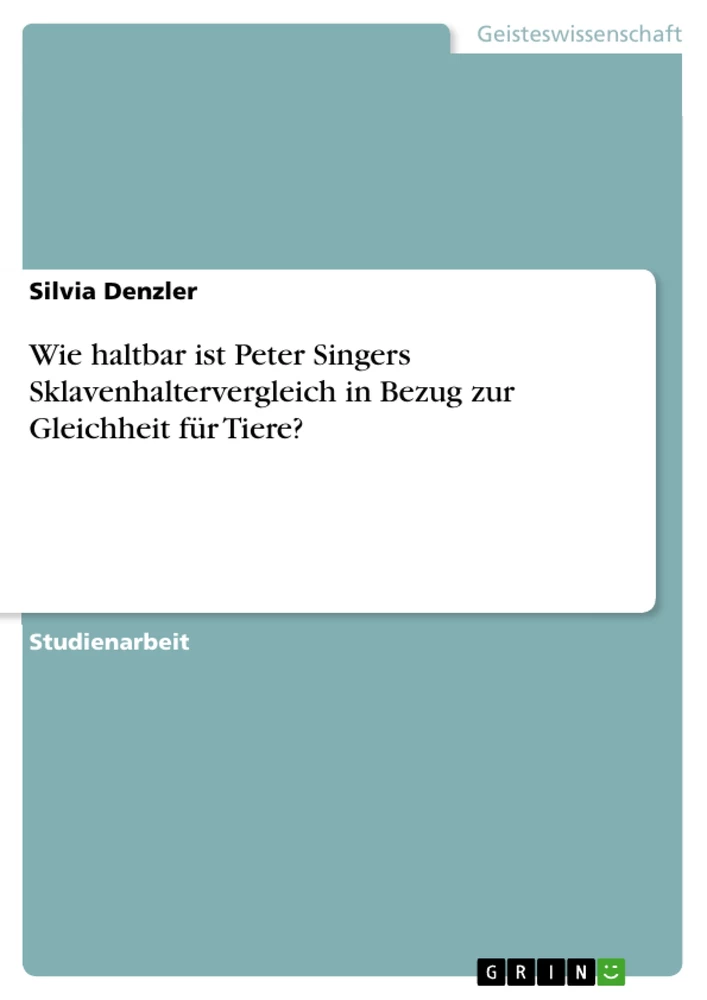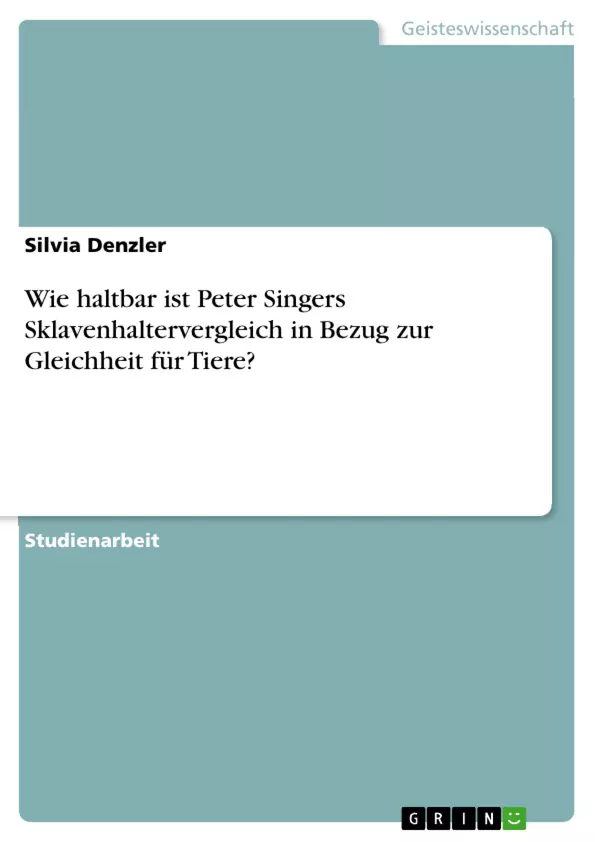Peter Singer gilt seit der Veröffentlichung seines Buches "Animal Liberation" als Pionier der Tierethik und wichtige Persönlichkeit der Tierrechtsbewegung der letzten vier Jahrzehnte. In seinem Buch "Praktische Ethik" begründet Singer im Kapitel "Gleichheit für Tiere" seinen tierethischen Ansatz, unter anderem führt er hier den Begriff des Speziesismus ein. Speziesismus ist eine Bezeichnung, die eine Ungleichbehandlung von anderen Tieren durch den Menschen ausdrückt und durch den Psychologen Richard D. Ryder 1970 konzipiert wurde. Der Speziesismus wird in der Tierethik analog zum Rassismus, der innerhalb der Spezies Mensch die Diskriminierung zwischen den Ethnien bezeichnet, verwendet. Da der Rassismus seit seiner Entstehung eine enge Verbindung zur Sklaverei aufweist, stellt Singer einen Vergleich zwischen dem moralischen Umgang mit Tieren und dem moralischen Umgang mit Sklaven seitens der Gesellschaft auf.
Wie haltbar dieser Sklavenhaltervergleich Singers in Bezug auf Tiere ist, soll durch diese Ausarbeitung überprüft werden. Dazu ist eine Auseinandersetzung mit der Geschichte der Sklaverei erforderlich, worauf im zweiten Kapitel eingegangen wird. Im dritten Kapitel werden neben dem von Peter Singer auch noch weitere Ansätze der Tierethik vorgestellt. Aus diesen unterschiedlichen Positionen der Tierethik wird im vierten Kapitel die Haltbarkeit des Singer’schen Sklavenvergleichs diskutiert und im fünften Kapitel schließlich konkludiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Geschichte der Sklaverei
- Sklaverei im Altertum
- Sklaverei in der Neuzeit
- Tierethik und Peter Singer
- Der präferenzutilitaristische Ansatz von Peter Singer
- Die anderen Ansätze in der Tierethik
- Haltbar oder nicht haltbar?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern Peter Singers Sklavenhaltervergleich in Bezug auf die Gleichheit für Tiere haltbar ist. Sie untersucht Singers Argumentation im Kontext seiner tierethischen Position und setzt diese in Beziehung zur Geschichte der Sklaverei.
- Die Geschichte der Sklaverei und ihre Auswirkungen auf den menschlichen Kontinuum
- Der präferenzutilitaristische Ansatz von Peter Singer und seine Kritik am Speziesismus
- Der Sklavenhaltervergleich Singers und seine Relevanz für die Tierethik
- Die verschiedenen Positionen in der Tierethik und ihre Implikationen für den Umgang mit Tieren
- Die ethische Diskussion um den Konsum von Tierprodukten und seine Beziehung zur Sklaverei
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt Peter Singers Sklavenhaltervergleich in den Kontext seiner tierethischen Position.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Geschichte der Sklaverei, wobei die Entwicklung der Sklaverei in der Antike sowie die soziokulturellen Auswirkungen der Sklaverei in der Neuzeit beleuchtet werden.
Im dritten Kapitel werden verschiedene Ansätze der Tierethik vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf dem präferenzutilitaristischen Ansatz von Peter Singer liegt.
Schlüsselwörter
Tierethik, Peter Singer, Speziesismus, Sklaverei, Gleichheit für Tiere, Präferenzutilitarismus, Sklavenhaltervergleich, Abolitionismus, Tierrechte, Konsum von Tierprodukten, Geschichte der Sklaverei, Anthropozentrismus, Zoozentrismus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Peter Singers Sklavenhaltervergleich?
Singer zieht in seinem Werk „Animal Liberation“ eine Analogie zwischen der historischen Unterdrückung von Sklaven und dem heutigen moralischen Umgang des Menschen mit Tieren.
Was bedeutet der Begriff „Speziesismus“?
Speziesismus bezeichnet die Diskriminierung von Lebewesen allein aufgrund ihrer Artzugehörigkeit. Singer nutzt den Begriff analog zum Rassismus innerhalb der menschlichen Spezies.
Wie begründet Singer seinen tierethischen Ansatz?
Singer vertritt einen präferenzutilitaristischen Ansatz. Er argumentiert, dass die Fähigkeit zu leiden das entscheidende Kriterium für moralische Berücksichtigung ist, nicht die Vernunft oder Spezies.
Ist der Vergleich zwischen Tieren und Sklaven haltbar?
Die Arbeit diskutiert diese Frage kritisch, indem sie die Geschichte der Sklaverei analysiert und verschiedene tierethische Positionen gegenüberstellt, um Singers Argumente zu prüfen.
Was ist der Unterschied zwischen Anthropozentrismus und Zoozentrismus?
Anthropozentrismus stellt den Menschen ins Zentrum aller ethischen Überlegungen, während Zoozentrismus Tieren aufgrund ihrer Empfindungsfähigkeit einen eigenen moralischen Status einräumt.
- Quote paper
- Silvia Denzler (Author), 2017, Wie haltbar ist Peter Singers Sklavenhaltervergleich in Bezug zur Gleichheit für Tiere?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377350