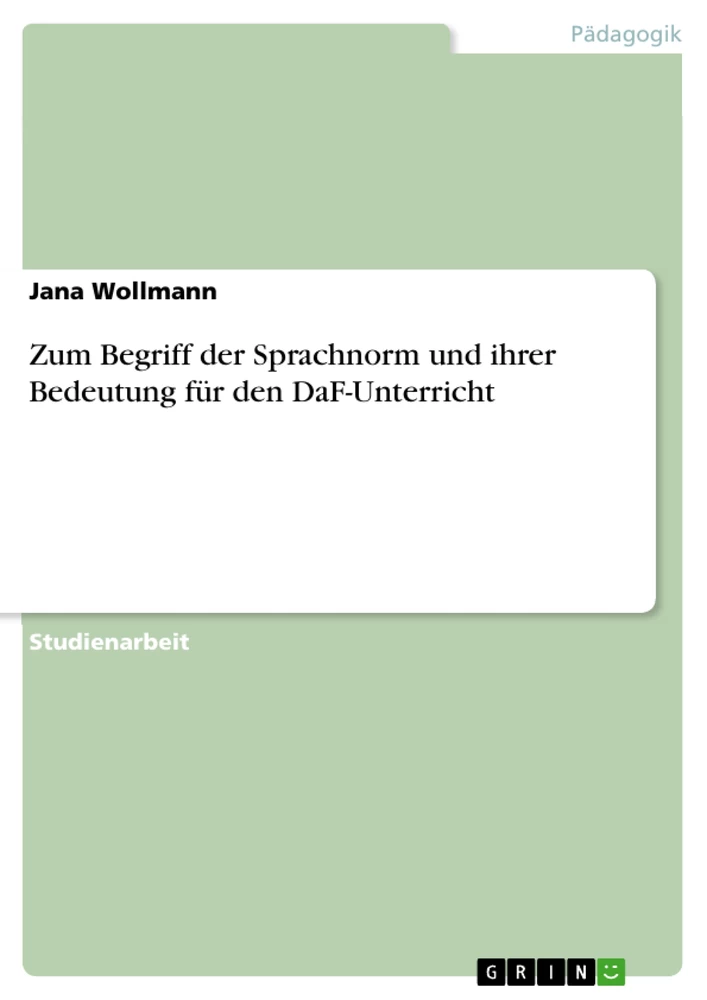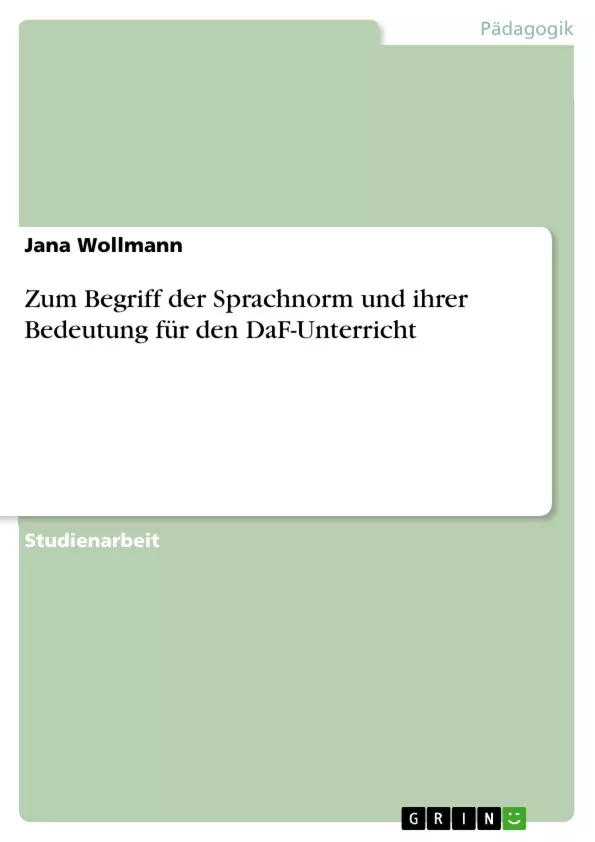Die Vielfalt von Dialekten und Varietäten, verschiedener Gruppensprachen, Varianten der gesprochenen und geschriebenen Sprache ist kennzeichnend für die deutsche Sprache. Sprachnormen als Orientierungshilfe sind unverzichtbar für den Sprachgebrauch, für das richtige Sprechen und Schreiben. Sie bilden "ein überwölbendes Dach, das Dialog und Verstehen innerhalb der Gesellschaft ermöglicht und niemanden ausgrenzt" (Götze 2001).
Was wird aber unter den Sprachnormen verstanden, wie entstehen und wie verändern sie sich? Die vorliegende Arbeit ist der Sprachnormproblematik gewidmet und setzt sich auch mit dem Thema aus der Sicht des Deutschen als Fremdsprache auseinander. Dabei soll den Fragen auf den Grund gegangen werden, inwiefern die Vermittlung der Variation im Unterricht relevant ist, ob es eine größere Normtoleranz erforderlich ist und welche Rolle dabei die DaF-Lehrer als Normvermittler spielen.
Zunächst werden der Sprachnormbegriff, mit ihm in Verbindung stehende Terminologie, die Funktionen und Merkmale der Sprachnormen im Allgemeinen vorgestellt. Drei Normkonzeptionen: von F. de Saussure, E.Coseriu und von der Prager Schule werden daraufhin präsentiert, um einen Eindruck von der Entstehung und Entwicklung des Begriffs in der Geschichte der Sprachwissenschaft zu bekommen.
Im Anschluss daran widmet sich ein Kapitel der sprachlichen Veränderungen, in welchem Sprachwandel, Sprachplanung und damit auch verbundener Normwandel thematisiert werden. Im Kapitel 3 wird auf die Relevanz der Norm für den DaF-Unterricht und ihre Problematik eingegangen, indem es zwischen der kodifizierten Sprachnorm und Gebrauchsnorm, Standard und Variation, Norm der gesprochenen und geschriebenen Standardsprache unterschieden wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Sprachnorm? (Definitionen)
- Sprache und Sprachnormen
- Normbegriff in der Sprachwissenschaft
- F. de Saussure
- E. Coseriu
- Sprachnorm und sprachliche Veränderungen
- Sprachwandel
- Normverletzungen
- Sprachplanung
- Sprachnormen im Zusammenhang mit Fremdsprachendidaktik und DaF-Unterricht
- Standard und Variation
- Normen der geschriebenen und gesprochenen Standardsprache
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Konzept der Sprachnormen und ihrer Relevanz in der deutschen Sprache. Sie analysiert die Entstehung und Entwicklung von Sprachnormen, beleuchtet die Problematik von Sprachwandel und Normveränderungen und untersucht die Bedeutung von Normen im Kontext des Deutschunterrichts als Fremdsprache.
- Definition und Konzepte der Sprachnorm
- Sprachwandel und Normwandel
- Die Rolle von Sprachnormen im DaF-Unterricht
- Standardsprache, Variation und Norm
- Die Funktionen und Eigenschaften von Sprachnormen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Sprachnormen ein und betont ihre Bedeutung für die Verständigung und Integration in der deutschen Gesellschaft. Die Arbeit widmet sich der Frage nach der Entstehung und Entwicklung von Sprachnormen sowie deren Relevanz im Deutschunterricht als Fremdsprache.
- Was ist Sprachnorm? (Definitionen): Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs "Sprachnorm". Zunächst wird die Sprache als ein komplexes System von Ausdrucksmöglichkeiten und Regeln dargestellt. Anschließend werden verschiedene Konzeptionen der Sprachnorm vorgestellt, die wichtige Grundlagen für spätere Normauffassungen darstellen.
- Sprache und Sprachnormen: Dieser Abschnitt untersucht die Beziehung zwischen Sprache und Sprachnormen. Sprachnormen werden als soziale Erwartungen definiert, die den angemessenen Sprachgebrauch innerhalb der Möglichkeiten des Sprachsystems bestimmen. Der Abschnitt beleuchtet die Rolle von Sprachnormen in der Kommunikation und die Notwendigkeit von Konventionen für die erfolgreiche Verständigung.
- Normbegriff in der Sprachwissenschaft: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Ansätze zur Definition des Normbegriffs in der Sprachwissenschaft. Es werden die Konzeptionen von F. de Saussure und E. Coseriu vorgestellt, die wichtige Beiträge zur Diskussion um die Sprachnormproblematik geleistet haben.
- Sprachnorm und sprachliche Veränderungen: Dieses Kapitel untersucht die Wechselwirkung zwischen Sprachnormen und sprachlichen Veränderungen. Es thematisiert den Sprachwandel, Normverletzungen und die Rolle von Sprachplanung bei der Entwicklung und Stabilisierung von Sprachnormen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Sprachnorm, Sprachwandel, Normwandel, Standardsprache, Variation, Fremdsprachendidaktik, DaF-Unterricht, Deutsch als Fremdsprache, Sprachplanung und Kommunikation. Die Analyse der verschiedenen Konzepte und Ansätze zur Definition der Sprachnorm sowie die Untersuchung der Beziehung zwischen Sprachnorm und Sprachwandel bilden den Kern dieser Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einer Sprachnorm?
Sprachnormen sind soziale Erwartungen und Regeln, die den angemessenen Sprachgebrauch innerhalb einer Gesellschaft steuern und als Orientierungshilfe dienen.
Welche Rolle spielen Sprachnormen im DaF-Unterricht?
Sie definieren den Standard, den Lernende erreichen sollen, wobei Lehrer als Normvermittler zwischen kodifizierter Norm und tatsächlichem Sprachgebrauch abwägen müssen.
Wie unterscheiden sich de Saussure und Coseriu im Normbegriff?
Die Arbeit präsentiert verschiedene wissenschaftliche Konzeptionen zur Entstehung und Entwicklung des Normbegriffs in der Geschichte der Linguistik.
Was ist der Unterschied zwischen kodifizierter Norm und Gebrauchsnorm?
Die kodifizierte Norm ist in Regelwerken (wie dem Duden) festgeschrieben, während die Gebrauchsnorm den tatsächlichen, alltäglichen Umgang mit Sprache beschreibt.
Verändern sich Sprachnormen mit der Zeit?
Ja, die Arbeit thematisiert den Sprachwandel und Normwandel, der durch gesellschaftliche Veränderungen und Sprachplanung beeinflusst wird.
- Quote paper
- Jana Wollmann (Author), 2012, Zum Begriff der Sprachnorm und ihrer Bedeutung für den DaF-Unterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377564