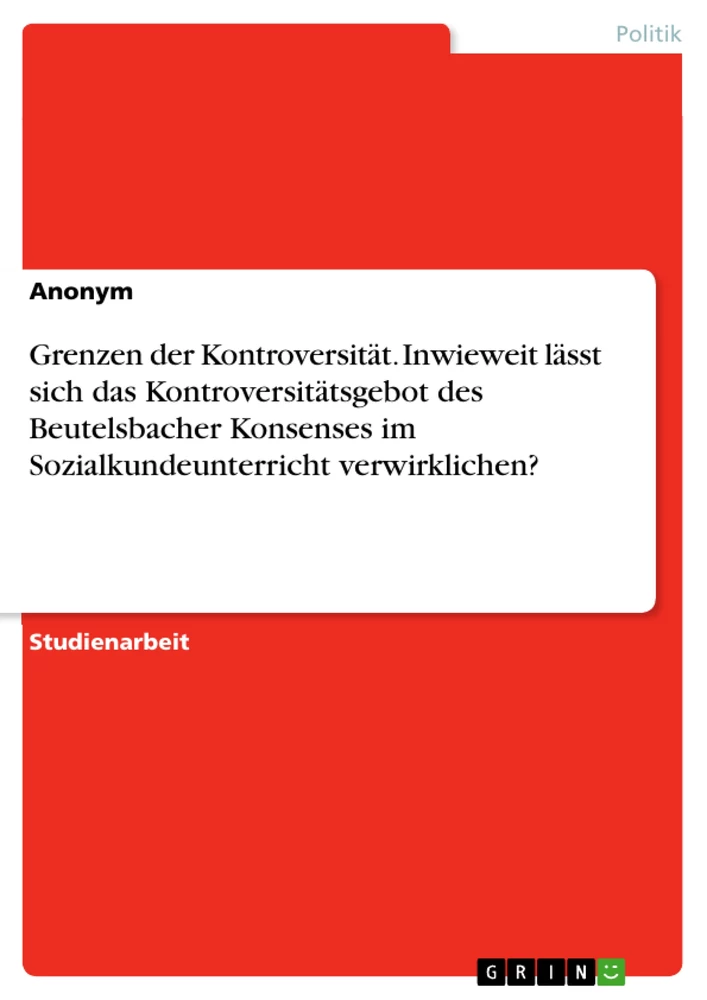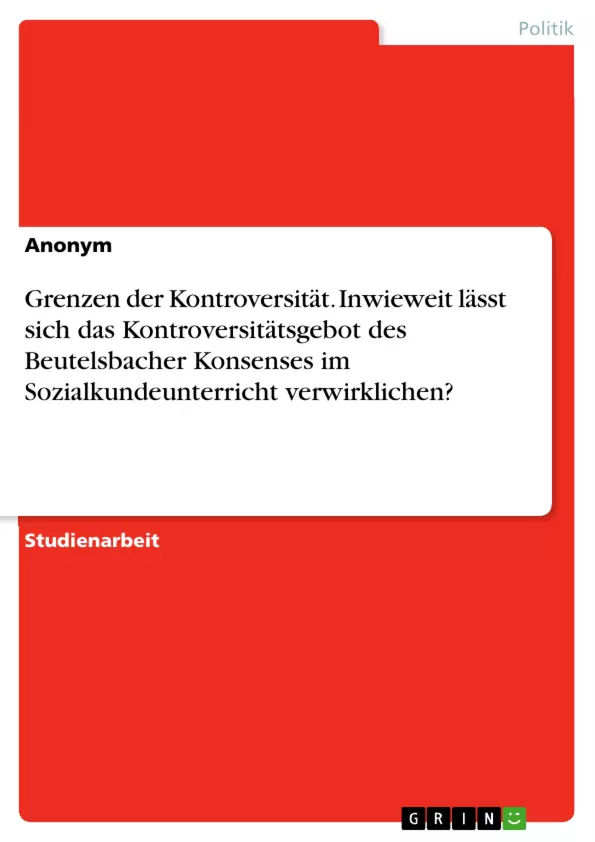In dieser Arbeit wird folgende Fragestellung untersucht: Inwieweit lässt sich das Kontroversitätsgebot des Beutelsbacher Konsenses im Sozialkundeunterricht verwirklichen? Um diese Frage zu beantworten wird im zweiten Kapitel der Inhalt des Beutelsbacher Konsens knapp dargestellt.
Anschließen folgt im dritten Kapitel eine genauere Betrachtung des Kontroversitätsgebotes sowie eine Untersuchung seiner Schwächen, Widersprüche und Probleme bei der Umsetzung in die Praxis, bevor daraufhin trotz aller Schwierigkeiten die Legitimation des Beutelsbacher Konsenses in der politischen Bildung begründet wird. Im fünften Kapitel wird mit der „Frankfurter Erklärung“ ein Versuch betrachtet, den Kontroversitätsbegriff im Politikunterricht neu auszulegen.
Zum Ende wird ein Fazit über die Möglichkeiten in der Praxis, dieses Gebot zu realisieren, gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Beutelsbacher Konsens
- Das Kontroversitätsgebot
- Kein Neutralitätsgebot
- Grenzen des Kontroversitätsgebotes
- Menschenverachtende und demokratiefeindliche Positionen
- Didaktische Reduktion
- Zwischen Formierung und Mündigkeit
- Rationaler Diskurs als Voraussetzung
- Legitimität des Beutelsbacher Konsenses in der Politikdidaktik
- Frankfurter Erklärung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Verwirklichung des Kontroversitätsgebotes im Sozialkundeunterricht. Sie untersucht, inwieweit das im Beutelsbacher Konsens festgelegte Prinzip der kontroversen Behandlung von Themen in der Praxis umgesetzt werden kann.
- Analyse des Beutelsbacher Konsenses und seiner zentralen Elemente, insbesondere des Kontroversitätsgebotes
- Untersuchung der Grenzen des Kontroversitätsgebotes und der damit verbundenen Herausforderungen für die Unterrichtspraxis
- Begründung der Legitimation des Beutelsbacher Konsenses in der politischen Bildung
- Rezeption des Kontroversitätsgebotes in der „Frankfurter Erklärung“
- Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen der Realisierung des Kontroversitätsgebotes im Sozialkundeunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Pluralität, Spannungen im Alltag und der Bedeutung von Politikunterricht für die Entwicklung politischer Urteilsfähigkeit beleuchtet. Kapitel 2 stellt den Beutelsbacher Konsens mit seinen drei zentralen Thesen – Überwältigungsverbot, Kontroversitätsgebot und Schülerorientierung – vor und erläutert den historischen Kontext seiner Entstehung. Kapitel 3 befasst sich ausführlich mit dem Kontroversitätsgebot, analysiert seine Bedeutung für die politische Bildung und beleuchtet verschiedene Aspekte seiner Anwendung in der Praxis. In Kapitel 4 wird die Legitimität des Beutelsbacher Konsenses in der Politikdidaktik begründet, während Kapitel 5 einen neuartigen Ansatz zur Interpretation des Kontroversitätsbegriffs im Politikunterricht – die „Frankfurter Erklärung“ – vorstellt. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die Möglichkeiten und Grenzen der Realisierung des Kontroversitätsgebotes im Sozialkundeunterricht zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Beutelsbacher Konsens, Kontroversitätsgebot, politische Bildung, Sozialkundeunterricht, politische Urteilsfähigkeit, Überwältigungsverbot, Schülerorientierung, Frankfurter Erklärung, politische Pluralität, Spannungen, gesellschaftliche Debatten, Didaktik, Unterrichtspraxis
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Beutelsbacher Konsens?
Ein Grundkonsens für die politische Bildung in Deutschland mit drei Prinzipien: Überwältigungsverbot, Kontroversitätsgebot und Schülerorientierung.
Was besagt das Kontroversitätsgebot?
Es besagt, dass Themen, die in der Gesellschaft oder Wissenschaft kontrovers diskutiert werden, auch im Unterricht kontrovers dargestellt werden müssen.
Gibt es Grenzen für die Kontroversität im Unterricht?
Ja, menschenverachtende oder demokratiefeindliche Positionen fallen nicht unter das Gebot und müssen als solche benannt werden.
Ist das Kontroversitätsgebot ein Neutralitätsgebot?
Nein, Lehrer müssen nicht wertneutral sein, dürfen aber ihre Schüler nicht indoktrinieren oder an der Bildung einer eigenen Meinung hindern.
Was ist die „Frankfurter Erklärung“?
Sie ist ein Versuch, den Kontroversitätsbegriff in der Politikdidaktik neu auszulegen und an moderne Herausforderungen anzupassen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Grenzen der Kontroversität. Inwieweit lässt sich das Kontroversitätsgebot des Beutelsbacher Konsenses im Sozialkundeunterricht verwirklichen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377694