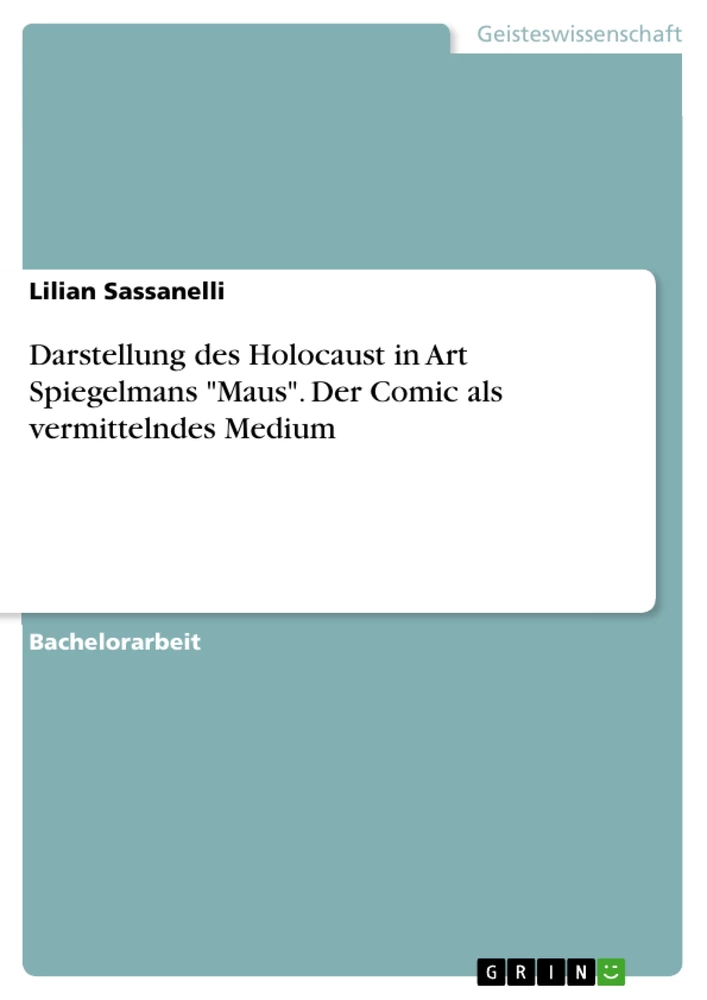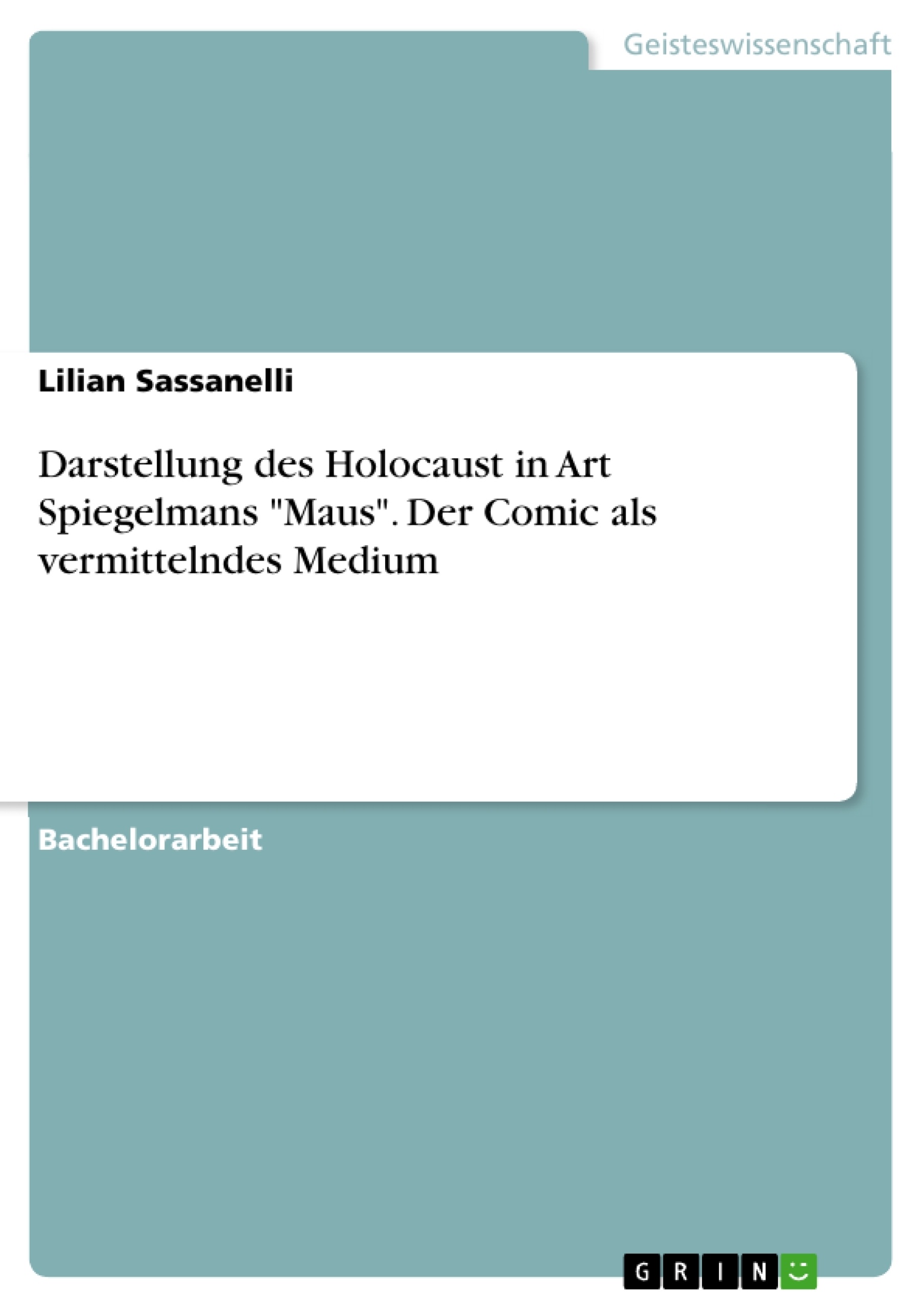Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage nach der Darstellbarkeit des Holocausts und die Vermittlung mittels der Medien an die neuen Generationen. Das Hauptaugenmerk der Analyse liegt auf das Medium Comic und das Welt bekannte Buch „Maus” von Art Spiegelman.
Das Medium Comic ist mit seiner bildlichen und schriftlichen Sprache ein potenziell sehr effektives Mittel zur Vermittlung der Geschichte in Schulklassen. Es hat vor allem die Möglichkeit, eine einfache Sprache zu verwenden, um komplexe Themen zu erzählen. Es ist daher ein geeignetes Medium sowohl für eine Erwachsene- als auch für eine Jugendliche-Leserschaft.
Zu Beginn der Arbeit wird die Debatte über die möglichen Formen der Darstellung des Holocaust erläutert. Danach wird der Boom der Erinnerungskultur, das Versterben der Zeitzeugen und der Umgang mit den neuen Generationen geschildert.
Nach der Darstellung einiger Studien rund um das Thema Comic als Lehrbuch wird das Comic Buch „Maus” mit seiner Inhaltsangabe eingeführt. Es folgt die Entstehungsgeschichte und zuletzt ein Kapitel über Spiegelmans Bedenken das Thema Holocaust in einem „trivialen” Medium, wie das Comic, zu erzählen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Auschwitz das „nicht-Darstellbare”
- Neue Medien für die neue Generation
- Comic als Lehrbuch
- ,,Maus”
- Entstehungsgeschichte
- Läuft „Maus” über Leichen?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Darstellung des Holocausts im Medium Comic und konzentriert sich insbesondere auf Art Spiegelmans Werk „Maus". Sie befasst sich mit der Frage, wie die Erinnerung an diesen historischen Schrecken an die neuen Generationen vermittelt werden kann und welche ethischen und politischen Herausforderungen die Verwendung des Comics für dieses sensible Thema mit sich bringt.
- Darstellbarkeit des Holocausts in unterschiedlichen Medien
- Vermittlung der Geschichte an neue Generationen
- Comic als Lehrbuch und seine Eignung für die Vermittlung komplexer Themen
- Analyse von Art Spiegelmans „Maus” und seiner Entstehungsgeschichte
- Ethische und politische Aspekte der Verwendung des Comics zur Darstellung des Holocausts
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die zentralen Fragestellungen vor. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Vermittlung des Holocausts an die neuen Generationen und hebt die Bedeutung des Mediums Comic in diesem Kontext hervor.
- Auschwitz das „nicht-Darstellbare”: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Debatte um die Darstellbarkeit des Holocausts und beleuchtet die ethischen und politischen Implikationen der verschiedenen Formen der Vermittlung. Es bezieht sich auf wichtige Denker wie Theodor W. Adorno und die Kontroversen um die „würdige" Darstellung des Schreckens.
- Neue Medien für die neue Generation: Dieses Kapitel analysiert den Wandel in der Erinnerungskultur und die Bedeutung neuer Medien für die Vermittlung des Holocausts an jüngere Generationen. Es beleuchtet den Einfluss des "Gedächtnis Booms" und die zunehmende Bedeutung der indirekten Kommunikation durch Medien im Kontext des Versterbens der Zeitzeugen.
- ,,Maus”: Das Kapitel stellt Art Spiegelmans Comic „Maus” vor und beleuchtet seine Entstehungsgeschichte. Es geht auch auf die ethischen Bedenken ein, die mit der Verwendung des Comics für die Darstellung des Holocausts verbunden sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Darstellung des Holocausts, Erinnerungskultur, Comic als Lehrbuch, „Maus" von Art Spiegelman, Vermittlung an neue Generationen, ethische und politische Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der Comic „Maus“ ein bedeutendes Werk der Holocaust-Literatur?
Art Spiegelmans „Maus“ nutzt die Bildsprache des Comics, um die komplexen und grausamen Erlebnisse des Holocausts auch für neue Generationen zugänglich und verständlich zu machen.
Ist das Medium Comic für ein ernstes Thema wie Auschwitz angemessen?
Die Arbeit diskutiert die Debatte über das „Nicht-Darstellbare“. Spiegelman zeigt, dass Comics durch ihre Kombination aus Text und Bild sowie eine einfache Sprache komplexe historische Themen effektiv vermitteln können.
Welche Rolle spielen die Metaphern in „Maus“?
Spiegelman stellt verschiedene Nationalitäten als Tiere dar (z. B. Juden als Mäuse, Deutsche als Katzen), was eine zusätzliche Interpretationsebene über Vorurteile und Verfolgung schafft.
Wie verändert sich die Erinnerungskultur durch das Versterben der Zeitzeugen?
Da immer weniger Zeitzeugen direkt berichten können, gewinnen mediale Vermittlungsformen wie Comics, Filme oder digitale Archive an Bedeutung für das kollektive Gedächtnis.
Welche ethischen Bedenken hatte Art Spiegelman bei der Arbeit an „Maus“?
Spiegelman setzte sich kritisch mit der Frage auseinander, ob die Darstellung des Holocausts in einem als „trivial“ geltenden Medium wie dem Comic den Opfern gerecht wird oder den Schrecken verharmlost.
- Quote paper
- Lilian Sassanelli (Author), 2016, Darstellung des Holocaust in Art Spiegelmans "Maus". Der Comic als vermittelndes Medium, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377778