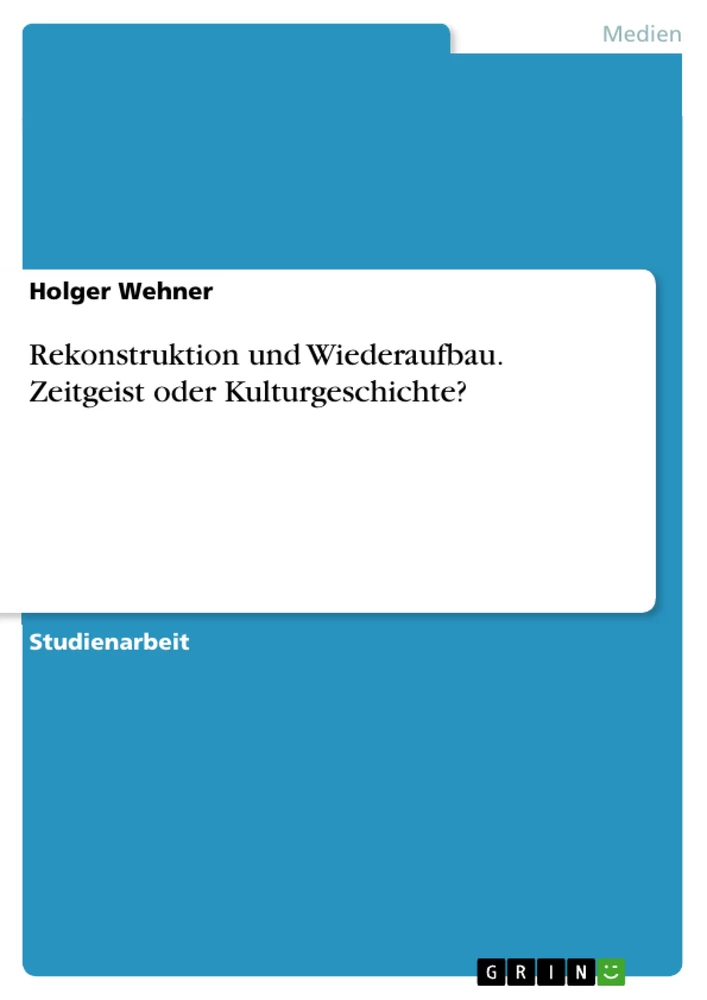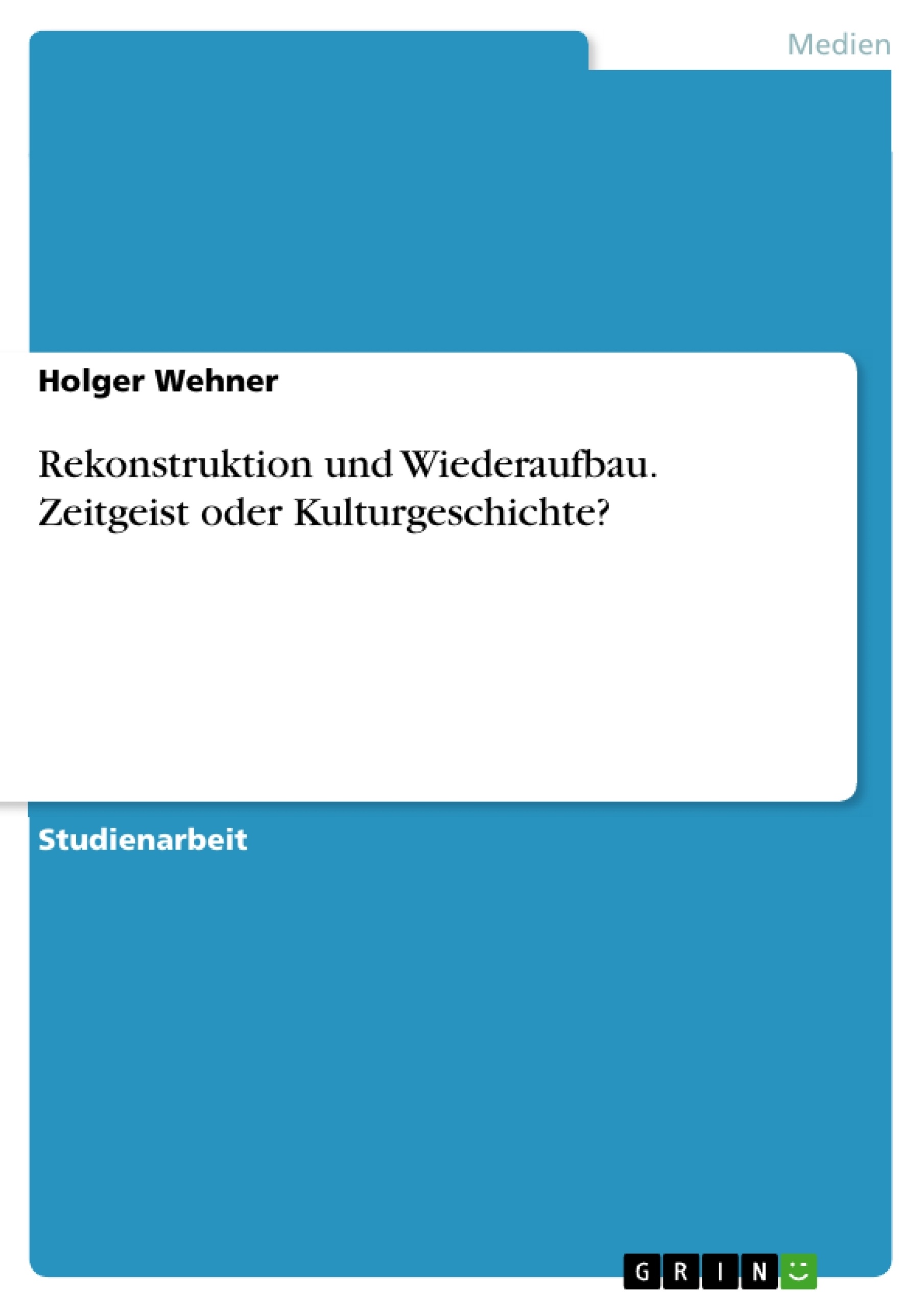In dieser Arbeit sollen die aufgeführten Fallbeispiele der vergangenen 250 Jahre die geschichtliche Entwicklung der Rekonstruktion anhand ihrer zu Grunde liegenden Motivation aus dem gesellschaftlichen und politischen Kontext heraus erläutern, ein Verständnis für die aktuelle Debatte zur sogenannten Rekonstruktionswelle schaffen und Basis für die Teilnahme an dieser Kontroverse sein.
In früheren Jahrtausenden und Jahrhunderten pflegten unsere Vorfahren ihr auf religiösen, ideologischen und materiellen Ursprüngen beruhendes Erbe von Generation zu Generation zu übertragen. Unser Wissen über diese Vorgänge schöpfen wir aus den Kulturen des Fernen Ostens, aus Lateinamerika und dem Islam. Für Europa seien für diese Tradition die Zünfte mit ihren wandernden Gesellen genannt.
Die Sorge um das Fortbestehen des Erbes bestand in der laufenden Erhaltung eines Bauwerkes und die Zusicherung der Funktion durch regelmäßigen Austausch verbrauchter Elemente oder dem Wiederaufbau nach der Zerstörung durch Menschenhand oder die Natur. Nicht wissenschaftlich fundierte Studien sprechen von einem Wartungsintervall von 52 Jahren bei präkolumbischen Tempel- und Palastbauten in Latein- und Südamerika. Bei Bauten asiatischer Völker wie zum Beispiel dem Shinto Heiligtum von Ise werden alle Schreine seit ihrer Entstehung im 7. Jahrhundert in einem Turnus von 20 Jahren neu errichtet, wobei von der handwerklichen Tradition nicht abgewichen werden darf.
Für die Begriffe Rekonstruktion und Wiederaufbau bestehen in der aktuellen sprachlichen Artikulation unterschiedliche Definitionen und Auffassungen. Zum einen wird mit ihnen die gesamte politische Umgestaltung, d.h. die komplexe Erneuerung und Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen nach dem Zusammenschluss der beiden deutschen Nachkriegsstaaten in Verbindung gebracht, zum anderen existiert die geschichtliche Entwicklung im Bereich von Architektur und Denkmalpflege. Hier ist die Rekonstruktion von anderen denkmalpflegerischen Maßnahmen zu unterscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rekonstruktion im 19. Jhd
- Epoche
- Kathedrale in Herford
- Kathedrale in Metz
- Burganlage Pierrefonds
- Rekonstruktion Ende 19. Jh. und Anfang 20. Jh.
- Epoche
- Das Heidelberger Schloss
- Campanile de San Marco in Venedig und St. Michaelis in Hamburg
- Rekonstruktion Anfang 20. Jh. bis 1945
- Epoche
- St. Servatius in Quedlinburg
- Rekonstruktion von 1945 bis 1989
- Epoche
- Dom St. Stephanus & St. Sixtus zu Halberstadt
- Altstadt von Warschau
- Stadtensembles
- Rekonstruktion seit 1989
- Epoche
- Frauenkirche Dresden
- Neumarktbebauung in Dresden
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die historische Entwicklung der Rekonstruktion und des Wiederaufbaus von Baudenkmälern, betrachtet sie im Kontext des gesellschaftlichen und politischen Zeitgeistes und beleuchtet die verschiedenen Motive, die hinter diesen Eingriffen stecken. Der Fokus liegt darauf, ein Verständnis für die aktuelle Debatte um die Rekonstruktionswelle zu schaffen und eine Grundlage für die Teilnahme an dieser Kontroverse zu liefern.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Rekonstruktion und Wiederaufbau
- Historische Entwicklung der Rekonstruktion in unterschiedlichen Epochen
- Politische und gesellschaftliche Einflüsse auf die Rekonstruktionsmaßnahmen
- Die Rolle des Historismus und der stilistischen Reinheit
- Das Spannungsfeld zwischen Erhaltung und Rekonstruktion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Begriff der Rekonstruktion im Kontext der historischen Denkmalpflege vor und erläutert die unterschiedlichen Definitionen und Auffassungen. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die historische Entwicklung der Rekonstruktion anhand von Fallbeispielen zu analysieren und ein Verständnis für die aktuelle Debatte zu schaffen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Rekonstruktion im 19. Jahrhundert. Es beleuchtet die Epoche des Historismus und die stilistische Reinheit, die in den Rekonstruktionsmaßnahmen zum Ausdruck kam. Als Beispiele werden die Kathedrale in Herford, die Kathedrale in Metz und die Burganlage Pierrefonds vorgestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich der Rekonstruktion Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts. Es beleuchtet die Epoche und die Rekonstruktion des Heidelberger Schlosses sowie des Campanile de San Marco in Venedig und St. Michaelis in Hamburg.
Das vierte Kapitel behandelt die Rekonstruktion von Anfang des 20. Jahrhunderts bis 1945 und fokussiert auf die Epoche und das Beispiel von St. Servatius in Quedlinburg.
Das fünfte Kapitel analysiert die Rekonstruktion von 1945 bis 1989 und betrachtet die Epoche, den Dom St. Stephanus & St. Sixtus zu Halberstadt, die Altstadt von Warschau und Stadtensembles.
Schlüsselwörter
Rekonstruktion, Wiederaufbau, Denkmalpflege, Historismus, Zeitgeist, gesellschaftliche Entwicklung, politische Einflüsse, stilistische Reinheit, Erhaltung, Konservierung, Restaurierung, Neubau, Fallbeispiele, Kontroverse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Rekonstruktion und Wiederaufbau?
Wiederaufbau bezeichnet oft die Wiederherstellung nach Zerstörung, während Rekonstruktion häufig die wissenschaftlich basierte Nachbildung eines verlorenen Zustands im Kontext von Denkmalpflege und Politik meint.
Welche Rolle spielte der Historismus im 19. Jahrhundert für die Rekonstruktion?
Im 19. Jahrhundert strebte man nach "stilistischer Reinheit", was oft dazu führte, dass Gebäude (wie die Kathedrale in Metz) in einem idealisierten historischen Stil rekonstruiert wurden.
Warum ist die Dresdner Frauenkirche ein bedeutendes Beispiel für moderne Rekonstruktion?
Sie symbolisiert die Versöhnung und den gesellschaftlichen Willen nach 1989, ein zerstörtes Wahrzeichen unter Verwendung originaler Fragmente originalgetreu wiedererstehen zu lassen.
Gibt es kulturelle Unterschiede im Umgang mit dem baulichen Erbe?
Ja, während in Europa oft der Erhalt der Originalsubstanz zählt, werden beispielsweise in Japan (Ise-Schrein) Tempel rituell alle 20 Jahre komplett neu errichtet, um die handwerkliche Tradition zu bewahren.
Warum ist die aktuelle "Rekonstruktionswelle" umstritten?
Kritiker sehen darin eine Geschichtsfälschung oder einen Rückzug in eine nostalgische Scheinwelt, während Befürworter die Heilung von Stadtbildern und die Identitätsstiftung betonen.
- Quote paper
- Holger Wehner (Author), 2010, Rekonstruktion und Wiederaufbau. Zeitgeist oder Kulturgeschichte?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377924