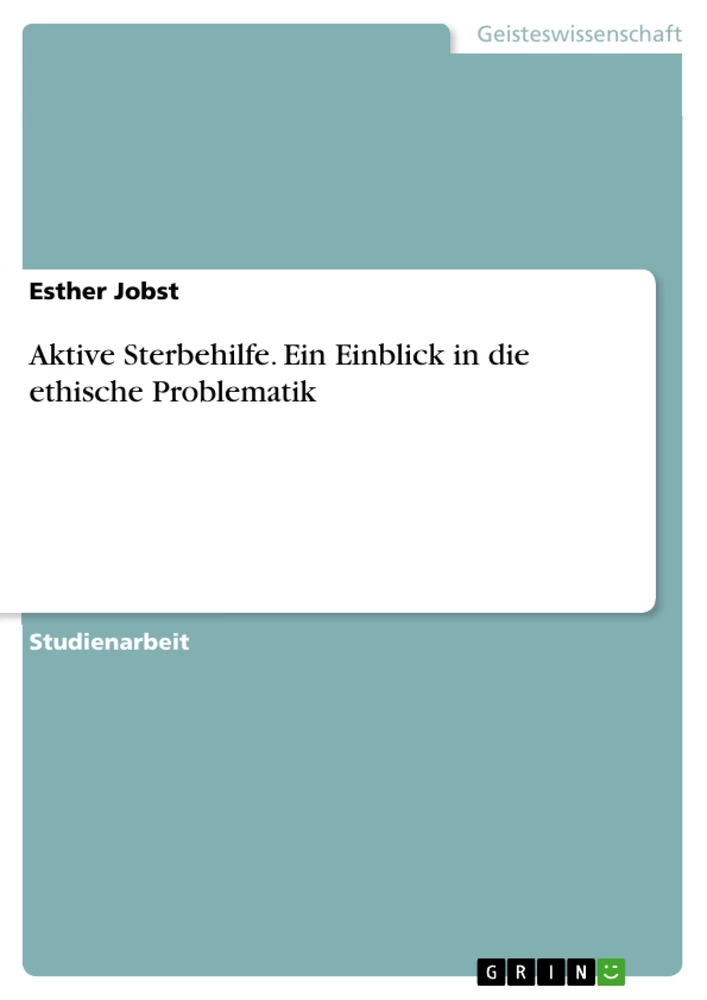In der folgenden Arbeit wird als erstes auf die verschiedenen Formen der Sterbehilfe eingegangen und der Begriff der aktiven Sterbehilfe von den anderen abgegrenzt. Danach werden unterschiedliche ethische Positionen und deren Statements geschildert. Anschließend geht es um die Argumentation bzw. die Ansätze hinsichtlich aktiver Sterbehilfe. Am Ende findet eine Analyse der Argumentationen statt, bevor eine ethische Stellungnahme verfasst wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Formen und erforderliche Unterscheidung zwischen Euthanasie und Sterbehilfe
- 3. Niederlande: Legalisierung der aktiven Sterbehilfe
- 3.1 Das holländische „Experiment“
- 3.2 Problemfelder bei der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe per Gesetz
- 4. Positionen zur Sterbehilfe
- 4.1 Österreichische Ärztekammer
- 4.2 Weltärztebund
- 4.3 Christentum
- 5. Argumente der aktiven Sterbehilfe
- 5.1 Argumente für die Befürwortung der aktiven Sterbehilfe
- 5.1.1 Utilitaristischer Ansatz
- 5.1.2 Respekt vor der Autonomie des Patienten (Ansatz individueller Autonomie)
- 5.2 Argumente gegen die aktive Sterbehilfe
- 5.2.1 Die Autonomie der Patienten
- 5.2.2 Christliche Werte
- 5.2.3 Ärztlicher Berufsethos
- 5.2.4 Der Wert des kranken Menschen
- 5.2.5 Möglicher Missbrauch der aktiven Sterbehilfe
- 5.1 Argumente für die Befürwortung der aktiven Sterbehilfe
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema der aktiven Sterbehilfe und untersucht die damit verbundenen ethischen Problematiken. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Formen der Sterbehilfe, beleuchtet die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe in den Niederlanden und stellt die Positionen verschiedener Akteure, wie z.B. der Österreichischen Ärztekammer und des Weltärztebundes, dar. Darüber hinaus werden Argumente für und gegen die aktive Sterbehilfe erörtert und schließlich eine ethische Stellungnahme zum Thema formuliert.
- Definitionen und Abgrenzung von Euthanasie und Sterbehilfe
- Das „Experiment“ der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe in den Niederlanden
- Positionen und Statements von relevanten Akteuren zum Thema Sterbehilfe
- Ethik der Sterbehilfe: Argumente für und gegen die aktive Sterbehilfe
- Ethische Stellungnahme zur Sterbehilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der aktiven Sterbehilfe ein und stellt die Relevanz des Themas in Bezug auf die veränderten Sterbebedingungen im 21. Jahrhundert heraus. Sie beleuchtet die Entwicklung des Sterbeortes von zu Hause hin zu Krankenanstalten und Heimen und diskutiert die damit verbundenen Herausforderungen, wie z.B. die Frage nach lebensverlängernden Maßnahmen und die Autonomie des Patienten.
Das zweite Kapitel differenziert die verschiedenen Formen der Sterbehilfe, insbesondere Euthanasie und Sterbehilfe, und zeigt die Entwicklung der Begriffsdefinitionen im Laufe der Zeit auf. Eberhard Schockenhoff's Unterscheidung zwischen Sterbehilfe als Hilfe im Sterben, Sterbenlassen, Sterbehilfe unter Inkaufnahme einer möglichen Lebensverkürzung und Euthanasie als direkte Hilfe zum Sterben wird dargestellt. Die ethischen und medizinischen Herausforderungen der Abgrenzung der verschiedenen Formen werden hervorgehoben.
Kapitel 3 analysiert die Entwicklung der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe in den Niederlanden. Es beleuchtet das „holländische Experiment“ und die Kriterien, die für die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe maßgeblich waren. Darüber hinaus werden die Problemfelder diskutiert, die mit der Legalisierung einhergehen, wie z.B. die Missbrauchsmöglichkeiten und die schwierige Abgrenzung von Krankheitsprozessen und Sterbeprozessen.
Kapitel 4 präsentiert die Positionen verschiedener Akteure zum Thema Sterbehilfe, darunter die Österreichische Ärztekammer, der Weltärztebund und die christliche Position. Die jeweiligen Statements werden zusammengefasst und in Bezug auf die Debatte um die aktive Sterbehilfe eingeordnet.
Kapitel 5 erörtert die Argumente für und gegen die aktive Sterbehilfe. Die Argumente der Befürworter, wie der utilitaristische Ansatz und der Respekt vor der Autonomie des Patienten, werden dargestellt. Im Anschluss werden die Argumente der Gegner, wie die Autonomie der Patienten, christliche Werte, der ärztliche Berufsethos, der Wert des kranken Menschen und die Gefahr des Missbrauchs der aktiven Sterbehilfe, analysiert.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit konzentriert sich auf die Themen Sterbehilfe, Euthanasie, Autonomie, Lebensqualität, Menschenwürde, ethische Problematik, medizinische Entscheidungen, Patientenrechte und die rechtliche Regulierung der Sterbehilfe. Die Diskussion der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe in den Niederlanden wird ebenfalls beleuchtet, wobei insbesondere die Herausforderungen und Problemfelder im Fokus stehen.
- Quote paper
- Esther Jobst (Author), 2015, Aktive Sterbehilfe. Ein Einblick in die ethische Problematik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377958