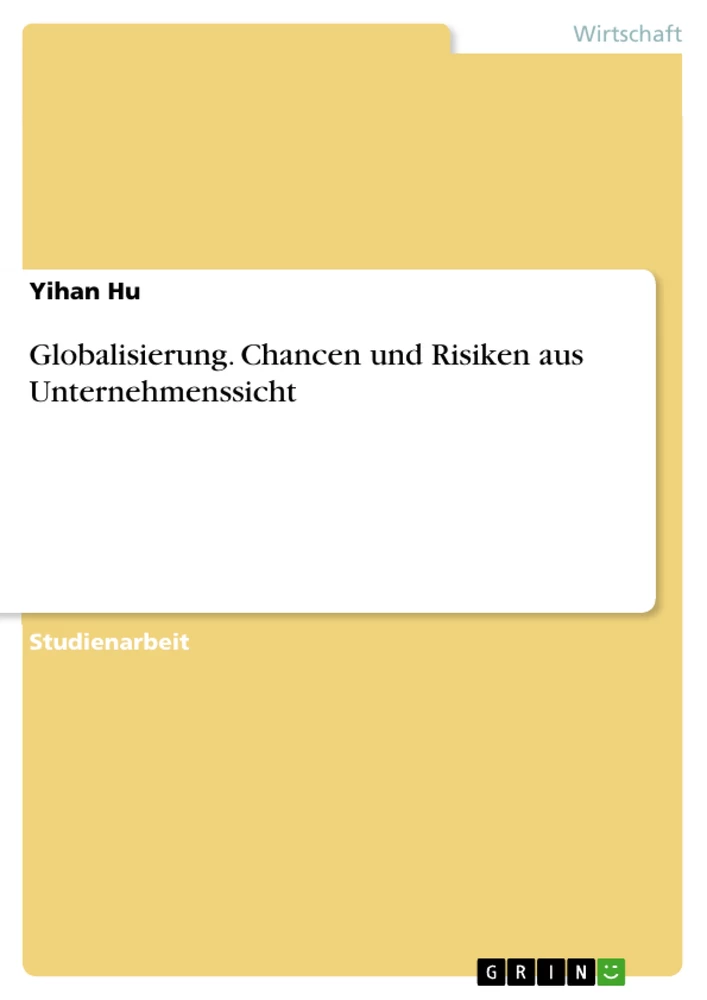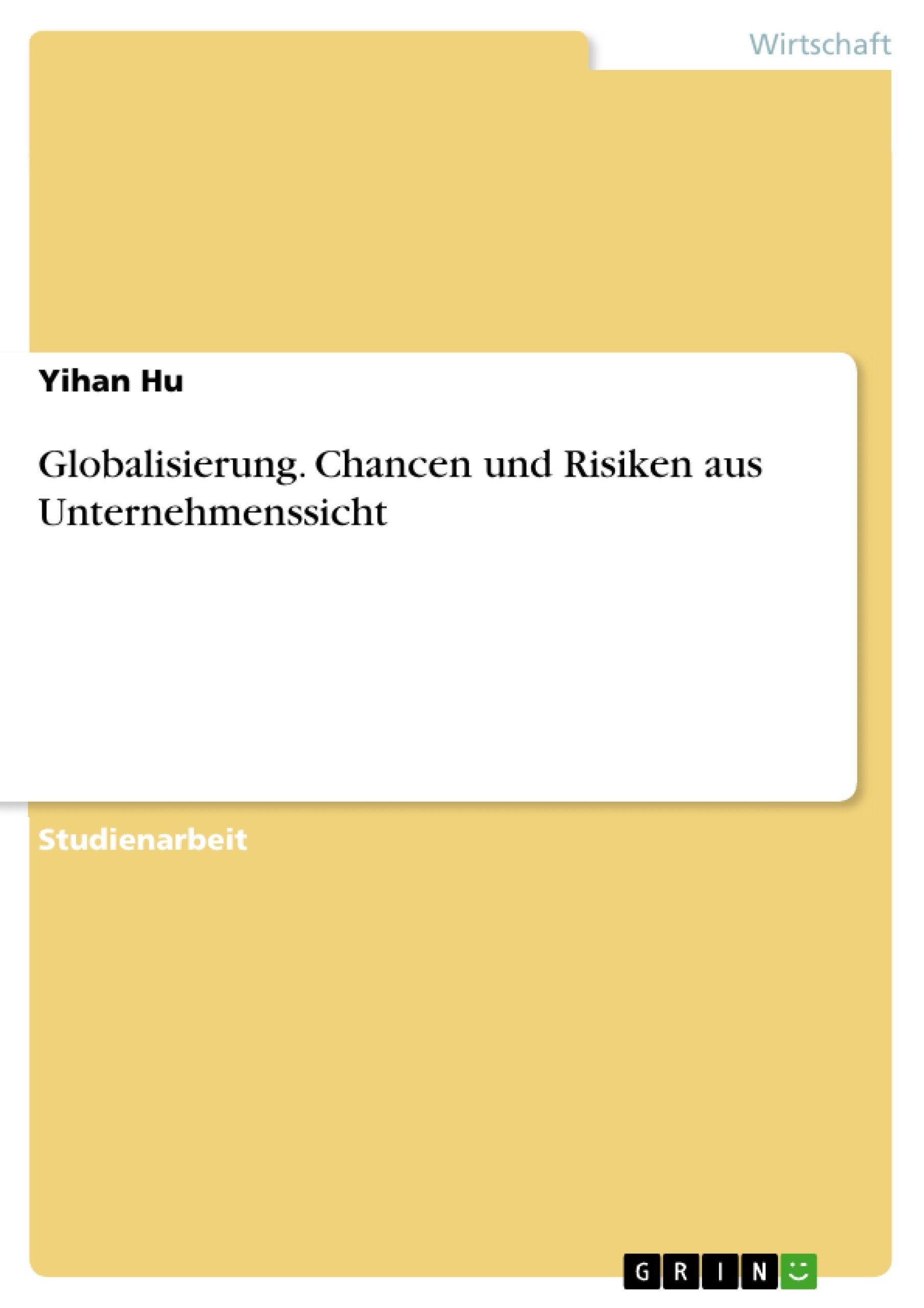Heute wird das Thema Globalisierung häufig in den Medien aufgrund des technischen Fortschritts und der stärkeren Kooperation zwischen verschiedenen Ländern aufgegriffen. Unter Globalisierung versteht man den Prozess der internationalen Verflechtung von Bereichen wie z.B. Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Kultur. In der vorliegenden Arbeit wird nur die Globalisierung der Wirtschaft diskutiert. Durch die Globalisierung entstehen Chancen und Risiken. Auf der einen Seite bringt Globalisierung neue Möglichkeiten für Wirtschaftswachstum und die Entwicklung der Wirtschaft, auf der anderen Seite verschärft die Globalisierung den Wettbewerb um Markt und Ressourcen.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Chancen und Risiken aus Unternehmenssicht die Globalisierung mit sich bringt. Zu Beginn der Arbeit wird der Begriff der Globalisierung erläutert und die Ursachen und Auswirkung der Globalisierung werden analysiert. Daran anschließend wird die vorgenannte Frage beantwortet. Im 3. Kapitel der Arbeit werden zunächst Chancen aus Unternehmenssicht dargestellt. z.B. ein größerer ausländischer Markt, neue Finanzierungs- und Investitionsmöglichkeiten, ein internationaler Arbeitsmarkt, internationale Beschaffung und ein globales Produktionsnetzwerk. In einem weiteren Punkt werden Risiken aus Unternehmenssicht aufgezeigt, wie Markteintrittsbarrieren, zunehmender Wettbewerb, Ressourcenknappheit und kulturelle Unterschiede.
Zum Schluss folgt eine Zusammenfassung der Chancen und Risiken, sowie eine kurze Analyse über Unternehmensstrategie und Entwicklung im Rahmen der Globalisierung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Globalisierung
- 3. Chancen aus Unternehmenssicht
- 3.1 Großer ausländischer Markt
- 3.2 Neue Finanzierungs- und Investitionsmöglichkeiten
- 3.3 Internationaler Arbeitsmarkt
- 3.4 Globales Produktionsnetzwerk
- 4 Risiken aus Unternehmenssicht
- 4.1 Markteintrittsbarrieren
- 4.2 Zunehmender Wettbewerb
- 4.3 Umweltproblem
- 4.4 Kultureller Unterschied
- 5 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Chancen und Risiken der Globalisierung aus Unternehmenssicht. Sie analysiert die Ursachen und Auswirkungen der Globalisierung und betrachtet die Vorteile und Herausforderungen, die sie für Unternehmen mit sich bringt.
- Definition und Ursachen der Globalisierung
- Chancen der Globalisierung für Unternehmen
- Risiken der Globalisierung für Unternehmen
- Einfluss von technologischem Fortschritt auf die Globalisierung
- Entwicklung von Unternehmensstrategien im Kontext der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema Globalisierung ein, erläutert den Begriff und beleuchtet die Ursachen und Auswirkungen dieses Prozesses. Kapitel 2 konzentriert sich auf die Chancen der Globalisierung für Unternehmen. Es werden Vorteile wie der Zugang zu größeren Märkten, neue Finanzierungs- und Investitionsmöglichkeiten sowie der Zugang zu einem internationalen Arbeitsmarkt und globalen Produktionsnetzwerken erörtert. In Kapitel 3 werden die Risiken der Globalisierung für Unternehmen thematisiert. Dazu gehören Markteintrittsbarrieren, zunehmender Wettbewerb, Umweltprobleme und kulturelle Unterschiede. Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung, die die Chancen und Risiken der Globalisierung zusammenfasst und die Entwicklung von Unternehmensstrategien im Kontext der Globalisierung diskutiert.
Schlüsselwörter
Globalisierung, Unternehmenssicht, Chancen, Risiken, technischer Fortschritt, Internationalisierung, Markteintritt, Wettbewerb, Ressourcenknappheit, kulturelle Unterschiede, Unternehmensstrategie, Wirtschaftswachstum, Internationaler Handel, GATT, WTO.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die größten Chancen der Globalisierung für Unternehmen?
Unternehmen profitieren von größeren ausländischen Märkten, neuen Finanzierungsmöglichkeiten, einem internationalen Arbeitsmarkt und globalen Produktionsnetzwerken.
Welche Risiken bringt die Globalisierung mit sich?
Zu den Risiken zählen Markteintrittsbarrieren, zunehmender Wettbewerbsdruck, Ressourcenknappheit, Umweltprobleme und kulturelle Unterschiede.
Wie beeinflusst der technische Fortschritt die Globalisierung?
Technischer Fortschritt, insbesondere in der Kommunikation und Logistik, ist der Motor, der die internationale Verflechtung von Wirtschaft und Gesellschaft erst ermöglicht.
Warum sind kulturelle Unterschiede ein Risiko?
Unterschiedliche Normen und Werte können die Kommunikation, Verhandlungen und die Akzeptanz von Produkten in ausländischen Märkten erschweren.
Welche Rolle spielen WTO und GATT?
Diese internationalen Organisationen und Abkommen regeln den Welthandel und zielen darauf ab, Handelsbarrieren abzubauen und den globalen Austausch zu fördern.
- Arbeit zitieren
- Yihan Hu (Autor:in), 2017, Globalisierung. Chancen und Risiken aus Unternehmenssicht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378214