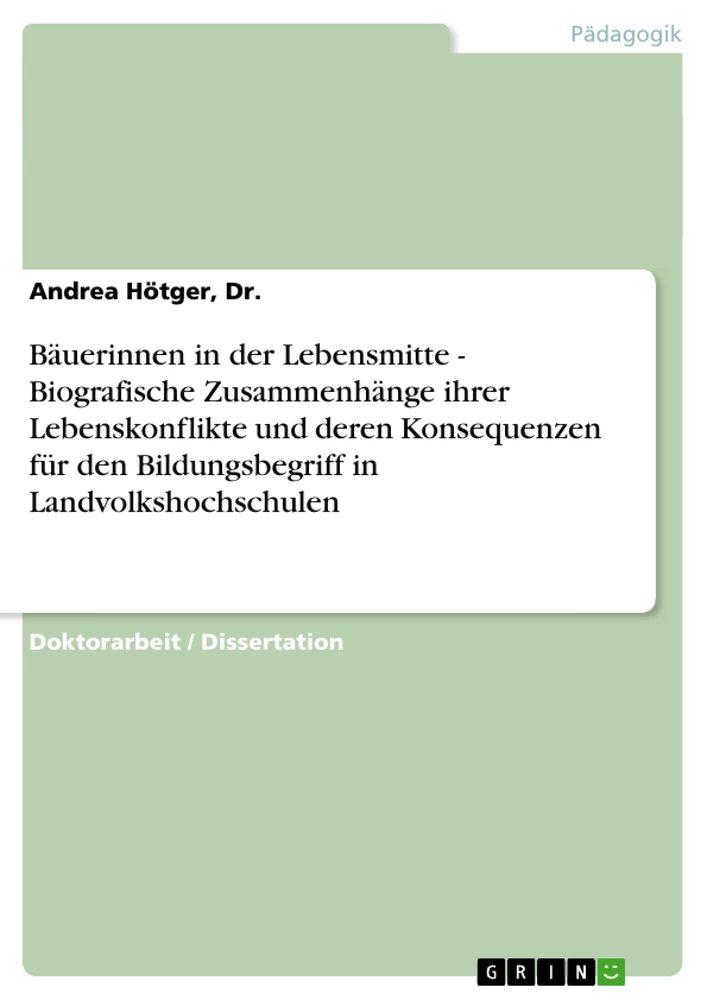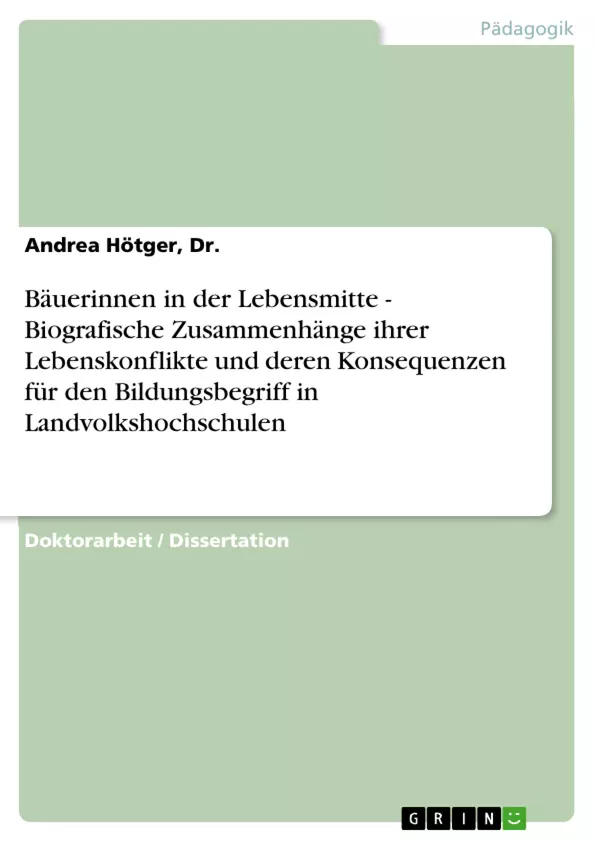In der Zeit der Individualisierung könnte vermutet werden, dass milieuspezifische Unterschiede, sei es zwischen Stadt und Land, zwischen Landwirtschaft und anderen Berufszweigen, oder Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht mehr relevant seien und insofern das Thema dieser Arbeit obsolet sei. Tatsächlich haben sich viele äußere Umstände der Bäuerinnen zum Positiven verändert: Die finanziellen Verhältnisse der noch existierenden Höfe sind oft gut, die Technisierung entlastet von starkem körperlichem Einsatz im Beruf, das Bildungsniveau der Frauen ist nicht niedriger als das der Männer, die Generationen leben in der Regel nicht mehr in einem Haushalt und können von daher einander ausweichen - wieso sollten die Bäuerinnen in der Lebensmitte noch spezifische Lebenskonflikte haben?
Den mehrfach vorgebrachten Einwänden entgegen führt die Erfahrung in der Bildungsarbeit mit westfälischen Bäuerinnen in der Lebensmitte zu der These, dass diese Frauen immer noch von besonderen, mit der bäuerlichen Kultur zusammenhängenden Problemen betroffen sind. Gerade in der Lebensmitte stehen die bisherigen Lebensmuster aufgrund äußerer Veränderungen zur Disposition, und neue Entwürfe sind oft nicht vorhanden. Während die Bäuerinnen nach außen die Akzeptanz der Lebenssituation und die eigene Leistungsfähigkeit betonen, sind in informellen Situationen immer wieder Bedrücktheiten und Traurigkeiten zu spüren, die sich durch verschämtes Weinen, vorsichtiges Erzählen familiärer oder betrieblicher Gegebenheiten oder aber die Abweisung genau solcher Themen äußern. Die Erzählungen ranken sich im Alter von ca. 50 Jahren häufig um den bevorstehenden Generationenwechsel im Betrieb oder aber um längst vergangene Zeiten.
Die im informellen Bereich der Seminare angesprochenen Themen nehmen jedoch im Seminarprogramm der Landvolkshochschulen nur wenig Raum ein. Angebot und Nachfrage richten sich vorwiegend auf zweckorientierte Seminare, wie z.B. Rhetorik für Vorstandsfrauen, allgemeine landwirtschaftliche und hauswirtschaftliche Kurse oder aber auf gesundheitsbezogene Veranstaltungen, religiöse Seminare und Einkehrtage. Die Bäuerinnen kommen gern und sooft ihre Familien oder sie selbst es sich erlauben, und nach den Veranstaltungen melden sie zurück: „Jetzt ist mein Akku wieder geladen“, oder: „Das Seminar war wie eine Oase für mich“. Die Bildungsangebote helfen den Frauen, die bestehende Situation besser zu ertragen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Vorliegende Theorien relevanter Themenkomplexe
- 2.1 Grundlagen der Forschung zur Sozialisation der Bäuerinnen
- 2.1.1 Allgemeine Grundlagen
- 2.1.2 Weibliche Sozialisation
- 2.1.3 Ländliche Sozialisation
- 2.1.4 Folgerungen für die Sozialisation der Bäuerinnen
- 2.2 Grundlagen der Forschung zum Erbe der Bäuerinnen
- 2.3 Grundlagen der Forschung zu Entwicklungsaufgaben der Bäuerinnen
- 2.4 Grundlagen der Forschung zur Moral der Bäuerinnen
- 2.5 Agrarsoziologische Sicht auf Bäuerinnen
- 2.6 Grundlagen der Theorie zur Landfrauenbildung in Landvolkshochschulen
- 3 Das Forschungsdesign
- 3.1 Der Forschungsansatz
- 3.2 Die Datenerhebung
- 3.3 Die Auswertung
- 4 Fallanalysen
- 5 Zusammenführung der Ergebnisse aus Empirie und Theorie
- 6 Theoretische Verallgemeinerungen und Perspektiven
- 6.1 Ergebnisse
- 6.2 Offene Forschungsfragen
- 6.3 Eckpunkte für den Bildungsbegriff in Landvolkshochschulen
- 6.4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dissertation untersucht die Lebenskonflikte von Bäuerinnen in der Lebensmitte und deren Auswirkungen auf den Bildungsbegriff in Landvolkshochschulen. Die Arbeit analysiert, wie sozialisationsspezifische, erbschaftliche, entwicklungsbedingte und moralische Aspekte das Leben dieser Frauen prägen und welche Rolle die Landvolkshochschulen in der Bewältigung dieser Konflikte spielen können.
- Sozialisation von Bäuerinnen im ländlichen Raum
- Erbe und dessen Einfluss auf das Leben von Bäuerinnen
- Entwicklungsaufgaben und Herausforderungen in der Lebensmitte
- Moralvorstellungen und deren Auswirkungen auf das Handeln der Bäuerinnen
- Frauenleitbilder und deren Relevanz für die Bildungsangebote
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Die Einleitung stellt die Problemstellung vor: Trotz positiver Veränderungen in den Lebensumständen von Bäuerinnen, zeigen sich in der Bildungs-arbeit mit ihnen tiefgreifende, oft unbemerkte Lebenskonflikte. Diese Konflikte finden in den bestehenden Bildungsangeboten der Landvolkshochschulen nur unzureichend Berücksichtigung. Die Arbeit untersucht daher die Lebenskonflikte dieser Frauen und deren Implikationen für den Bildungsbegriff in Landvolkshochschulen.
2 Vorliegende Theorien relevanter Themenkomplexe: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Theorien, die für das Verständnis der Lebenskonflikte von Bäuerinnen relevant sind. Es werden Theorien zur weiblichen Sozialisation, zum Erbe in landwirtschaftlichen Betrieben, zu Entwicklungsaufgaben im mittleren Lebensalter, zu Moralentwicklung und zu Frauenleitbildern im ländlichen Raum vorgestellt und kritisch diskutiert. Der Fokus liegt auf der Zusammenführung dieser Theorien, um ein umfassendes theoretisches Fundament für die empirische Untersuchung zu schaffen.
3 Das Forschungsdesign: Dieses Kapitel beschreibt den biografieorientierten, qualitativen Forschungsansatz der Dissertation. Es werden die Methoden der Datenerhebung (narrative Interviews) und der Auswertung (rekonstruktive Fallanalyse) detailliert erläutert und die Theorie-Empirie-Relation dargelegt. Die Wahl der Methoden wird begründet und deren Eignung zur Beantwortung der Forschungsfragen erläutert.
4 Fallanalysen: Dieses Kapitel präsentiert detaillierte Fallanalysen von vier Bäuerinnen. Für jede Bäuerin wird die Lebensgeschichte rekonstruiert und auf die in Kapitel 2 dargestellten theoretischen Konzepte bezogen. Die Analysen beleuchten die individuellen Lebenskonflikte der Frauen und deren Bewältigungsstrategien im Kontext ihrer sozialen und familiären Umgebung.
5 Zusammenführung der Ergebnisse aus Empirie und Theorie: Dieses Kapitel integriert die Ergebnisse der Fallanalysen mit den in Kapitel 2 vorgestellten Theorien. Es werden die zentralen Erkenntnisse der empirischen Untersuchung systematisch zusammengefasst und im Lichte der theoretischen Überlegungen interpretiert. Die Zusammenführung erlaubt es, generelle Muster und Zusammenhänge der Lebenskonflikte von Bäuerinnen aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Bäuerinnen, Lebensmitte, Lebenskonflikte, Sozialisation, Erbe, Entwicklungsaufgaben, Moral, Frauenleitbilder, Landvolkshochschulen, Bildungsbegriff, qualitative Sozialforschung, Biografieforschung, ländlicher Raum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Dissertation: Lebenskonflikte von Bäuerinnen in der Lebensmitte und deren Auswirkungen auf den Bildungsbegriff in Landvolkshochschulen
Was ist der Gegenstand dieser Dissertation?
Die Dissertation untersucht die Lebenskonflikte von Bäuerinnen in der Lebensmitte und deren Auswirkungen auf den Bildungsbegriff in Landvolkshochschulen. Sie analysiert, wie sozialisationsspezifische, erbschaftliche, entwicklungsbedingte und moralische Aspekte das Leben dieser Frauen prägen und welche Rolle die Landvolkshochschulen in der Bewältigung dieser Konflikte spielen können.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Sozialisation von Bäuerinnen im ländlichen Raum, den Einfluss des Erbes auf ihr Leben, Entwicklungsaufgaben und Herausforderungen in der Lebensmitte, Moralvorstellungen und deren Auswirkungen auf ihr Handeln, sowie Frauenleitbilder und deren Relevanz für die Bildungsangebote von Landvolkshochschulen.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Dissertation stützt sich auf verschiedene Theorien zur weiblichen Sozialisation, zum Erbe in landwirtschaftlichen Betrieben, zu Entwicklungsaufgaben im mittleren Lebensalter, zu Moralentwicklung und zu Frauenleitbildern im ländlichen Raum. Diese Theorien werden vorgestellt, kritisch diskutiert und zu einem umfassenden theoretischen Fundament zusammengeführt.
Welche Forschungsmethode wurde angewendet?
Es wurde ein biografieorientierter, qualitativer Forschungsansatz mit narrativen Interviews als Methode der Datenerhebung gewählt. Die Auswertung erfolgte mittels rekonstruktiver Fallanalyse. Die Wahl der Methoden wird detailliert begründet und ihre Eignung zur Beantwortung der Forschungsfragen erläutert.
Wie ist die Dissertation aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zu relevanten Theorien, ein Kapitel zum Forschungsdesign, Fallanalysen, ein Kapitel zur Zusammenführung von Empirie und Theorie, und abschließend ein Kapitel mit theoretischen Verallgemeinerungen, offenen Forschungsfragen, Eckpunkten für den Bildungsbegriff in Landvolkshochschulen und einem Fazit.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Dissertation präsentiert detaillierte Fallanalysen von vier Bäuerinnen, die ihre individuellen Lebenskonflikte und Bewältigungsstrategien im Kontext ihrer sozialen und familiären Umgebung beleuchten. Die Ergebnisse der Fallanalysen werden mit den theoretischen Überlegungen zusammengeführt, um generelle Muster und Zusammenhänge der Lebenskonflikte aufzuzeigen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen für den Bildungsbegriff in Landvolkshochschulen, indem sie Eckpunkte für ein verbessertes Bildungsangebot aufzeigt, das die spezifischen Lebenskonflikte von Bäuerinnen in der Lebensmitte berücksichtigt. Zusätzlich werden offene Forschungsfragen identifiziert, die zukünftige Forschung anregen sollen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Bäuerinnen, Lebensmitte, Lebenskonflikte, Sozialisation, Erbe, Entwicklungsaufgaben, Moral, Frauenleitbilder, Landvolkshochschulen, Bildungsbegriff, qualitative Sozialforschung, Biografieforschung, ländlicher Raum.
- Quote paper
- Andrea Hötger, Dr. (Author), 2003, Bäuerinnen in der Lebensmitte - Biografische Zusammenhänge ihrer Lebenskonflikte und deren Konsequenzen für den Bildungsbegriff in Landvolkshochschulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37828