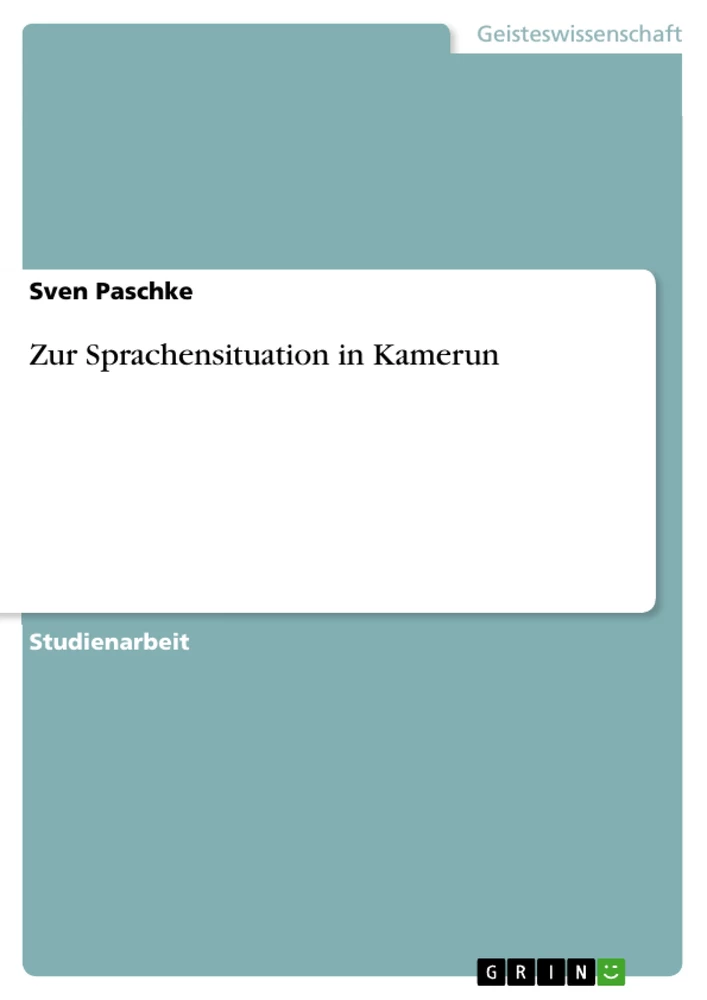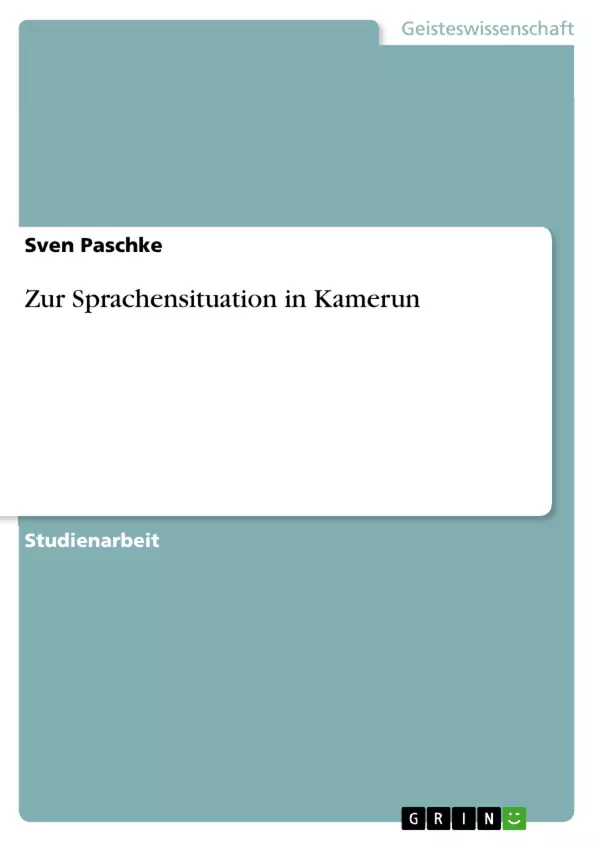Was heißt Kultur? In Hirschbergs Sinn ist sie “die Summe der von einem Volk hervorgebrachten und tradierten geistigen, religiösen und künstlerischen Werte sowie seiner Kenntnisse und Handfertigkeiten, Verhaltensweisen, Sitten und Wertungen, Einrichtungen und Organisationen, die in ihrer strukturellen Verbundenheit als eine Art gewachsener Organismus den Lebensinhalt” einer ethischen Gruppe charakterisiert wird.
Und welche selbst wiederum in und aus einem Netzwerk verschiedener Kulturen resultierte und von diesem noch immer Impulse erhält, verarbeitet und als Input an dieses zurückgibt. Nach dieser Definition stellt sich die Frage, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sich eine Kultur langfristig gegenüber anderen behaupten kann. Eine Tradition kann nur fortgeführt werden, wenn es ausreichend Individuen gibt, die sich ihrer kulturellen Identität bewußt sind und diese kollektiv an die nachfolgenden Generationen weitergeben.
Im anderen Fall geschieht dasjenige, was Schliemann zu seinem Ruhm führte. Damit es nicht zu einem “floating gap” kommt, wie es Vansina bezeichnet, ist es für den Menschen von primärer Natur sich verständigen zu können. Denn nur Sprache, ob mündlich oder schriftlich ermöglicht die Weitergabe von Informationen, welche in ihrer Verarbeitung Kultur erst ermöglicht. Dem zu Folge ist zu vermuten, dass jede kulturell noch existierende Gruppe, aufgrund ihrer Tradition, eine eigene Sprache besitzt. Grimes (1992) identifizierte 6528 noch existierende Sprachen, wovon 94% in Afrika, Asien Latein Amerika und im Pazifischen Raum beheimatet sind. Wenn weiterhin davon ausgegangen wird, dass etwa 90% der Weltbevölkerung 100 Sprachen sprechen, ist der Umstand zu klären, warum es für den homo sapiens nützlich sein kann, die verbleibenden 6428 Sprachen zu erhalten. Einer Studie von Neukomm und Mattissen (2000) zu Folge gibt es nur 75 offizielle Sprachen auf der Welt, oder anders ausgedrückt 98,9% aller Sprachen sind Minderheitssprachen.
In Ländern wie Papua Neuguinea mit 850 Sprachen, Indonesien mit 670 Sprachen oder Nigeria mit 470 Sprachen ist es auf den ersten Blick aus wirtschaftspolitischen Gründen verständlich Hilfssprachen, wie das Pidgin, und offizielle Sprachen zu fördern. Unter kulturellen Gesichtspunkten ist es zumindest dichotom: Einerseits bedeutet die Unterdrückung von Sprache gleichzeitig ihre Bedrohung, weil sie nicht mehr von der betreffenden Nation unterstützt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Prolegomena
- Sprachenpolitik und -situation
- Von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart
- Der Kolonialmachthaber und seine geförderten Sprachen
- Von der Wiedervereinigung bis in die 70er Jahre
- Die Entwicklung bis heute
- Der Sprachgebrauch in der Region Ombessa
- Der Sprachgebrauch in einzelnen Lebensbereichen
- Sprachkenntnisse und deren Einsatz im sozialen Umfeld
- Funktionen von Sprachen
- Fasolds Schema
- Chaudensons analytisches Netz
- Multilinguismus versus Oktroyierung einer Kolonialsprache
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Sprachensituation in Kamerun, einem Land mit einer hohen sprachlichen Diversität. Das Ziel ist es, die Entwicklung der Sprachenpolitik von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart zu untersuchen und den aktuellen Sprachgebrauch in der Region Ombessa zu beleuchten. Darüber hinaus werden die Funktionen von Sprachen in Kamerun im Sinne von Fasolds Schema und Chaudensons analytischem Netz betrachtet.
- Die Entwicklung der Sprachenpolitik in Kamerun von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart.
- Der Sprachgebrauch in der Region Ombessa, inklusive der Verwendung in verschiedenen Lebensbereichen und im sozialen Umfeld.
- Die Funktionen von Sprachen in Kamerun, insbesondere im Hinblick auf Fasolds Schema und Chaudensons analytisches Netz.
- Die Herausforderungen des Multilinguismus in Kamerun im Kontext der oktroyierten Kolonialsprache.
- Die Bedeutung der sprachlichen Diversität für die Erhaltung der kulturellen Identität in Kamerun.
Zusammenfassung der Kapitel
Prolegomena
Das Kapitel "Prolegomena" untersucht die Bedeutung von Kultur und Sprache für die Erhaltung einer kollektiven Identität. Es wird auf die Problematik des "floating gap" eingegangen, der durch den Verlust von Sprache und Traditionen entsteht. Außerdem wird die Rolle von Sprache als Mittel zur Weitergabe von Informationen und kulturellem Wissen hervorgehoben.
Sprachenpolitik und -situation
Von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Sprachenpolitik in Kamerun von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart. Es wird auf die Rolle der verschiedenen Kolonialmächte, die Förderung von Pidgin und Douala, sowie die Einführung des Französischen als Unterrichtssprache eingegangen. Außerdem werden die Auswirkungen der deutschen Kolonialpolitik auf die Sprachsituation in Kamerun, insbesondere die Einführung der deutschen Sprache als Unterrichtssprache ab der dritten Klasse, beschrieben.
Der Sprachgebrauch in der Region Ombessa
Dieses Kapitel untersucht den Sprachgebrauch in der Region Ombessa. Es geht auf die Verwendung verschiedener Sprachen in unterschiedlichen Lebensbereichen und im sozialen Umfeld ein.
Funktionen von Sprachen
Das Kapitel "Funktionen von Sprachen" widmet sich der Analyse der Funktionen von Sprachen in Kamerun. Es werden die Ansätze von Fasolds Schema und Chaudensons analytischem Netz zur Erklärung der unterschiedlichen Rollen von Sprachen in verschiedenen Kontexten vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Sprachensituation in Kamerun. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Sprachenpolitik, Sprachgebrauch, Multilinguismus, Kolonialsprache, Kultur, Identität, Pidgin, Douala, Französisch, Fasolds Schema, Chaudensons analytisches Netz, Region Ombessa.
- Citar trabajo
- Sven Paschke (Autor), 2004, Zur Sprachensituation in Kamerun, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37847