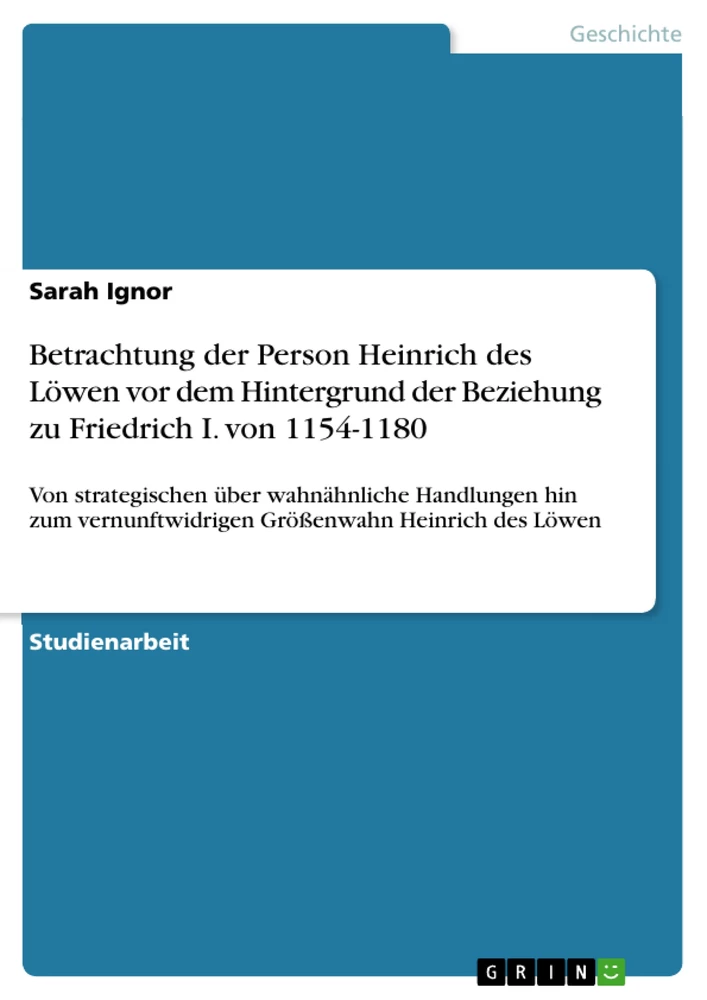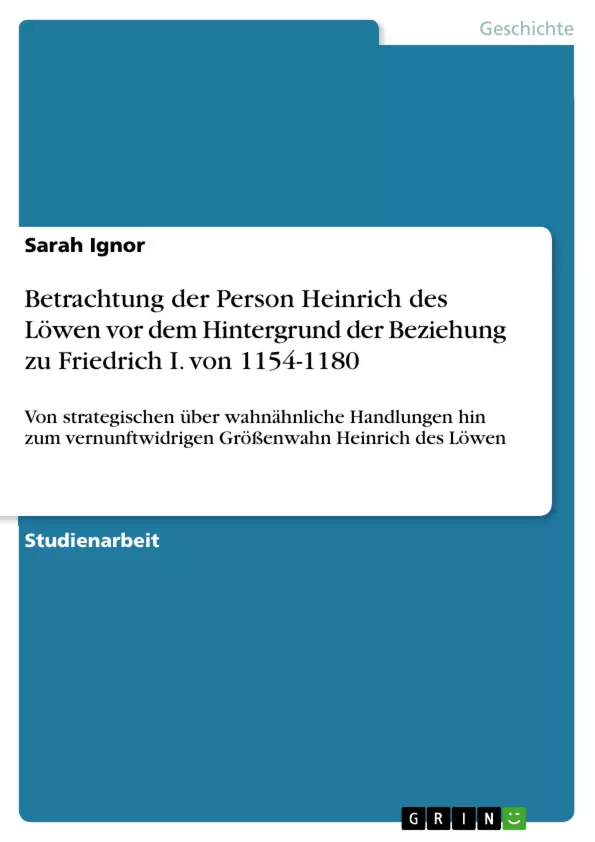In der modernen Forschung wird Heinrich der Löwe immer wieder als eine Persönlichkeit charakterisiert, die stetig nach mehr Macht strebte und sich des wachsenden Einflusses durchaus bewusst war. So erwähnt Hubertus Seibert 1999 Heinrichs „ausgeprägten Willen zur Selbstdarstellung“. 2009 untersucht Bernd Schneidmüller die ‚Innovationspotentiale‘ des Fürsten und spricht dabei von einem „Gestaltungswillen, der die gängigen Muster herzoglichen Handelns sprengte“ sowie einem „glanzvolle[n] Repräsentationswille[n]“. Heinrich schien ein Einzelgänger zu sein, der seine Interessen vorantreiben wollte. So erwähnt Schneidmüller auch Heinrichs „Verzicht auf die dauerhafte Einbindung des Konsenses adliger Standesgenossen“.
Insbesondere nach der Vergabe des Investiturrechts 1154 und des Herzogtums Bayern 1156 an Heinrich den Löwen, nahmen dessen Machtbestrebungen deutlich zu und führten 1180 schließlich, nach einer äußerst provokativen Handlung, zu seinem Sturz. Setzt man diese Tatsachen mit den Konzeptionen seiner Person in der modernen Forschung nun in Zusammenhang, ergibt sich die Frage, wie die zunächst strategisch erscheinenden Handlungen Heinrichs in einen Größenwahn münden konnten.
Dies soll chronologisch und insbesondere vor dem Hintergrund des Verhältnisses zwischen Friedrich I. und Heinrich dem Löwen in der Zeitperiode von 1154 bis 1180 erforscht werden. Zunächst wird der Begriff Größenwahn nach dem Philosophen Richard Avenarius und aus gegenwärtiger Sicht nach dem Wirtschaftswissenschaftler Philip Hermanns, näher definiert. Darauf aufbauend wird das dritte Kapitel die verwendeten Quellen vorstellen. Kapitel vier und fünf werden eine Auswertung der Kölner Königschronik und der Slawenchronik hinsichtlich von Impulsen, die auf Heinrich wirkten, sein Handeln beeinflussten und Reaktionen seiner Zeitgenossen hervorriefen, die Aufschluss darüber geben, wie er wahrgenommen wurde, vornehmen. Da für die Jahre 1154-1158 und 1168-1176 zwei verschiedene Impulsgeber ins Auge fallen, erfolgt eine Unterteilung in diese zwei Perioden. Lediglich ergänzend soll die Chronik des Otto von St. Blasien hinzugezogen werden, da sieeinen wichtigen Impuls beinhaltet, über welchen Helmolds Slawenchronik und die Kölner Königschronik schweigen, der jedoch einen erheblichen Einfluss auf die Untersuchung hat. Auf den Punkten eins bis fünf aufbauend, wird zum Schluss beantwortet, wie sich der Wandel Heinrichs vom Strategen zum Größenwahnsinnigen vollziehen konnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Größenwahn
- Vorstellung der Quellen
- Impulse und ihre Folgen 1154-1167
- Signale vom Kaiser 1154-1167
- Investiturrecht 1154
- Herzogtum Bayern 1156/57
- Mailand 1159
- Missgunst der Fürsten 1166/67
- Auswirkungen auf die Politik Heinrich des Löwen 1158-1160
- Stadtgründungen 1158-1160
- Slawenfeldzug 1160
- Reaktionen auf das Verhalten Heinrich des Löwen 1167/68
- Signale vom Kaiser 1154-1167
- Impulse und ihre Folgen 1168-1180
- Signale durch eigene Taten 1168-1176
- Hochzeit mit Mathilde von England 1168
- Fahrt nach Jerusalem 1172
- Demut Friedrichs I. 1176
- Auswirkungen auf die Politik Heinrich des Löwen 1176-1179
- Ignoranz der Demut des Kaisers 1176
- Fernbleiben vom Reichstag 1179
- Reaktionen auf das Verhalten Heinrich des Löwen 1179/80
- Signale durch eigene Taten 1168-1176
- Fazit
- Quellen und Literatur
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die zunächst strategisch erscheinenden Handlungen Heinrichs des Löwen in einen Größenwahn münden konnten. Der Fokus liegt dabei auf der chronologischen Analyse des Verhältnisses zwischen Friedrich I. und Heinrich dem Löwen in der Zeitperiode von 1154 bis 1180. Die Arbeit untersucht insbesondere die Impulse, die auf Heinrich wirkten, sein Handeln beeinflussten und Reaktionen seiner Zeitgenossen hervorriefen. Die Analyse soll Aufschluss darüber geben, wie er wahrgenommen wurde und wie sich der Wandel vom Strategen zum Größenwahnsinnigen vollziehen konnte.
- Analyse der Machtbestrebungen Heinrichs des Löwen vor dem Hintergrund seines Verhältnisses zu Friedrich I.
- Definition des Begriffs Größenwahn und seine Anwendung auf Heinrichs Verhalten.
- Untersuchung der Impulse, die Heinrichs Handeln beeinflussten und zur Wahrnehmung seines Verhaltens beitrugen.
- Chronologische Analyse des Wandels von Heinrichs strategischen Handlungen hin zum Größenwahn.
- Bedeutung der Kölner Königschronik und der Slawenchronik für die Untersuchung von Heinrichs Persönlichkeit und seinem Verhältnis zu Friedrich I.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Forschungsfrage, die sich mit der Frage beschäftigt, wie die zunächst strategisch erscheinenden Handlungen Heinrichs des Löwen in einen Größenwahn münden konnten. Kapitel zwei definiert den Begriff Größenwahn nach Richard Avenarius und Philip Hermanns, wobei die Unterscheidung zwischen rationalen und wahnähnlichen Handlungen hervorgehoben wird. Kapitel drei stellt die verwendeten Quellen vor, insbesondere die Kölner Königschronik und die Slawenchronik. Kapitel vier und fünf analysieren die Impulse, die auf Heinrich wirkten und sein Handeln beeinflussten, sowie die Reaktionen seiner Zeitgenossen. Die Kapitel werden in zwei Zeiträume unterteilt: 1154-1167 und 1168-1180.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Größenwahn Heinrichs des Löwen, der Macht und dem Verhältnis zwischen Heinrich und Friedrich I. in der Zeit von 1154 bis 1180. Weitere wichtige Schlüsselbegriffe sind: Impulse, Signale, Reaktionen, Strategien, Kölner Königschronik, Slawenchronik, Investiturrecht, Herzogtum Bayern, Mailand, Stadtgründungen, Slawenfeldzug, Demut, Ignoranz, Reichstag.
Häufig gestellte Fragen
Wie war das Verhältnis zwischen Heinrich dem Löwen und Friedrich I. Barbarossa?
Es war zunächst von strategischer Zusammenarbeit geprägt, wandelte sich jedoch über die Jahrzehnte durch Heinrichs wachsenden Machtanspruch in einen tiefen Konflikt.
Warum wird Heinrich der Löwe oft als „größenwahnsinnig“ bezeichnet?
Sein extremer Repräsentationswille, die Missachtung kaiserlicher Forderungen und sein Verzicht auf den adligen Konsens werden in der Forschung oft als Zeichen von Größenwahn gedeutet.
Was war der Auslöser für den Sturz Heinrichs des Löwen 1180?
Der Sturz erfolgte nach mehreren provokativen Handlungen, insbesondere seinem Fernbleiben von Reichstagen und der Weigerung, dem Kaiser militärische Unterstützung zu leisten.
Welche Rolle spielt die Slawenchronik als Quelle?
Helmolds Slawenchronik bietet wichtige Einblicke in Heinrichs Politik im Norden und wie seine Zeitgenossen seine Machtbestrebungen und Taten wahrnahmen.
Was bewirkte die Hochzeit mit Mathilde von England?
Die Heirat mit der englischen Königstochter steigerte Heinrichs internationales Ansehen und festigte seinen Anspruch auf eine herausgehobene Stellung im Reich.
- Citation du texte
- Sarah Ignor (Auteur), 2016, Betrachtung der Person Heinrich des Löwen vor dem Hintergrund der Beziehung zu Friedrich I. von 1154-1180, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378664