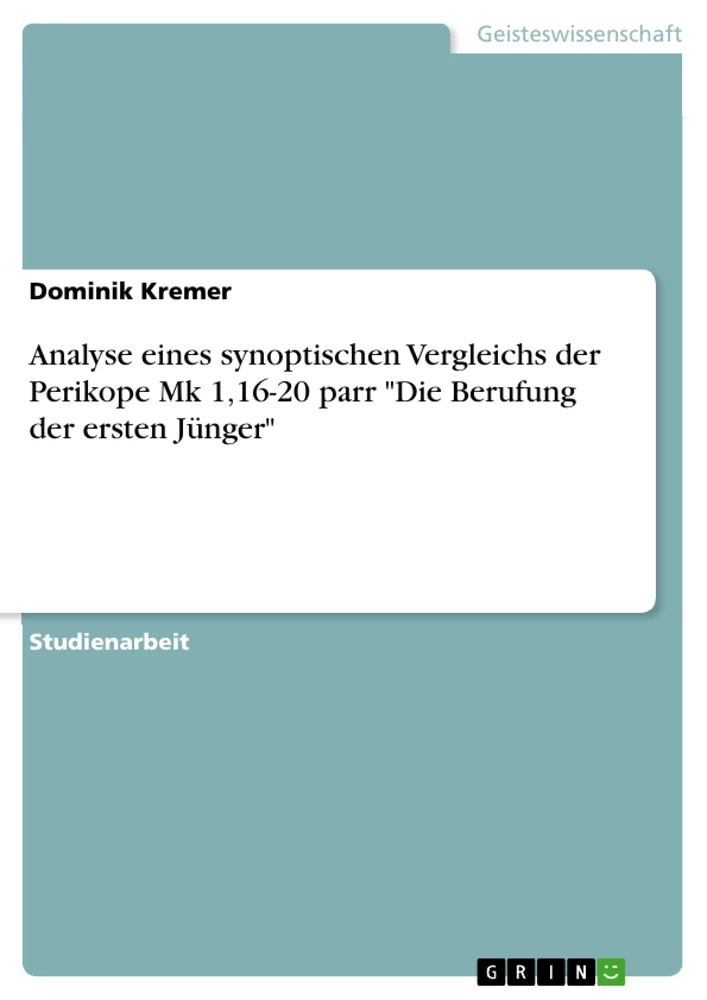In dieser Arbeit möchte ich eine Analyse eines synoptischen Vergleichs der Perikope Mk 1,16-20 parr „Die Berufung der ersten Jünger“, oder wie es auch übersetzt wird, „Die Berufung der ersten Schüler“ durchführen. Die Parallelstellen dieser Perikope lauten Mt 4,18-22 und Lk 5,1-11. Der synoptische Vergleich ist ein Verfahren, das mindestens zwei oder mehr Texte untersucht, die einen ähnlichen Stoff behandeln. Ziel dabei ist es, die Übereinstimmungen und Unterschiede der jeweiligen Texte herauszufinden. Die Auswertung besteht darin, die Abweichungen nach Wortwahl, Stil und sachlichen Veränderungen zu klassifizieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der synoptische Vergleich
- 2. Synoptischer Vergleich der Perikope Mk 1,16-20 parr.
- 2.1 Die Zwei-Quellen-Theorie
- 2.2 Die Stellung der Perikope im Aufriss des Evangeliums
- 2.3 Sprachlich-stilistische Auswertung
- 2.4 Sondergut der Evangelisten
- 2.5 Auswertung der sachlich – theologischen Kriterien
- 3. Gesamturteil der Perikope Mk 1,16-20 parr.
- 4. Persönlicher Kommentar
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert einen synoptischen Vergleich der Perikope Mk 1,16-20 parr, die die Berufung der ersten Jünger Jesu beschreibt. Die Zielsetzung besteht darin, die Übereinstimmungen und Unterschiede in den drei synoptischen Evangelien (Matthäus, Markus und Lukas) aufzuzeigen und zu interpretieren. Die Analyse berücksichtigt dabei verschiedene methodische Ansätze der neutestamentlichen Exegese.
- Synoptische Evangelien und ihre Beziehungen zueinander
- Die Zwei-Quellen-Theorie als Erklärungsmodell
- Unterschiede in der Darstellung der Jüngerberufung
- Theologische Implikationen der verschiedenen Darstellungen
- Stilistische und sprachliche Analyse der Perikope
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der synoptische Vergleich: Dieses Kapitel führt in die Methodik des synoptischen Vergleichs ein. Es erläutert den Begriff und das Verfahren, das mindestens zwei oder mehr Texte mit ähnlichem Stoff untersucht, um Übereinstimmungen und Unterschiede herauszuarbeiten. Die Klassifizierung von Abweichungen in Wortwahl, Stil und sachlichen Veränderungen wird beschrieben. Die Bedeutung des synoptischen Vergleichs für die neutestamentliche Exegese, insbesondere im Kontext der Evangelien, wird hervorgehoben, wobei die enge Verwandtschaft der Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas betont wird. Das Johannesevangelium wird aufgrund seiner signifikanten Unterschiede ausgeschlossen.
2. Synoptischer Vergleich der Perikope Mk 1,16-20 parr: Dieses Kapitel befasst sich mit der Analyse der Perikope Mk 1,16-20 und den Parallelstellen in Matthäus und Lukas. Es beginnt mit einer Diskussion der Zwei-Quellen-Theorie, die das Markusevangelium als älteste Quelle und die Existenz einer hypothetischen Spruchquelle (Q) annimmt. Die unterschiedlichen Positionen der Perikope in den drei Evangelien werden analysiert, wobei die jeweiligen Intentionen der Evangelisten im Hinblick auf die Darstellung von Jesu Wirken und der Jüngerberufung im Vordergrund stehen. Die unterschiedliche Gewichtung der Jüngerberufung im Verhältnis zu anderen Ereignissen in den Evangelien wird herausgestellt, insbesondere der Unterschied zwischen Markus und Matthäus, die die Jüngerberufung als erste Tat Jesu darstellen, im Gegensatz zu Lukas, der Jesu Wirken als Wanderprediger vor der Jüngerberufung betont.
Schlüsselwörter
Synoptische Evangelien, Zwei-Quellen-Theorie, Perikope Mk 1,16-20, Jüngerberufung, neutestamentliche Exegese, Matthäus, Markus, Lukas, Sprachliche Analyse, theologische Interpretation, Exegetische Methoden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Synoptischer Vergleich der Perikope Mk 1,16-20 parr.
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert synoptisch die Perikope Markus 1,16-20 und deren Parallelstellen in den Evangelien nach Matthäus und Lukas. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der drei Evangelien, um Übereinstimmungen und Unterschiede in der Darstellung der Berufung der ersten Jünger Jesu aufzuzeigen und zu interpretieren.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet methodische Ansätze der neutestamentlichen Exegese. Dies beinhaltet einen synoptischen Vergleich der Texte, die Analyse von sprachlichen und stilistischen Merkmalen, sowie die Berücksichtigung sachlich-theologischer Kriterien. Die Zwei-Quellen-Theorie dient als Erklärungsmodell für die Beziehungen zwischen den Evangelien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 führt in den synoptischen Vergleich ein. Kapitel 2 analysiert die Perikope Mk 1,16-20 parr. detailliert unter Berücksichtigung der Zwei-Quellen-Theorie, der Stellung der Perikope in den Evangelien, sprachlich-stilistischer Aspekte und sachlich-theologischer Kriterien. Kapitel 3 fasst die Ergebnisse des Vergleichs zusammen. Kapitel 4 enthält einen persönlichen Kommentar, und Kapitel 5 listet die verwendete Literatur auf.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Übereinstimmungen und Unterschiede in der Darstellung der Jüngerberufung in den synoptischen Evangelien aufzuzeigen und zu interpretieren. Die Analyse soll die unterschiedlichen Perspektiven und theologischen Intentionen der Evangelisten verdeutlichen.
Welche Schlüsselthemen werden behandelt?
Schlüsselthemen sind die synoptischen Evangelien und ihre Beziehungen zueinander, die Zwei-Quellen-Theorie, die unterschiedlichen Darstellungen der Jüngerberufung in Matthäus, Markus und Lukas, die theologischen Implikationen dieser Unterschiede, sowie stilistische und sprachliche Analysen der Perikope.
Welche Evangelien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas (die synoptischen Evangelien). Das Johannesevangelium wird aufgrund seiner signifikanten Unterschiede ausgeschlossen.
Was ist die Bedeutung der Zwei-Quellen-Theorie in dieser Arbeit?
Die Zwei-Quellen-Theorie dient als Rahmenmodell für den Verständnis des Verhältnisses zwischen den synoptischen Evangelien. Sie geht davon aus, dass das Markusevangelium die älteste Quelle ist und dass eine hypothetische Spruchquelle (Q) zusätzlich für Matthäus und Lukas als Quelle diente.
Wie wird die Perikope Mk 1,16-20 in den verschiedenen Evangelien dargestellt?
Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Positionen und Darstellungen der Perikope in den drei Evangelien. Besonderes Augenmerk wird auf die unterschiedliche Gewichtung der Jüngerberufung im Verhältnis zu anderen Ereignissen gelegt, z.B. der Unterschied zwischen Markus und Matthäus, die die Jüngerberufung als erste Tat Jesu darstellen, im Gegensatz zu Lukas.
- Quote paper
- Dominik Kremer (Author), 2011, Analyse eines synoptischen Vergleichs der Perikope Mk 1,16-20 parr "Die Berufung der ersten Jünger", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378676