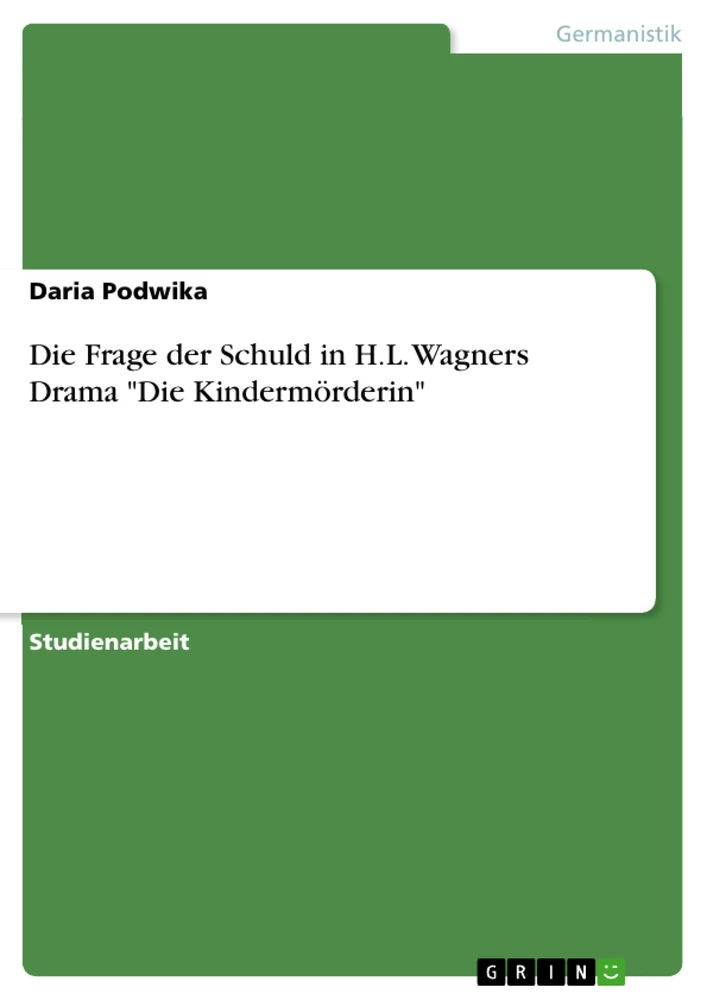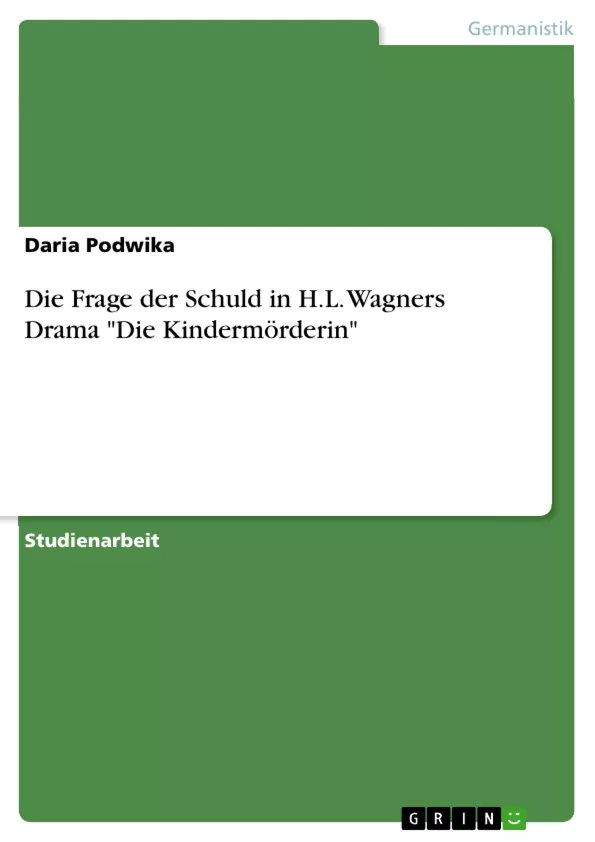Eines der aufregendsten Ereignisse in Frankfurt im Jahr 1771 handelt von einem Dienstmädchen namens Susanna Margareta Brandt. Das Dienstmädchen, von einem Bediensteten eines holländischen Kaufmanns verführt, verbirgt zunächst ihre Schwangerschaft, zieht sich zurück und gebärt heimlich und ohne Hilfe ein Kind, welches sie sofort erwürgt und gegen ein Fass schlägt. Die wegen Mordes zum Tode verurteilte Susanna Margaretha Brandt besteigt mit einem weißen Kleid und einer Zitrone in der Hand – als Zeichen der ‚armen Sünderin’ – das Schafott und wird in Anwesenheit eines großen Publikums enthauptet. Prominenter Zeuge dieses Prozesses war Johann Wolfgang Goethe. Durch das Schicksal der Dienstmagd berührt nimmt er diese als Vorbild für seine Gretchentragödie in seinem Werk Faust. Die frühe Neuzeit gilt als eine Zeit, in der die soziale Anerkennung eines Menschen von seinem guten Ruf abhängig war – besonders innerhalb seines Standes. In diesem Zusammenhang bezeichnet Katrin Heyer die Ehre als „das wichtigste Kapital eines Menschen und oftmals das einzige, was eine Frau zu verteidigen hatte.“ Ob verführt oder vergewaltigt – mit einem unehelichen Kind hatte eine Frau zu dieser Zeit keine Möglichkeit, ihre Ehre und diejenige ihrer Familie zurückzuerlangen. Zu erwarten war folglich der soziale Abstieg, der oft auf der untersten Stufe der sozialen Existenz endete. So diente die Tötung des Kindes dazu, sich selbst und die Familie der „gesellschaftlichen Schande“ bzw. der menschenverachtenden Gesellschaftsordnung zu entziehen, wobei diese natürlich mit dem Risiko verknüpft war, dass der Kindsmord aufgedeckt wird und die Mörderin zum Tod verurteilt wird. Schon in der Constitutio Criminalis Carolina, der Gerichtsordnung Karls V. von 1532, wird Folgendes festgehalten: „Straff der weiber so jre kinder tödten [...] die werden gewonlich lebendig begraben und gepfelt.“ Die Tötungsdelikte als „exemplarische Abschreckungsmittel“ reichten vom Säcken, Pfählen, Ertränken über Lebendig-Begraben bis hin zur Enthauptung mit einem Schwert oder Beil. Dabei fielen die Tatmotive in Hinblick auf das Urteil ebenso wenig ins Gewicht wie die psychische Verfassung der Täterin. Auch ob das Mädchen bzw. die Frau vergewaltigt wurde oder Eheversprechungen bekommen hatte, war für die Obrigkeit bzw. die Justiz nicht von Belang.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG: KINDSMORD IM 18. JAHRHUNDERT
- REKONSTRUKTION DER URSACHEN FÜR DEN KINDSMORD ALS KATASTROPHALE LÖSUNG
- EVCHENS FAMILIE UND ERZIEHUNG
- EVCHENS VERFÜHRUNG DURCH DEN OFFIZIER GRÖNINGSECK
- EVCHEN UND VON GRÖNINGSECK ALS OPFER EINER INTRIGE
- EVCHENS MELANCHOLIE UND WAHNSINN
- ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE
- DIE INTENTION HEINRICH LEOPOLD WAGNERS: KRITIK AN DER ZEITGENÖSSISCHEN GESELLSCHAFT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Heinrich Leopold Wagners bürgerliches Trauerspiel „Die Kindermörderin“ und befasst sich mit der Frage, inwieweit repressive Gesellschaftsstrukturen die Hauptfigur Evchen in die Katastrophe des Kindsmords treiben. Ziel ist es, die Ursachen für Evchens tragischen Schicksal aufzudecken und die Intention Wagners im Kontext der Gesellschaftskritik zu reflektieren.
- Repressive Gesellschaftsstrukturen im 18. Jahrhundert
- Einfluss von Macht- und Unterdrückungsstrukturen auf Evchens Leben
- Evchens Entwicklung von Melancholie zu Wahnsinn
- Die Rolle des Kindsmords als Symbol für die Misstände der Gesellschaft
- Die Intention Wagners in Bezug auf seine Gesellschaftskritik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Werk stellt den Kindsmord als ein gesellschaftliches Phänomen im 18. Jahrhundert vor und beleuchtet den Fall Susanna Margaretha Brandt, der als Vorbild für Goethes Gretchen diente. Die Bedeutung der Ehre und der gesellschaftlichen Strukturen werden in diesem Zusammenhang hervorgehoben.
- Rekonstruktion der Ursachen: Die Arbeit analysiert das Motiv des Kindsmords in Wagners „Die Kindermörderin“ und führt die entscheidenden Faktoren aus, die zu Evchens Handlung führen.
- Evchens Familie und Erziehung: Das Kapitel analysiert die Rolle von Evchens Familie und insbesondere ihres Vaters, der durch seine strenge Erziehung und Kontrolle Evchens Handlungsspielraum einschränkt.
- Evchens Verführung: Die Arbeit beleuchtet die Beziehung zwischen Evchen und dem Offizier Gröningseck und die damit verbundenen Auswirkungen auf Evchens Selbstbild und soziale Position.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Kindsmord, gesellschaftliche Strukturen, Unterdrückung, Melancholie, Wahnsinn, Ehre, Vater-Tochter-Beziehung, Gesellschaftskritik, Heinrich Leopold Wagner, „Die Kindermörderin“.
- Quote paper
- Daria Podwika (Author), 2017, Die Frage der Schuld in H.L. Wagners Drama "Die Kindermörderin", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378757