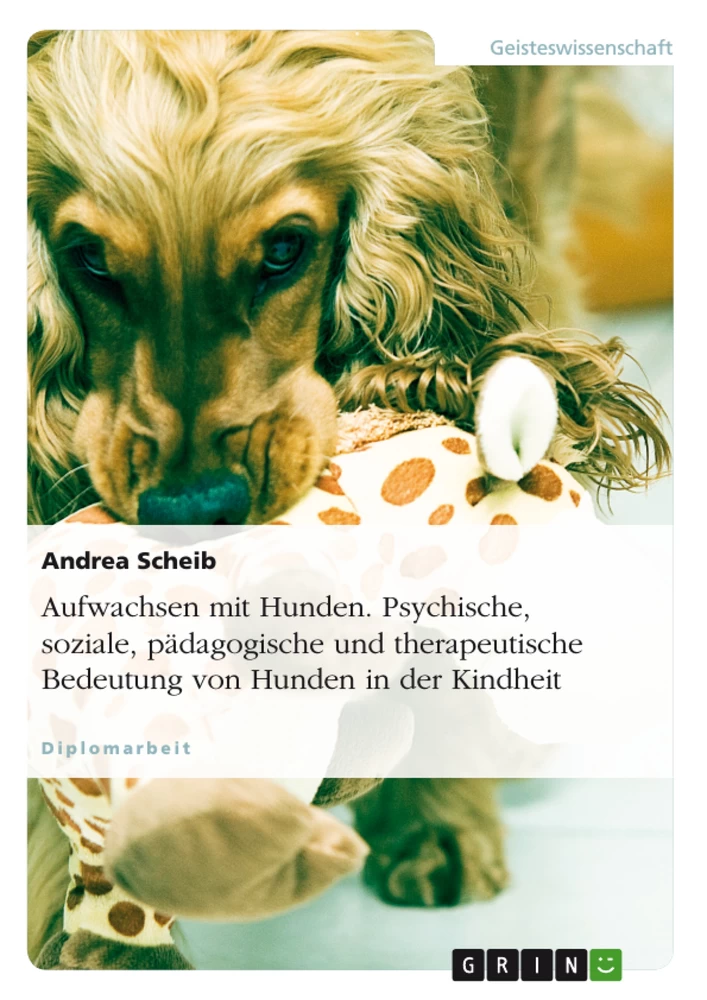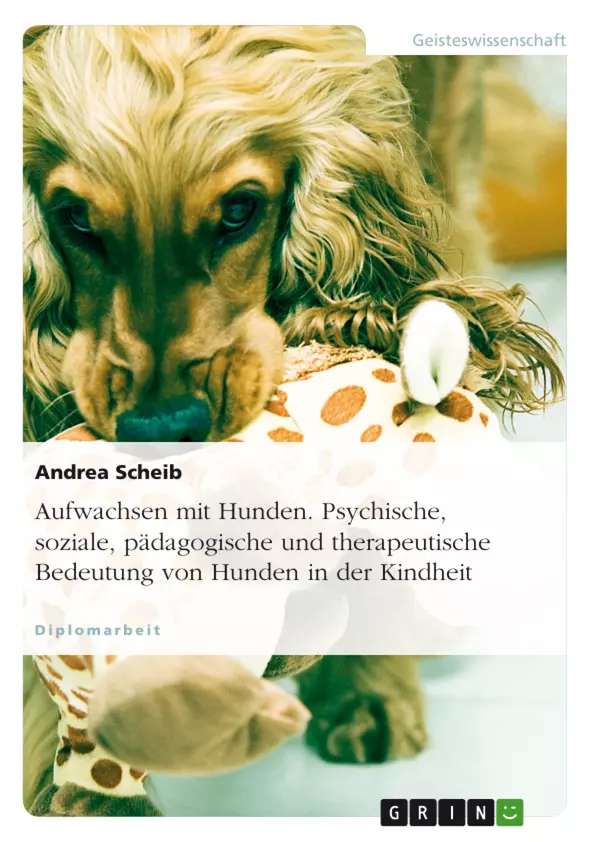Über 80 Prozent aller Hunde in Deutschland werden in Familien gehalten (vgl. IVH, o.J.).
Kinder die mit Hunden leben und aufwachsen, leben in einer anderen Umwelt als Kinder, die ohne Hund aufwachsen. Sie werden durch die Hunde geprägt und mit erzogen.
Der Hund vermag es durch seine sensible und äußerst feine Wahrnehmung, Körpersignale und Stimmungslagen der Kinder wahrzunehmen. Er vermag es auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von den verschiedensten Kindern zu reagieren. Dabei kann der Hund für die Kinder eine jeweils andere Bedeutung haben und diese Bedeutung kann für die Kinder einen unterschiedlichen Stellenwert einnehmen.
Hunde begleiten die Entwicklung von Kindern schon von klein auf. Ihr erster Kontakt zum Hund, findet oft in Form von Kuscheltieren statt. Hunde kommen in Märchen und Geschichten vor und sie werden in Zeichentrickfilmen zum Helden der Kinder (vgl. Greiffenhagen, 1991). Kinder verbinden daher schon in ihrer frühesten Kindheit positive Erfahrungen mit Hunden.
Hunde ziehen Kinder fast magisch an. Auch Boehm stellte dies 1992 fest: „Was ich für wichtig halte: das vertrauensvolle Umgehen mit Tieren und Natur. Ich glaube nicht, dass irgendwelche besonderen Ideen nötig sind, um das zu gestalten. Es ist, fernab vom eingeengten und mechanisierten Großstadtleben, einfach das, was seit Jahrtausenden Kinder in aller Welt eigentlich haben durften. Nichts weiter.... Wie die Biene die Blume findet, finden Kinder Tiere." (vgl. Bull, o.J.) Vermutlich weil sie sich in ihrem Verhalten so ähnlich sind, wählen sie sich oft als Spielpartner. Kinder treten ihnen offen und interessiert entgegen, da sie mit den Hunden oft positive Erlebnisse verbinden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffserklärungen
- 2.1. Kindheit
- 2.1.1. Zeitliche Definition
- 2.1.2. Biologische Definition
- 2.1.3. Juristische Definition
- 2.1.4. Religiöse Definition
- 2.2. Heimtier
- 2.3. Haustier
- 2.1. Kindheit
- 3. Die Mensch – Hund – Beziehung in der Geschichte
- 3.1. Hunde von der Antike bis zur Neuzeit
- 3.1.1. Das Altertum
- 3.1.2. Das Mittelalter
- 3.1.3. Die Neuzeit
- 3.2. Hunde in der Gegenwart
- 3.3. Entwicklung der tiergestützten Pädagogik bzw. Therapie
- 3.1. Hunde von der Antike bis zur Neuzeit
- 4. Veränderte Lebenswelten moderner Kindheit
- 4.1. Wandel der Lebensbedingungen von Kindern
- 4.2. Veränderte Frauenrolle
- 4.3. Anstieg der Scheidungszahlen
- 4.4. Infantilisierung der Armut
- 4.5. Therapiebedürftigkeit der Kinder
- 5. Das Kind aus der Sicht des Hundes
- 6. Probleme in der Kind - Hund Beziehung
- 6.1. Unfallgefahr
- 6.2. Gesundheitliche Risiken
- 6.2.1. Zoonosen
- 6.2.2. Allergien
- 6.3. Angst vor Hunden
- 6.4. Rechtliche Rahmenbedingungen
- 6.5. Der Hund als Konkurrent
- 6.6. Neuer Missbrauch der Hunde?
- 7. Bedeutung von Hunden in der Kindheit
- 7.1. Therapeutisches und psychosoziales Wirkungsgefüge in der Kind – Hund Beziehung
- 7.1.1. Therapeutische Wirkfaktoren
- 7.1.2. Soziale Auswirkungen
- 7.1.3. Psychische Effekte der Kind – Hund - Beziehung
- 7.1.4. Pädagogische Auswirkungen
- 7.2. Verhältnis zum Hund in den einzelnen kindlichen Altersgruppen
- 7.2.1. Säuglinge und Kleinkinder (0 – 6 Jahre)
- 7.2.2. Schulkinder (6 - 12 Jahre)
- 7.2.3. Vorpubertät (12 – 14 Jahre)
- 7.3. Die Bedeutung des Hundes für Kinder in unterschiedlichen Lebenssituationen
- 7.3.1. Einzelkinder
- 7.3.2. Behinderte Kinder
- 7.3.3. Scheidungskinder und Kinder von Alleinerziehenden
- 7.3.4. Verhaltensauffällige Kinder
- 7.1. Therapeutisches und psychosoziales Wirkungsgefüge in der Kind – Hund Beziehung
- 8. Methodik
- 8.1. Auswahl geeigneter Datenerhebungsmethoden
- 8.1.1. Die Fragebogenuntersuchung
- 8.1.1.1. Fragebogengestaltung
- 8.1.1.2. Stichprobe
- 8.1.2. Online - Erhebung im World Wide Web
- 8.1.2.1. Vorgehensweise
- 8.1.2.2. Stichprobe
- 8.1.2.3. Vorteile und Nachteile der Online - Erhebung
- 8.1.1. Die Fragebogenuntersuchung
- 8.2. Das Begleitschreiben
- 8.3. Der Pretest
- 8.1. Auswahl geeigneter Datenerhebungsmethoden
- 9. Ergebnisse
- 9.1. Die Rücklaufquote
- 9.2. Statistische Daten
- 9.2.1. Wie alt warst du als der Hund zu Euch kam?
- 9.2.2. Wie lange hast Du den Hund?
- 9.3. Die Variablen im Einzelnen
- 10. Diskussion der Ergebnisse
- 10.1. Einfluss des Hundes auf die Entwicklung der Kinder
- 10.2. Gesprächspartner und Gesprächsstoff
- 10.3. Übernahme von Verpflichtungen in der Hundehaltung
- 10.4. Konfliktbewältigung durch den Hund
- 10.5. Die Kind – Hund Beziehung im Vergleich von Land- und Stadtkindern
- 11. Projekte im Bereich der Kind - Hund Beziehung
- 11.1. Hundgestützte Ergotherapie
- 11.1.1. Durchführung
- 11.1. Hundgestützte Ergotherapie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Bedeutung von Hunden in der Kindheit aus psychischer, sozialer, pädagogischer und therapeutischer Perspektive. Es wird der Einfluss des Hundes auf die kindliche Entwicklung, die Gestaltung sozialer Beziehungen und die Bewältigung von Problemen beleuchtet.
- Der Einfluss von Hunden auf die psychosoziale Entwicklung von Kindern
- Die Rolle von Hunden in der Therapie und Pädagogik
- Herausforderungen und Probleme in der Mensch-Hund-Beziehung im Kindesalter
- Die Bedeutung von Hunden für Kinder in verschiedenen Lebenssituationen
- Methodische Ansätze zur Erforschung der Kind-Hund-Beziehung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und skizziert die Relevanz der Mensch-Hund-Beziehung im Kindesalter. Sie benennt die Forschungsfragen und die Methodik der Untersuchung.
2. Begriffserklärungen: Dieses Kapitel klärt zentrale Begriffe wie Kindheit (zeitlich, biologisch, juristisch, religiös), Heimtier und Haustier, um eine gemeinsame Basis für die weitere Analyse zu schaffen. Die unterschiedlichen Definitionen von Kindheit verdeutlichen die Komplexität des Themas und die verschiedenen Perspektiven, die in Betracht gezogen werden müssen.
3. Die Mensch – Hund – Beziehung in der Geschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Mensch-Hund-Beziehung, beginnend mit dem Altertum, über das Mittelalter bis in die Neuzeit. Es zeichnet den Wandel der Rolle des Hundes in der Gesellschaft nach und zeigt den zunehmenden Einfluss des Tieres auf die menschliche Kultur und Sozialisation. Die Entwicklung der tiergestützten Pädagogik und Therapie wird im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen erläutert.
4. Veränderte Lebenswelten moderner Kindheit: Dieses Kapitel beschreibt den Wandel der Lebensbedingungen moderner Kinder, inklusive veränderter Familienstrukturen, steigender Scheidungsraten und der daraus resultierenden Herausforderungen für Kinder. Der soziale und psychische Druck auf Kinder wird analysiert und die Bedeutung von stabilen sozialen Beziehungen hervorgehoben, in deren Kontext auch die Rolle eines Familienhundes betrachtet wird.
5. Das Kind aus der Sicht des Hundes: Dieses Kapitel beleuchtet die Perspektive des Hundes auf die Interaktion mit dem Kind. Es betrachtet das Verhalten und die Bedürfnisse des Hundes im Umgang mit Kindern und wie diese verstanden und berücksichtigt werden müssen. Die Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der wechselseitigen Interaktion und für den ethischen Umgang mit Tieren.
6. Probleme in der Kind - Hund Beziehung: Dieses Kapitel analysiert die potenziellen Gefahren und Risiken, die mit der Beziehung zwischen Kind und Hund verbunden sind, wie Unfälle, gesundheitliche Probleme (Zoonosen, Allergien), Angst vor Hunden, sowie rechtliche Aspekte und die Problematik des Hundes als Konkurrent um die Aufmerksamkeit. Es dient dazu, mögliche Herausforderungen und Vorsichtsmaßnahmen zu beleuchten, um einen sicheren Umgang zu gewährleisten.
7. Bedeutung von Hunden in der Kindheit: Dieses Kapitel stellt den Kern der Arbeit dar und beleuchtet die positiven Auswirkungen der Mensch-Hund-Beziehung auf die Entwicklung des Kindes. Es analysiert therapeutische, soziale und pädagogische Aspekte und zeigt die vielschichtigen Möglichkeiten des Hundes als Therapiebegleiter, Sozialisationsfaktor und Lernpartner. Die positive Wirkung auf die emotionale, psychische und körperliche Entwicklung wird anhand verschiedener Beispiele differenziert dargestellt.
8. Methodik: Das Kapitel beschreibt die Methodik der Studie, die Datenerhebungsmethoden und die Auswahl der Stichprobe. Die Vorgehensweise bei der Fragebogenuntersuchung und der Online-Erhebung wird detailliert dargestellt. Diese Transparenz ist essentiell für die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Kindheit, Hund, Mensch-Tier-Beziehung, tiergestützte Therapie, tiergestützte Pädagogik, psychosoziale Entwicklung, soziale Integration, Gesundheit, Risiken, Prävention, Empirie, Fragebogenstudie.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Die Bedeutung von Hunden in der Kindheit
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht umfassend die Bedeutung von Hunden in der Kindheit. Sie betrachtet den Einfluss von Hunden auf die psychische, soziale, pädagogische und therapeutische Entwicklung von Kindern aus verschiedenen Perspektiven.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die historische Entwicklung der Mensch-Hund-Beziehung, die veränderten Lebenswelten moderner Kinder, potentielle Probleme und Risiken der Kind-Hund-Beziehung (Unfälle, Krankheiten, Allergien), die positiven Auswirkungen von Hunden auf die kindliche Entwicklung (therapeutische, soziale und pädagogische Aspekte), und die methodischen Ansätze der durchgeführten Studie.
Welche Begrifflichkeiten werden im Detail erklärt?
Die Arbeit klärt zentrale Begriffe wie Kindheit (zeitliche, biologische, juristische und religiöse Definitionen), Heimtier und Haustier, um eine gemeinsame Basis für die Analyse zu schaffen.
Wie wird die historische Entwicklung der Mensch-Hund-Beziehung dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der Mensch-Hund-Beziehung von der Antike über das Mittelalter bis in die Gegenwart und zeigt den Wandel der Rolle des Hundes in der Gesellschaft und den Einfluss des Tieres auf die menschliche Sozialisation.
Welche Veränderungen in den Lebenswelten moderner Kinder werden berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert den Wandel der Lebensbedingungen moderner Kinder, einschließlich veränderter Familienstrukturen (z.B. steigende Scheidungsraten), die veränderte Frauenrolle, die Infantilisierung der Armut und die daraus resultierenden Herausforderungen für Kinder.
Welche Probleme und Risiken in der Kind-Hund-Beziehung werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert potenzielle Gefahren und Risiken wie Unfälle, gesundheitliche Probleme (Zoonosen, Allergien), Angst vor Hunden, rechtliche Aspekte und den Hund als möglichen Konkurrenten um die Aufmerksamkeit.
Welche positiven Auswirkungen von Hunden auf Kinder werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die positiven Auswirkungen der Mensch-Hund-Beziehung auf die Entwicklung des Kindes, einschließlich therapeutischer, sozialer und pädagogischer Aspekte. Der Hund wird als Therapiebegleiter, Sozialisationsfaktor und Lernpartner betrachtet.
Welche Methodik wurde für die Studie angewendet?
Die Studie verwendet Fragebogenuntersuchungen und Online-Erhebungen im World Wide Web. Die Vorgehensweise bei der Datenerhebung, die Fragebogengestaltung und die Auswahl der Stichprobe werden detailliert dargestellt.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Studie, einschließlich der Rücklaufquote, statistischer Daten (z.B. Alter des Kindes bei Aufnahme des Hundes, Haltedauer des Hundes) und einer detaillierten Analyse der erhobenen Variablen.
Wie werden die Ergebnisse diskutiert?
Die Diskussion der Ergebnisse konzentriert sich auf den Einfluss des Hundes auf die kindliche Entwicklung, die Rolle des Hundes als Gesprächspartner und -stoff, die Übernahme von Verpflichtungen in der Hundehaltung, Konfliktbewältigung durch den Hund und den Vergleich der Kind-Hund-Beziehung bei Land- und Stadtkindern.
Welche Projekte im Bereich der Kind-Hund-Beziehung werden erwähnt?
Die Arbeit erwähnt Projekte wie die hundgestützte Ergotherapie.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Kindheit, Hund, Mensch-Tier-Beziehung, tiergestützte Therapie, tiergestützte Pädagogik, psychosoziale Entwicklung, soziale Integration, Gesundheit, Risiken, Prävention, Empirie, Fragebogenstudie.
- Quote paper
- Andrea Scheib (Author), 2005, Aufwachsen mit Hunden. Psychische, soziale, pädagogische und therapeutische Bedeutung von Hunden in der Kindheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37891