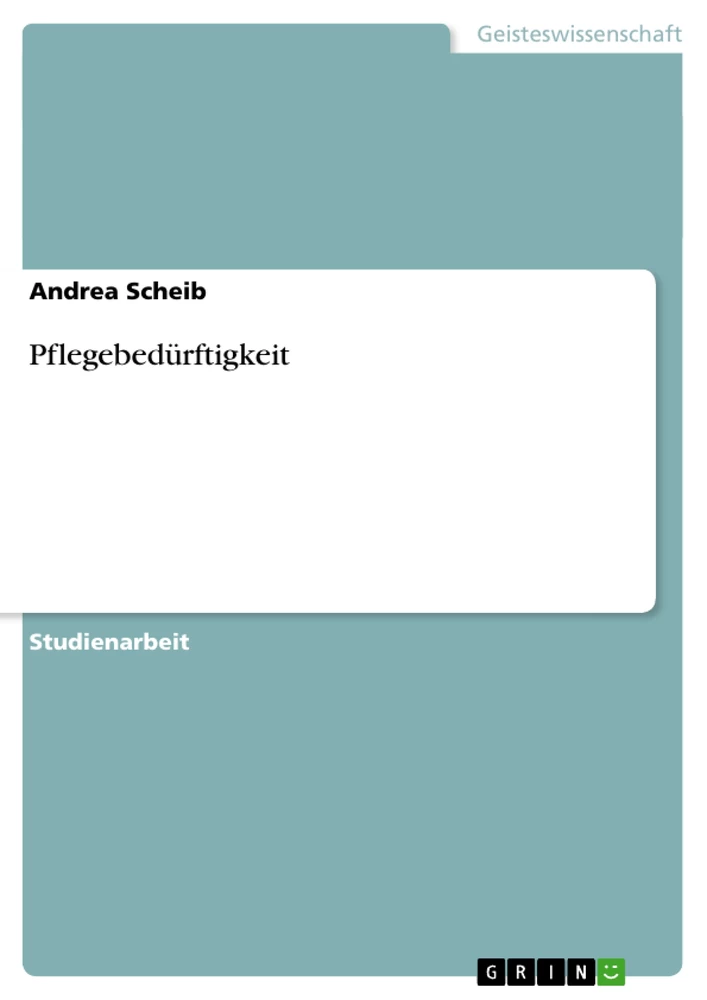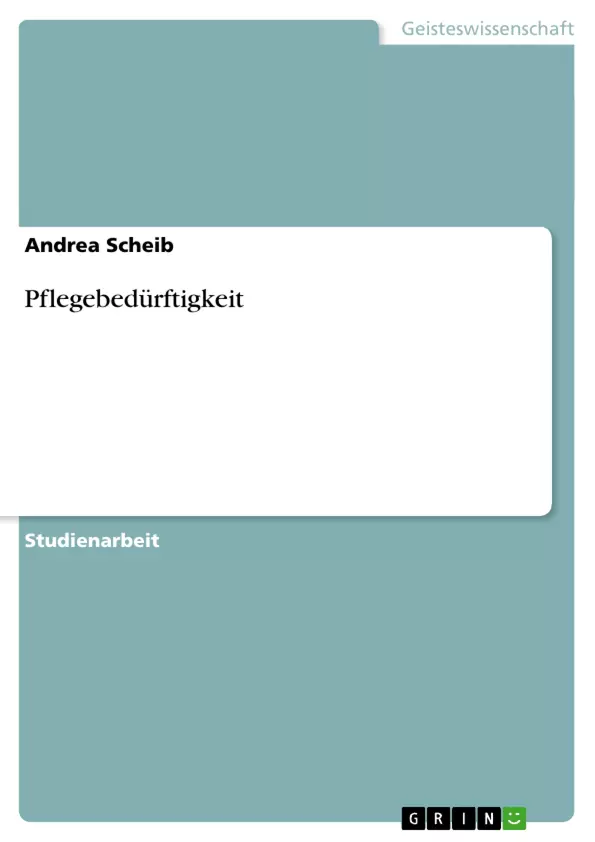Mit dem Begriff „Pflegebedürftigkeit“ ist das ständige Angewiesensein auf die persönliche Hilfe anderer bei den gewöhnlichen Verrichtungen des täglichen Lebens gemeint.
Pflegebedürftigkeit ist jedoch von Krankheit und Behinderung zu unterscheiden.
Nicht jeder Kranke oder Behinderte ist pflegebedürftig, aber jeder Pflegebedürftige ist entweder krank oder behindert.
Da es nicht immer leicht ist Pflegebedürftigkeit von Behandlungsbedürftigkeit zu unterscheiden, gibt es oft Probleme bei der Zuständigkeit der Kostenfrage, ob Krankenkasse oder Pflegekasse.
Die häufigsten Erkrankungen die zur Pflegebedürftigkeit führen, sind neben Frakturen und Amputationen auch Hirngefäßerkrankungen, schwere rheumatische Erkrankungen, psychische Erkrankungen sowie Beeinträchtigungen der Sinnesorgane.
Die Hauptmerkmale von Pflegebedürftigen sind auf jeden Fall die Mobilitätseinschränkung, durch die alltägliche Verrichtungen nicht mehr möglich sind, und psychische Beeinträchtigungen.
Der Grad der Pflegebedürftigkeit wird durch drei Stufen bestimmt, die jeweils unterschiedliche Leistungen nach sich ziehen:
- Pflegestufe1 (erhebliche Pflegebedürftige): Zeitaufwand muss 90 Minuten betragen
- Pflegestufe2 (Schwerpflegebedürftige): Zeitaufwand muss 3 Stunden betragen
- Pflegestufe3 (Schwerstpflegebedürftige): Zeitaufwand muss 5 Stunden betragen.
Inhaltsverzeichnis
1. Abgrenzung des Begriffes „Pflegebedürftigkeit“
2. Anzahl und Struktur der Pflegebedürftigen in Deutschland
3. Beeinträchtigungsprofile
4. Die Absicherung des Pflegerisikos durch die Pflegeversicherung
4.1. Ziele, versicherte Personen, Organisation und Träger
4.2. Die Leistungen der Pflegeversicherung im Überblick
4.3. Die Leistungen der Pflegeversicherung bei häuslicher und stationärer Pflege
4.4. Steuerungsinstrumente, Qualitätssicherung und Finanzierung
5. Versorgungssituation
5.1. Familiäre Pflege und Betreuung
5.2. Inanspruchnahme professioneller Pflege- und Versorgungs- leistungen
6. Gewalt an Pflegebedürftigen
6.1. Bonner Initiative gegen Gewalt im Alter
6.2. Wer sind die „Opfer“?
6.3. Wer sind die „Täter“?
7. Literaturverzeichnis
1. Abgrenzung des Begriffes „Pflegebedürftigkeit“
Mit dem Begriff „Pflegebedürftigkeit“ ist das ständige Angewiesensein auf die persönliche Hilfe anderer bei den gewöhnlichen Verrichtungen des täglichen Lebens gemeint.
Pflegebedürftigkeit ist jedoch von Krankheit und Behinderung zu unterscheiden.
Nicht jeder Kranke oder Behinderte ist pflegebedürftig, aber jeder Pflegebedürftige ist entweder krank oder behindert.[1]
Da es nicht immer leicht ist Pflegebedürftigkeit von Behandlungsbedürftigkeit zu unterscheiden, gibt es oft Probleme bei der Zuständigkeit der Kostenfrage, ob Krankenkasse oder Pflegekasse.
Die häufigsten Erkrankungen die zur Pflegebedürftigkeit führen, sind neben Frakturen und Amputationen auch Hirngefäßerkrankungen, schwere rheumatische Erkrankungen, psychische Erkrankungen sowie Beeinträchtigungen der Sinnesorgane.
Die Hauptmerkmale von Pflegebedürftigen sind auf jeden Fall die Mobilitätseinschränkung, durch die alltägliche Verrichtungen nicht mehr möglich sind, und psychische Beeinträchtigungen.
Der Grad der Pflegebedürftigkeit wird durch drei Stufen bestimmt, die jeweils unterschiedliche Leistungen nach sich ziehen:
- Pflegestufe1 (erhebliche Pflegebedürftige): Zeitaufwand muss 90 Minuten betragen
- Pflegestufe2 (Schwerpflegebedürftige): Zeitaufwand muss 3 Stunden betragen
- Pflegestufe3 (Schwerstpflegebedürftige): Zeitaufwand muss 5 Stunden betragen.[2]
2. Anzahl und Struktur der Pflegebedürftigen in Deutschland
Um Leistungen der Pflegeversicherung zu erhalten, muss eine Begutachtung vom medizinischen Dienst der Krankenkassen durchgeführt werden.
Der medizinische Dienst stellt den Pflegebedarf durch ein standardisiertes Verfahren fest.
Vorraussetzung ist, dass aufgrund von Einschränkungen ein Hilfe- und Pflegebedarf von mindestens 90 Minuten täglich vorliegt.
Nach den Ergebnissen einer Repräsentativerhebung erhielten im Jahr 2002 in Deutschland knapp 1,4 Mio. in Privathaushalten wohnende Personen Leistungen aus der Pflegeversicherung.[3]
Davon gehören 11 % der Pflegebedürftigen der Pflegestufe 3 an, 33 % der Pflegestufe 2 und 56 % der Pflegestufe 1.
93% der Pflegebedürftigen sind „gesetzlich“(AOK, Ersatzkasse) pflegeversichert und erhalten Leistungen der sozialen Pflegeversicherung. Die übrigen 7% gehören einer Privaten Pflegeversicherung an.
Etwa 64 % der Pflegebedürftigen sind weiblich, was wahrscheinlich daran liegt, dass Frauen eine höhere Lebenserwartung haben als Männer.
45 % der Pflegebedürftigen in Privathaushalten sind über 80 Jahre alt und immerhin 21 % der Pflegebedürftigen sind jünger als 60 Jahre (siehe Tabelle 2.2.).
Das Durchschnittsalter bei dem man Pflegebedürftig wird liegt laut Statistik bei etwa 70 Jahren.
Daher kann man sagen, dass Pflegebedürftigkeit als Risiko bei alten Menschen in Erscheinung tritt.
Wie man aus der Tabelle 2.2 erkennen kann, ist die Mehrheit (43 %) schon verwitwet, 30 % sind noch verheiratet, 6 % sind geschieden und 19 % sind ledig.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Beeinträchtigungsprofile
Die meisten Pflegebedürftigen haben große Beeinträchtigungen im körperlichen Bereich.
Diese Personen benötigen Hilfe bei der täglichen Hygiene, im Bereich der Mobilität oder bei der Ernährung.
Zu dem Bereich der hauswirtschaftlich - instrumentellen Einschränkungen gehören alltägliche Tätigkeiten, wie Einkaufen, die Wohnung saubermachen, Mahlzeiten zubereiten und sich um die Finanzen kümmern.
Vier von fünf Pflegebedürftigen der Pflegestufen 2 und 3 können alleine nicht einkaufen oder
die Wohnung saubermachen.
83% der Stufe 3 und 66% der Stufe 2 können sich alleine unmöglich Mahlzeiten zubereiten.[4]
Mit einem Test namens 6CIT (Brooke/Bullock 1999) wollte man kognitive Beeinträchtigungen im Bereich des Gedächtnisses und der Orientierung nachweisen lassen.
Das Ergebnis zeigt, dass 48 % der Pflegebedürftigen in Privathaushalten kognitive Beeinträchtigungen aufweisen, die auf eine beginnende oder bereits ausgeprägte demenzielle
Erkrankung hinweisen.[5]
Aufgrund kognitiver Beeinträchtigungen lässt sich vermuten, dass die damit auftretenden psychischen Störungen erheblich sein dürften.
31 % der Pflegebedürftigen die kognitive Beeinträchtigungen haben, können tagsüber unmöglich mehrere Stunden alleine in ihrer Wohnung bleiben.
35% können alleine nicht telefonieren, 56 % können sich außerhalb der Wohnung alleine
nicht mehr zurechtfinden und 67% können ihre Finanzen nicht mehr regeln.
Diese Gruppe von Personen, hat neben der Hilfe bei alltäglichen Aktivitäten ebenfalls einen Betreuungs- und Aufsichtsbedarf.
4. Die Absicherung des Pflegerisikos durch die Pflegeversicherung
4.1 Ziele, versicherte Personen, Organisation und Träger
Im Falle einer Pflegebedürftigkeit muss geklärt werden, welcher Träger für die Kostenübernahme aufkommen muss.
Folgende Träger können zuständig sein:
- Gesetzliche Pflegeversicherung
- Private Pflegeversicherung
- Beihilfe
- Gesetzliche Unfallversicherung
Werden die Leistungen nicht vollständig vom Träger übernommen, müssen die restlichen Kosten vom Betroffenen oder dessen Angehörige selbst getragen werden.
[...]
[1] vgl. G. Bäcker, Sozialpolitik und Soziale Lage in Deutschland, Kap. 7, S.93
[2] vgl. G. Bäcker, a.a.o, Kap. 7, S.93
[3] http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung3/Pdf-Anlagen/hilfe-und-pflegebeduerftige-in-privathaushalten.pdf, S.7
[4] http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung3/Pdf-Anlagen/hilfe-und-pflegebeduerftige-in-privathaushalten.pdf, S.13
[5] vgl. http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung3/Pdf-Anlagen/hilfe-und-pflegebeduerftige-in-privathaushalten.pdf, S.15
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Krankheit und Pflegebedürftigkeit?
Nicht jeder Kranke ist pflegebedürftig. Pflegebedürftigkeit bedeutet das ständige Angewiesensein auf Hilfe bei gewöhnlichen Verrichtungen des täglichen Lebens.
Welche Pflegestufen gibt es (nach altem Recht)?
Pflegestufe 1 (erheblich), Stufe 2 (Schwerpflegebedürftig) und Stufe 3 (Schwerstpflegebedürftig), wobei der tägliche Zeitaufwand für die Hilfe entscheidend ist.
Welche Krankheiten führen am häufigsten zur Pflegebedürftigkeit?
Dazu zählen Hirngefäßerkrankungen, Demenz, schwere rheumatische Leiden, Frakturen sowie psychische Erkrankungen.
Wer trägt die Kosten für die Pflege in Deutschland?
Kosten können von der gesetzlichen oder privaten Pflegeversicherung, der Beihilfe oder der Unfallversicherung übernommen werden; oft verbleibt jedoch ein Eigenanteil.
Wie wird der Pflegebedarf festgestellt?
Durch eine Begutachtung des Medizinischen Dienstes (MD), der die Einschränkungen in der Mobilität, Hygiene und kognitiven Fähigkeiten bewertet.
- Quote paper
- Andrea Scheib (Author), 2004, Pflegebedürftigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37893