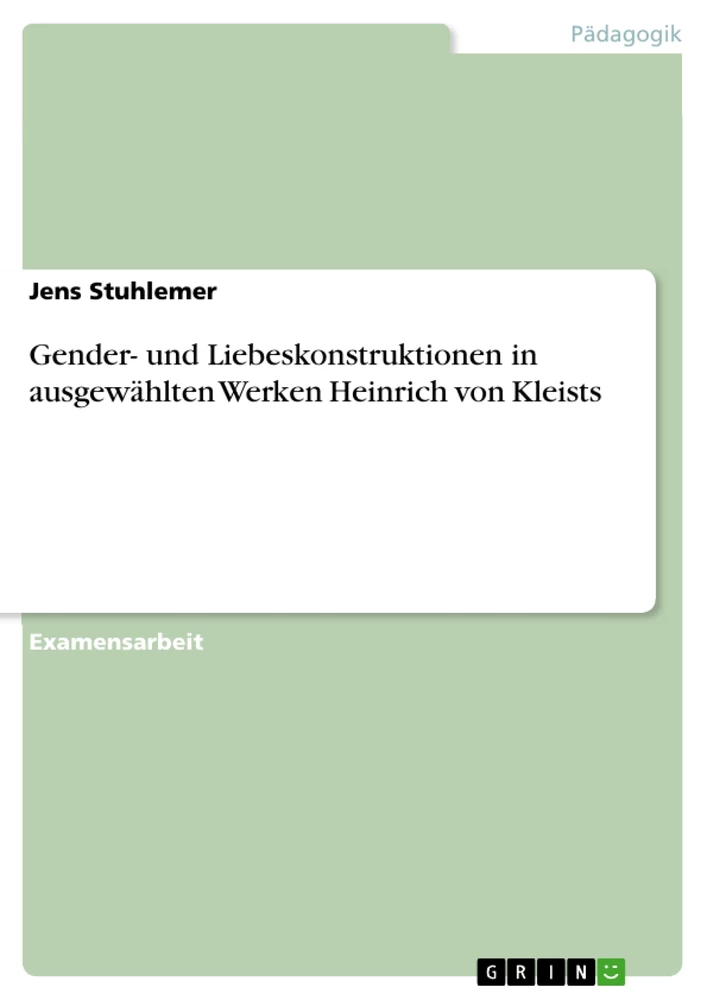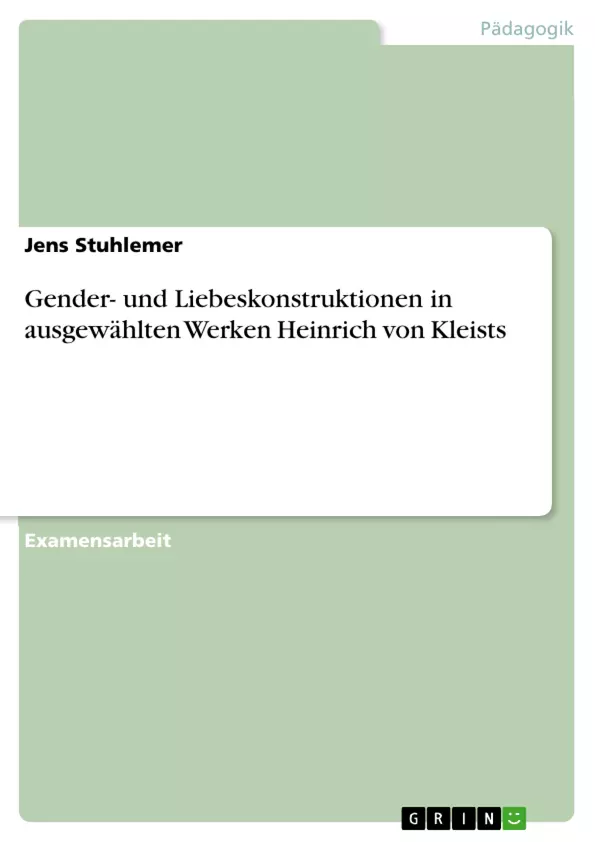Die folgende Arbeit wird ausgewählte Werke Kleists - Penthesilea, Das Käthchen von Heilbronn, Die Verlobung in St. Domingo, Die Marquise von O…. sowie in Teilen Michael Kohlhaas - in Zusammenhang mit den um 1800 vorherrschenden Geschlechter- und Liebeskonzeptionen setzen. Anhand einer detaillierten Analyse dieser Konzeptionen werden anschließend die Geschlechter- und Liebesverhältnisse Kleistscher Frauen und Männer aufgeschlüsselt. Im Ergebnis soll dabei gezeigt werden, dass Kleists männlichen Protagnisten, in den oben genannten Werken, den romantischen Gender- und Liebeskonzeption, speziell in Bezug auf Fichtes und Kants Philosophien, stark entsprechen. Kleists weibliche Figuren stehen den Geschlechts- und Liebessystematiken um 1800 jedoch sowohl entgegen als dass sie ihnen entsprechen. In wie weit sich diesbezüglich ein literarisches Muster erkennen lässt, gilt es aufzuzeigen. Gleichzeitig wird immer wieder versucht werden, Schnittpunkte zwischen Kleists biographischem Hintergrund und seinen literarischen Gender- und Liebessemantiken herzustellen.
Grundlegend ist die Arbeit in drei Abschnitte aufgeteilt: Einer biographischen Darstellung von Kleists Lebensweg, seinem Wesen, seinen Freund- bzw. Liebschaften sowie gesamtgesellschaftlicher Hintergründe folgt zunächst die Analyse genderspezifischer Merkmale in den genannten Werken. Schließlich wird sich dem Themenfeld Liebe speziell anhand der Texte Die Verlobung in St. Domingo und Penthesilea genähert. Es wird sich zeigen, dass die untersuchten Kleistschen Liebesmodelle nicht nur zahlreiche Ähnlichkeiten aufweisen, sondern auch fest mit den ihnen zugrunde liegenden Genderkonzeptionen verbunden sind. Desweiteren wird sich in Teilen erkennen lassen, welchen Einfluss Kleists biographische wie soziokulturelle Hintergründe („das Echte“) auf seine Gender- und Liebessemantiken („das Eingebildete“) hatten oder gehabt haben könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit
- Der Getriebene: Heinrich von Kleists Leben in kurzen Zügen
- Kleists Männer
- Kleists Frauen
- Der sorgende Bruder: Ulrike von Kleist
- Das Experiment mit der Männlichkeit: Wilhelmine von Zenge
- Die Vertrauliche: Andolphine von Werdeck
- Die angepasste Seherin: Marie von Kleist
- Die tödliche Zweckbeziehung: Henriette Vogel
- Kleists Lebensraum: Gesellschaft um 1800
- Auf dem Weg in die Moderne
- Im Patriarchat gefangen
- Gegensätzliche Geschlechter: Gendering um 1800
- Das Fichtsche/Kantsche Unterwerfungssystem
- Kleistsche Frauen: Aktive Unterwerfungen
- Systemverkehrung in Penthesilea
- Aktive Unterwerfungen in Das Käthchen von Heilbronn und Die Verlobung in St. Domingo
- Kleistsche Frauen: Das schöne Geschlecht
- Kleistsche Männer: Überlegenheit verinnerlicht
- Kleistsche Männer: Weibliche Ohnmacht verinnerlicht
- Liebeskonzeptionen um 1800
- Toni und Gustav: Unaussprechliche Liebeskonventionen
- Penthesilea und Achill
- Die Versteinerte Narzisstin
- Der Konventionelle Narzisst
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit ausgewählten Werken Heinrich von Kleists, wie "Penthesilea", "Das Käthchen von Heilbronn", "Die Verlobung in St. Domingo" und "Die Marquise von O.", und setzt sie in Beziehung zu den vorherrschenden Geschlechter- und Liebeskonzeptionen des frühen 19. Jahrhunderts. Durch eine detaillierte Analyse dieser Konzeptionen werden die Geschlechter- und Liebesverhältnisse in Kleists Werken aufgezeigt. Ziel ist es, zu demonstrieren, dass Kleists männliche Protagonisten den romantischen Gender- und Liebeskonzeptionen, insbesondere in Bezug auf die Philosophien von Fichte und Kant, stark entsprechen. Kleists weibliche Figuren hingegen stehen diesen Geschlechts- und Liebessystematiken sowohl entgegen als auch entsprechen ihnen. Die Arbeit untersucht, ob sich in dieser Hinsicht ein literarisches Muster erkennen lässt und versucht dabei, Schnittpunkte zwischen Kleists biographischem Hintergrund und seinen literarischen Gender- und Liebessemantiken aufzuzeigen.
- Die Interaktion von Geschlechterrollen und Liebeskonzeptionen in Kleists Werken
- Die Analyse von Kleists männlichen und weiblichen Figuren im Kontext der zeitgenössischen Geschlechtervorstellungen
- Die Erforschung von Kleists literarischen Gender- und Liebessemantiken im Lichte seiner biographischen Hintergründe
- Die Untersuchung des Einflusses von Fichte und Kants Philosophien auf Kleists Werk
- Die Herausarbeitung möglicher literarischer Muster in Kleists Darstellung von Gender und Liebe
Zusammenfassung der Kapitel
- Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit: Dieses Kapitel stellt die Arbeit vor und erläutert das Forschungsinteresse, welches auf der Analyse der Geschlechter- und Liebesverhältnisse in ausgewählten Werken Kleists im Kontext der Zeit basiert. Die Arbeit will untersuchen, inwiefern Kleists Figuren den zeitgenössischen Gender- und Liebeskonzeptionen entsprechen oder ihnen widersprechen.
- Der Getriebene: Heinrich von Kleists Leben in kurzen Zügen: Dieses Kapitel bietet einen Einblick in Kleists Leben, beleuchtet seine persönlichen Erfahrungen und beschreibt seine Beziehungen zu Männern und Frauen. Die Kapitel analysieren die Beziehungen zu seinen Schwestern, Freundinnen und seinen wichtigsten männlichen Beziehungen.
- Kleists Lebensraum: Gesellschaft um 1800: Dieses Kapitel beschreibt den gesellschaftlichen Kontext, in dem Kleist lebte. Es beleuchtet den Wandel der Gesellschaft im frühen 19. Jahrhundert und untersucht die Rolle des Patriarchats und die Bedeutung von Gender-Normen.
- Gegensätzliche Geschlechter: Gendering um 1800: Dieses Kapitel untersucht die Geschlechterkonzeptionen im frühen 19. Jahrhundert, insbesondere im Hinblick auf die Philosophien von Fichte und Kant. Es analysiert die Auswirkungen dieser Konzeptionen auf die Darstellung von Frauen und Männern in Kleists Werken.
- Liebeskonzeptionen um 1800: Dieses Kapitel befasst sich mit den Liebeskonzeptionen im frühen 19. Jahrhundert. Es analysiert die Darstellung von Liebe und Beziehung in Kleists Werken, insbesondere in "Die Verlobung in St. Domingo" und "Penthesilea", im Kontext der zeitgenössischen Liebeskonzeptionen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Gender, Liebe, Literatur, Heinrich von Kleist, romantische Periode, Geschlechterverhältnisse, Fichte, Kant, Patriarchat, Liebeskonzeptionen, "Penthesilea", "Das Käthchen von Heilbronn", "Die Verlobung in St. Domingo", "Die Marquise von O.". Diese Schlüsselwörter repräsentieren die wichtigsten Themen und Konzepte, die in der Analyse der Geschlechter- und Liebesverhältnisse in Kleists Werken untersucht werden.
Häufig gestellte Fragen
Wie stellt Heinrich von Kleist Geschlechterrollen dar?
Kleists männliche Figuren entsprechen oft zeitgenössischen Idealen (Fichte/Kant), während weibliche Figuren wie Penthesilea diese Normen sowohl erfüllen als auch sprengen.
Welchen Einfluss hatte die Philosophie von Kant und Fichte auf Kleist?
Ihre Konzepte von Unterwerfung und Patriarchat bilden den Hintergrund, gegen den Kleist seine Figuren agieren lässt, oft in Form von Systemverkehrungen.
Welche Rolle spielt die Biographie Kleists in seinen Werken?
Es gibt enge Schnittpunkte zwischen Kleists realen Beziehungen (z.B. zu Wilhelmine von Zenge oder Henriette Vogel) und seinen literarischen Liebesmodellen.
Was ist das Besondere an der Liebeskonzeption in „Penthesilea“?
Die Arbeit analysiert Penthesilea und Achill als narzisstische Figuren, deren Liebe an den gesellschaftlichen Konventionen und eigenen Ansprüchen scheitert.
Welche Werke Kleists werden in der Arbeit analysiert?
Untersucht werden unter anderem „Penthesilea“, „Das Käthchen von Heilbronn“, „Die Verlobung in St. Domingo“ und „Die Marquise von O.“.
- Citation du texte
- Jens Stuhlemer (Auteur), 2016, Gender- und Liebeskonstruktionen in ausgewählten Werken Heinrich von Kleists, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/379192