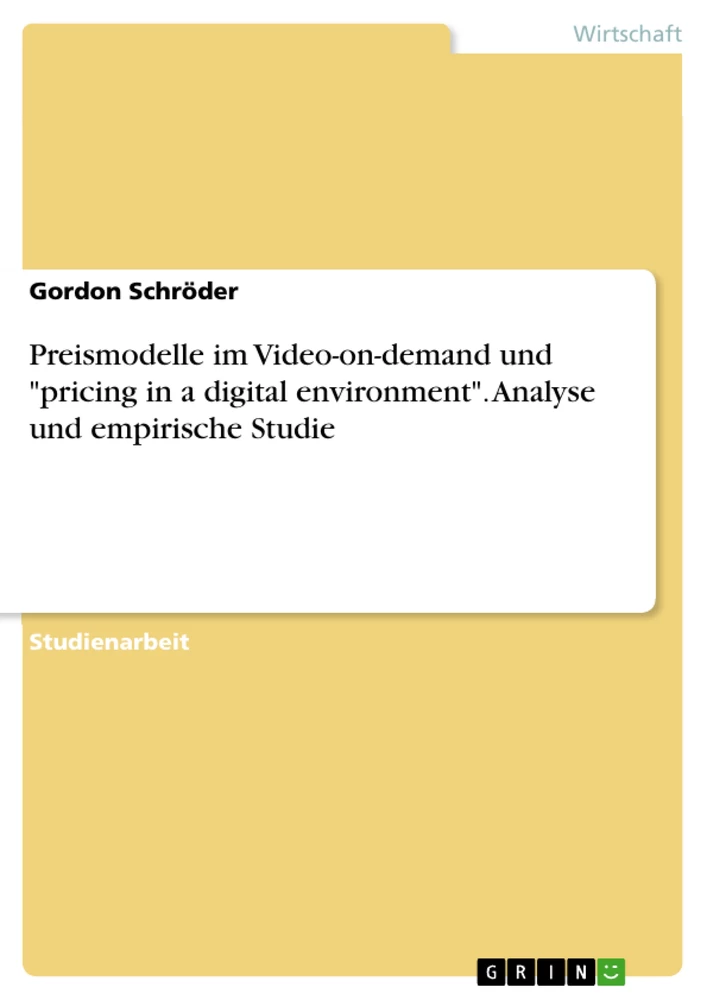Am 26.04.2017 entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, dass auch das Nutzen von illegalen Streamingdiensten eine abmahnfähige Urheberrechtsverletzung darstellt. Die rechtlichen Hemmnisse für illegales Streamen mögen mit dem Gerichtsurteil verstärkt worden sein, trotzdem herrscht weiterhin ein erbitterteres Werben um Kunden am deutschen VoD-Markt durch Dienstleister wie Netflix, Amazon, Maxdome und vielen weiteren. Neben dem Film- und Serienangebot und der Streamingqualität ist für viele (illegale) Streamer vor allen Dingen eines entscheidend: „Was kostet mich das?“.
In der vorliegenden Arbeit wird zunächst das theoretische Fundament aus den Definitionen und dem Stand der Wissenschaft zu PWYW erläutert. Daraus werden in Kapitel 3 Hypothesen abgeleitet und in ein Untersuchungsmodell hinein appliziert. Anschließend wird die dafür konzipierte Studie in Form eines Fragebogens mit integriertem Gedankenexperiment vorgestellt. Dem folgt eine Analyse und Überprüfung des Untersuchungsmodells mit anschließender Diskussion und Implikationen für Praxis und Wissenschaft.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Video-on-Demand
- 2.2 Preismodelle im Video-on-Demand
- 2.3 Stand der Wissenschaft: Pay-What-You-Want
- 3 Entwicklung des Studiendesigns
- 4 Empirische Untersuchung
- 4.1 Erhebungsmethodik
- 4.2 Gedankenexperiment
- 5 Darstellung der Untersuchungsergebnisse
- 5.1 Beschreibung der Stichprobe
- 5.2 Reliabilitätsprüfung
- 5.3 Hypothesentests
- 5.4 Zahlungsbereitschaft der Konsumenten in der Analyse
- 5.5 Varianzanalyse der Preisniveaus
- 6 Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Preisgestaltung im digitalen Umfeld, speziell im Bereich des Video-on-Demand (VoD). Ziel ist es, die Zahlungsbereitschaft von Konsumenten für VoD-Inhalte anhand eines empirischen Gedankenexperiments zu untersuchen und den Einfluss verschiedener Preisniveaus auf die Bereitschaft zur Bezahlung zu analysieren.
- Preismodelle im Video-on-Demand
- Pay-What-You-Want-Prinzip
- Empirische Untersuchung der Zahlungsbereitschaft
- Einfluss verschiedener Preisniveaus
- Analyse der Varianz der Zahlungsbereitschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema der Preisgestaltung im digitalen Umfeld einführt und die Relevanz des VoD-Marktes hervorhebt. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen, wobei verschiedene Preismodelle im VoD-Bereich vorgestellt werden, einschließlich des Standes der Wissenschaft zum Pay-What-You-Want-Prinzip. Kapitel 3 beschreibt die Entwicklung des Studiendesigns, das sich auf ein empirisches Gedankenexperiment stützt. Kapitel 4 erläutert die Erhebungsmethodik und die Durchführung des Gedankenexperiments. Kapitel 5 präsentiert die Untersuchungsergebnisse, einschließlich der Beschreibung der Stichprobe, der Reliabilitätsprüfung, der Hypothesentests und der Analyse der Zahlungsbereitschaft von Konsumenten in Abhängigkeit vom Preisniveau. Kapitel 6 diskutiert die Ergebnisse und stellt die wichtigsten Erkenntnisse der Untersuchung dar.
Schlüsselwörter
Video-on-Demand, Preismodelle, Zahlungsbereitschaft, Empirische Untersuchung, Gedankenexperiment, Preisniveaus, Varianzanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das "Pay-What-You-Want"-Prinzip (PWYW)?
Es ist ein Preismodell, bei dem der Käufer selbst entscheidet, wie viel er für eine Dienstleistung oder ein Produkt bezahlen möchte, oft sogar bis hin zu null Euro.
Wie wirkt sich das EuGH-Urteil von 2017 auf Streaming aus?
Der Europäische Gerichtshof entschied, dass auch die Nutzung illegaler Streamingdienste eine abmahnfähige Urheberrechtsverletzung darstellt, was die rechtlichen Risiken für Nutzer erhöht.
Was wurde in der empirischen Studie zum VoD-Markt untersucht?
Die Studie untersuchte die Zahlungsbereitschaft von Konsumenten für Video-on-Demand-Inhalte in Abhängigkeit von verschiedenen Preisniveaus und Modellen.
Welche Faktoren beeinflussen die Wahl eines VoD-Anbieters?
Neben dem Preis sind vor allem das Film- und Serienangebot sowie die Streamingqualität entscheidende Kriterien für die Kunden.
Warum ist Preisgestaltung im digitalen Umfeld so komplex?
Wegen der niedrigen Grenzkosten und der starken Konkurrenz durch (teils illegale) kostenlose Alternativen müssen Anbieter innovative Wege finden, um Zahlungsbereitschaft zu generieren.
- Quote paper
- Gordon Schröder (Author), 2017, Preismodelle im Video-on-demand und "pricing in a digital environment". Analyse und empirische Studie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/379258