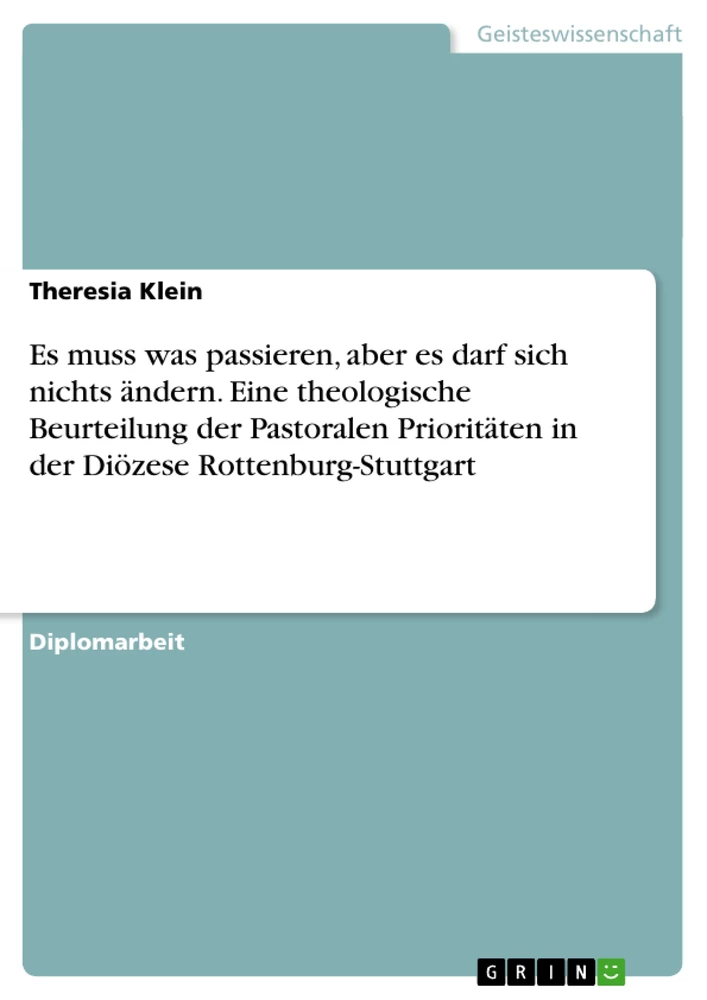Die Kirche in Deutschland steckt in einer ernsten Krise – so verkünden es zumindest die Pressemeldungen der vergangenen Monate und so ist auch die Stimmung innerhalb der Kirche treffend zu beschreiben.
Dabei steht nicht nur ihre schwindende Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit vielfach zur Debatte, auch finanzielle Probleme zwingen eine Diözese nach der anderen zu drastischen Einsparungsmaßnahmen. Vor dem Hintergrund von hohen Personalkosten, sinkenden Kirchensteuermitteln und oft jahrelanger Misswirtschaft scheint die Frage nach der Pastoral als der ureigenen Aufgabe von Kirche in der Welt sekundär. Die Kräfte der Ordinariate werden von Überlegungen zur wirtschaftlichen Lage der Kirche in Deutschland gebunden.
Auch in der Diözese Rottenburg-Stuttgart sehen sich die pastoralen wie verwaltungsrechtlichen Funktionsträger mit der Herausforderung einer „verantwortete[n] Zukunftsplanung“ konfrontiert, die es notwendig macht, „die künftigen Schwerpunkte festzulegen“ und Kriterien dafür aufzustellen, „was die Diözese (noch) leisten könne und was nicht“2. In dieser Formulierung schwingt implizit schon das Reflexivpronomen mit, welches die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten beleuchtet: „[...] was die Diözese sich (noch) leisten könne und was nicht“. Um Klarheit in die ungewisse Planung zu bringen, wurde im Jahr 2000 ein diözesanweiter Prozess zur Findung „Pastoraler Prioritäten und Posterioritäten“ angestoßen.
Als Mitglied im 7. Diözesanrat der Diözese Rottenburg-Stuttgart hatte ich die Möglichkeit, diesen Prozess der Schwerpunktfindung mitzuerleben und mitzugestalten. Nachdem die operative Ebene mit den letzten Kürzungsbeschlüssen des Diözesanrats in seiner Sitzung vom 24./25. September 2004 verlassen ist und es in der Praxis nun um die Umsetzung aller Beschlüsse und Perspektiven geht, will ich das wichtigste Zwischenergebnis des Prozesses, das Papier „Zeichen setzen in der Zeit. Pastorale Prioritäten in der Diözese Rottenburg-Stuttgart“ in theologischer Hinsicht untersuchen.
Welche impliziten und expliziten theologischen Aussagen das Papier trifft, welches Kirchenbild sich hinter einer solchen Art der Diskussion über die Zukunft von Ortskirche verbirgt, wie das Verhältnis von Verwaltung und Pastoral bestimmt wird und welche Implikationen sich aus dem Beschlusspapier ergeben, ist Thema dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- „NUR WER SICH ÄNDERT, BLEIBT SICH TREU.“
- IDENTITÄT UND VERÄNDERUNG
- VERÄNDERUNG IN SYSTEMTHEORETISCHER SICHT
- STRUKTUR, STRUKTUR
- DER PRIORITÄTEN-PROZESS UND SEIN ERGEBNISPAPIER „ZEICHEN SETZEN IN DER ZEIT“
- DIE DISKUSSION ÜBER „PASTORALE PRIORITÄTEN“
- IDE UND ZIEL
- ZEITPLAN UND DURCHFÜHRUNG
- PRIORITÄT - NORMALITÄT - POSTERIORITÄT
- „ZEICHEN SETZEN IN DER ZEIT“
- AUFBAU UND INHALT DES PAPIERS
- VON „WIR GEBEN UNSERER HOFFNUNG EIN GESICHT“ ZU „ZEICHEN SETZEN IN DER ZEIT“
- DIE THEOLOGISCHE BEURTEILUNG
- DIE THEOLOGIE DER ZEICHEN DER ZEIT
- EVANGELISIERUNG: SCHLÜSSELBEGRIFF FÜR DIE „PASTORALEN PRIORITÄTEN“
- EVANGELISIERUNG IST EIN GRUNDBEGRIFF DER PASTORAL
- DER EVANGELISIERUNGSBEGRIFF AUS EVANGELII NUNTIANDI
- EIN PARADIGMENWECHSEL
- (NEU-) EVANGELISIERUNG DURCH „PASTORALE PRIORITÄTEN“?
- „PASTORALE PRIORITÄTEN“ ALS „OPTION FÜR“
- KIRCHE UND IHRE GRUNDVOLLZÜGE
- GRUNDVOLLZÜGE VON KIRCHE IN DER THEORIE...
- Grundvollzüge oder Ämter?
- Zwei, drei oder vier Grundvollzüge? Drei Theorien
- ... UND IN DER PRAXIS
- PASTORALER ERFOLG - EINE SCHWIERIGE KATEGORIE
- IST ETWAS PASSIERT ODER HAT SICH ETWAS GEÄNDERT?
- DAS WEITERE VORGEHEN: DIE PASTORALEN POSTERIORITÄTEN
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die „Pastoralen Prioritäten“ der Diözese Rottenburg-Stuttgart und untersucht deren theologische Bedeutung. Der Fokus liegt auf der Frage, ob die „Pastoralen Prioritäten“ tatsächlich zu einer Veränderung in der Kirche führen oder lediglich einen kosmetischen Eingriff darstellen.
- Identität und Veränderung der Kirche im Kontext der aktuellen Herausforderungen.
- Theologische Relevanz des Begriffs „Evangeliisierung“ im Rahmen der „Pastoralen Prioritäten“.
- Analyse der „Pastoralen Prioritäten“ im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Praxis der Kirche.
- Beurteilung der „Pastoralen Prioritäten“ im Lichte der aktuellen Herausforderungen der Kirche.
- Bewertung des Stellenwerts von „Pastoralen Prioritäten“ in Bezug auf die Zukunft der Kirche.
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit behandelt die Thematik von Identität und Veränderung. Er beleuchtet die Bedeutung von Veränderungsprozessen für die Identität der Kirche. In diesem Kontext wird die systemtheoretische Perspektive auf Veränderung herangezogen.
Der zweite Teil befasst sich mit dem Prozess der Findung von „Pastoralen Prioritäten“ in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Dabei werden die Idee und das Ziel des Prozesses, der Zeitplan und die Durchführung sowie die Frage der Priorität, Normalität und Posteriorität beleuchtet.
Der dritte Teil der Arbeit widmet sich der theologischen Beurteilung der „Pastoralen Prioritäten“. Hier wird die Bedeutung der „Zeichen der Zeit“ für das Verständnis der aktuellen Herausforderungen der Kirche beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung des Begriffs „Evangeliisierung“ im Rahmen der „Pastoralen Prioritäten“.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den „Pastoralen Prioritäten“ der Diözese Rottenburg-Stuttgart und deren theologischer Bedeutung. Sie analysiert die Veränderungen, die Kirche im Kontext der heutigen Herausforderungen bewältigen muss. Schlüsselbegriffe sind „Evangeliisierung“, „Identität“, „Veränderung“, „Pastoral“ und „Zeichen der Zeit“.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die "Pastoralen Prioritäten" der Diözese Rottenburg-Stuttgart?
Es handelt sich um einen Prozess zur Festlegung künftiger Schwerpunkte der kirchlichen Arbeit angesichts sinkender Mittel und Personalressourcen.
Was bedeutet der Begriff "Evangelisierung" in diesem Kontext?
Evangelisierung wird als Schlüsselbegriff und Grundauftrag der Pastoral verwendet, um die Kirche in der heutigen Zeit neu auszurichten.
Welches Kirchenbild verbirgt sich hinter dem Prozess?
Die Arbeit untersucht, ob das Papier ein traditionelles oder ein neues, veränderungsbereites Kirchenbild widerspiegelt.
Was versteht man unter "Pastoralen Posterioritäten"?
Posterioritäten bezeichnen Aufgaben, die die Diözese künftig weniger gewichten oder gar nicht mehr leisten will.
Wie wird das Verhältnis von Verwaltung und Pastoral bestimmt?
Die Arbeit analysiert, inwiefern finanzielle Einsparungsmaßnahmen die eigentliche pastorale Aufgabe der Kirche dominieren.
- Quote paper
- Theresia Klein (Author), 2005, Es muss was passieren, aber es darf sich nichts ändern. Eine theologische Beurteilung der Pastoralen Prioritäten in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37931