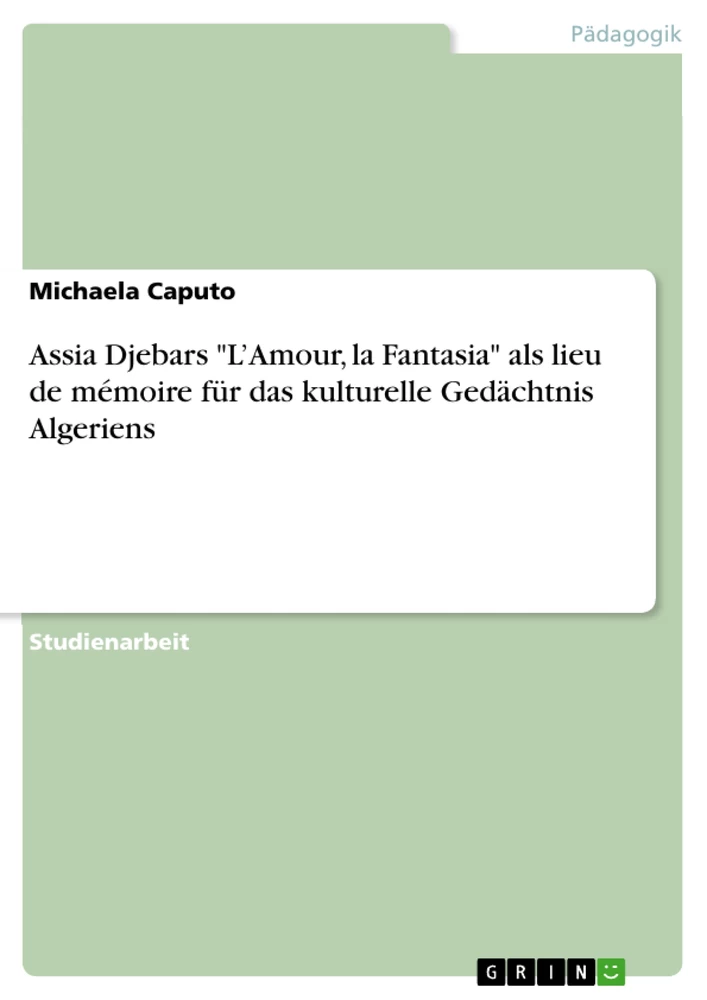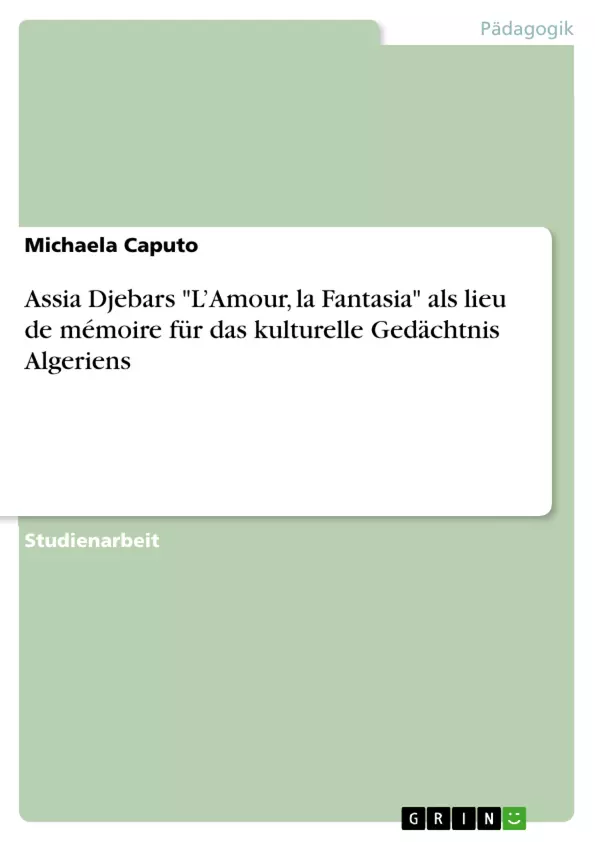Die vorliegende Arbeit wird das Konzept des kollektiven Gedächtnisses in Verbindung mit der kulturellen Identität nach Assmann skizzieren und erläutern, wie Assia Djebar im Roman "L’Amour, la Fantasia" von diesem Modell Gebrauch macht.
Als algerische Frau mit französischsprachiger akademischer Bildung kommt ihr die besondere Rolle der Vermittlerin zwischen den beiden Kulturen zu. Mit ihrem Roman überschreibt sie die französische Geschichtsschreibung mit authentischen Berichten von algerischen Frauen.
Im Folgenden soll gezeigt werden, wie Djebar auf diese Weise versucht, das kollektive Gedächtnis des algerischen Volkes nach dem Unabhängigkeitskrieg gegen die Franzosen wieder zu aktivieren und ihm damit einen wesentlichen Teil seiner Kultur zurückzugeben, wobei den arabischen Frauen eine einzigartige Funktion zukommt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte wird durch die Siegermächte geschrieben
- Vom individuellen Gedächtnis zur kollektiven Kultur
- Wie Kulturen verloren gehen
- Widerstand durch das Wort
- Eine Anwältin ohne Gerichtssaal
- Die Rolle der Frau
- Mit eigenen Waffen geschlagen
- Den Opfern eine Stimme geben
- Warum Französisch?
- Verschriftlichte Struktur des kollektiven Gedächtnisses
- Zusammenfassende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Assia Djebars Roman „L'Amour, la Fantasia“ als einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Gedächtnis Algeriens. Die Arbeit untersucht, wie Djebar durch ihre literarische Arbeit die französische Geschichtsschreibung in Frage stellt und die Erinnerung an die algerische Kultur und Identität wiederbelebt.
- Die Konstruktion des „Orients“ durch den „Occident“ und die Folgen für die algerische Kultur
- Die Rolle des kollektiven Gedächtnisses in der Bewahrung und Wiederherstellung kultureller Identität
- Die Perspektive algerischer Frauen als zentrale Akteure im kulturellen Widerstand
- Die Verwendung von literarischen Strategien zur Bewältigung der kolonialen Vergangenheit
- Die Bedeutung der Sprache als Werkzeug der kulturellen Identität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die historische Situation Algeriens im Kontext der französischen Kolonialisierung und führt das Konzept des kulturellen Gedächtnisses nach Assmann ein. Kapitel 2 beleuchtet die französische Sicht auf die Eroberung Algeriens anhand von historischen Quellen und zeigt, wie die französische Geschichtsschreibung die algerische Kultur als minderwertig darstellt. Kapitel 3 behandelt das Konzept des individuellen und kollektiven Gedächtnisses und untersucht die soziale Prägung von Erinnerung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Kolonialismus, kulturelles Gedächtnis, algerische Identität, literarische Repräsentation, weibliche Perspektive, Sprache, Widerstand und die Rolle der französischen Kultur in Algerien.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Assia Djebars Roman „L’Amour, la Fantasia“?
Der Roman verknüpft die Geschichte der französischen Eroberung Algeriens 1830 mit persönlichen Berichten algerischer Frauen und der eigenen Autobiografie der Autorin.
Was bedeutet der Begriff „lieu de mémoire“ in diesem Kontext?
Der Roman fungiert als „Erinnerungsort“, der das kollektive Gedächtnis des algerischen Volkes bewahrt und eine Gegendarstellung zur kolonialen Geschichtsschreibung bietet.
Welche Rolle spielen die Frauen im Roman?
Algerische Frauen werden als zentrale Akteurinnen des kulturellen Widerstands dargestellt; ihre authentischen Berichte geben den Opfern der Geschichte eine Stimme.
Warum schreibt Assia Djebar auf Französisch?
Djebar nutzt die Sprache der ehemaligen Kolonialmacht als Werkzeug („Waffe“), um die französische Geschichtsschreibung von innen heraus zu unterwandern und neu zu interpretieren.
Wie wird das kulturelle Gedächtnis nach Assmann in der Arbeit angewandt?
Die Arbeit nutzt Assmanns Modell, um zu zeigen, wie Djebar versucht, die durch die Kolonialisierung verloren gegangene kulturelle Identität Algeriens durch Literatur wieder zu aktivieren.
- Quote paper
- Michaela Caputo (Author), 2013, Assia Djebars "L’Amour, la Fantasia" als lieu de mémoire für das kulturelle Gedächtnis Algeriens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/379362