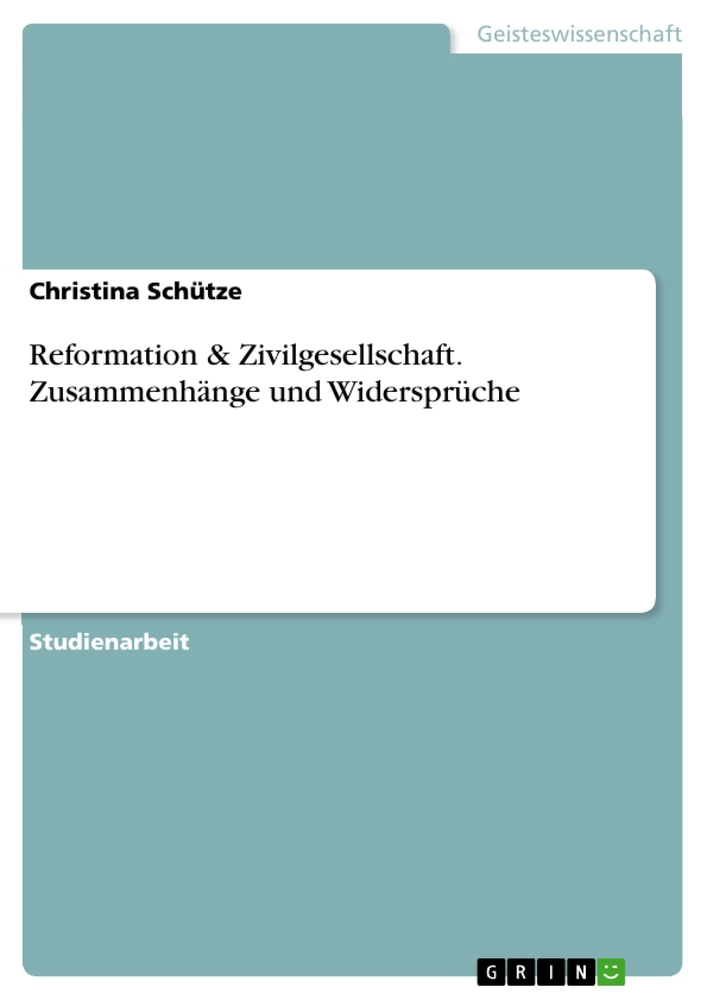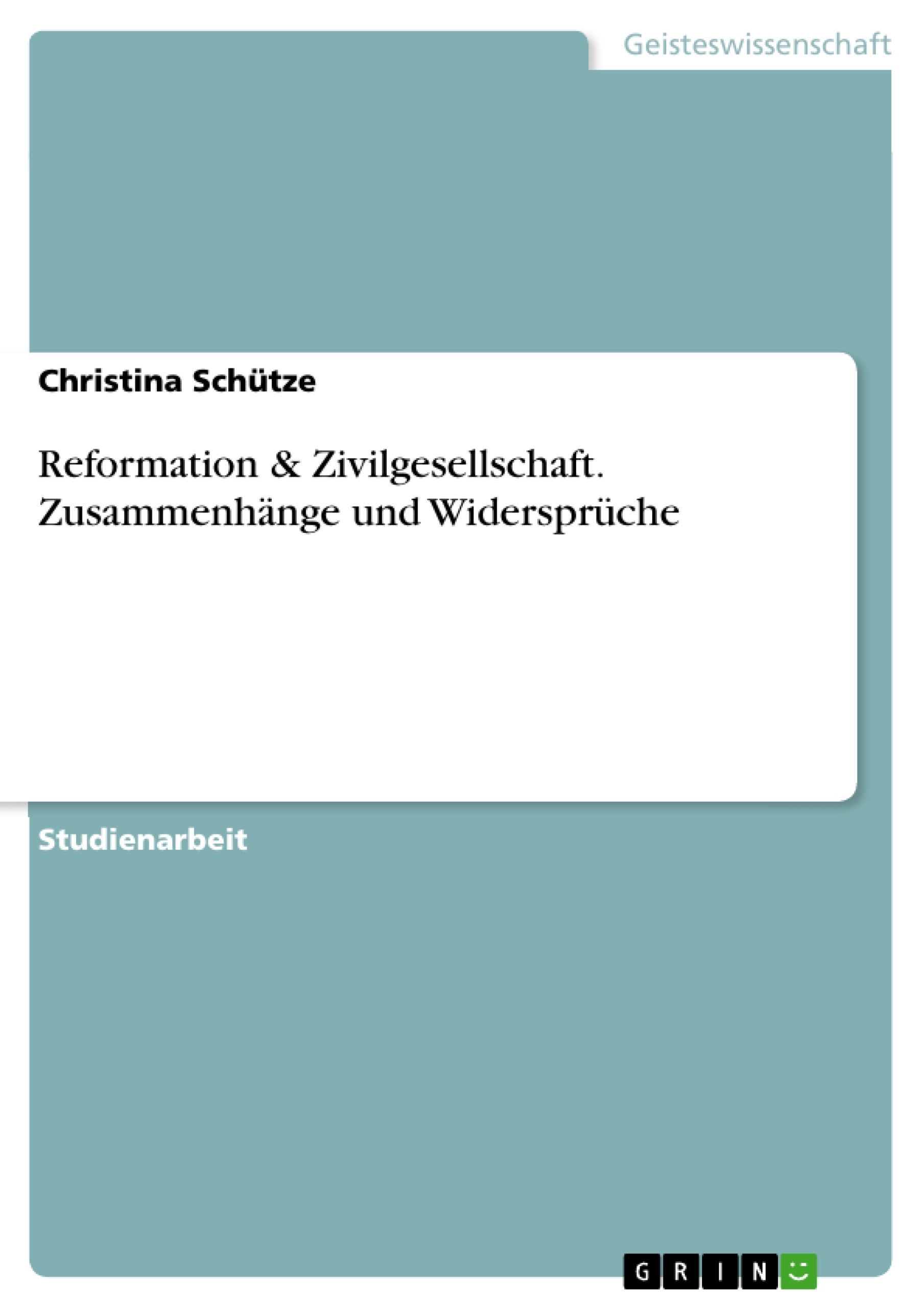Anders als etwa in den USA, in denen zivilgesellschaftliches Engagement das kirchliche Leben geradezu prägt, sind in Deutschland die evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümer (sowie die jüdischen Gemeinden) als Körperschaften des öffentlichen Rechts rein formal nicht der Zivilgesellschaft anzurechnen. Auch der Einzug der Kirchensteuer durch die staatlichen Finanzbehörden und der Treueeid auf die deutsche Verfassung, der mancherorts von Bischöfen verlangt wird, wiederspricht einem der wichtigsten Grundsätze zivilgesellschaftlicher Assoziationen: der Unabhängigkeit vom Staat.
Protestantische Kirche und Zivilgesellschaft – allein diese beiden Wörter in einem Satz regen deshalb zum Widerspruch an, meint der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates Olaf Zimmermann. Er mahnt an, dass das 500. Jubiläum der Reformation in diesem Jahr zur Reflexion über das Verhältnis von Protestantismus bzw. Evangelischer Kirche und Zivilgesellschaft motivieren sollte.
Auch wenn eine solche Reflexion nicht das Ziel dieser Arbeit ist, so beschäftigt sie sich immerhin mit dem Verhältnis der Reformation und der Zivilgesellschaft im historischen Kontext und ob die reformatorischen Forderungen mit einer modernen Zivilgesellschaft in Einklang zu bringen sind oder nicht. Bezogen wird sich dabei hauptsächlich auf Martin Luther. Seine „Zwei-Reiche-Lehre“ als auch seine Äußerungen zu Widerstand und Obrigkeit bieten für dieses Thema reichlich aussagekräftiges sowie widersprüchliches Material.
Am Anfang steht jedoch eine kurze Begriffsklärung der Zivilgesellschaft. Es folgt ein Abriss über die wirtschaftliche und soziale Situation der spätmittelalterlichen Bevölkerung, um die Ursachen der Reformation im Kontext nachvollziehbar zu machen. Kapitel 4 beschäftigt sich anschließend mit den Forderungen der Reformatoren und deren theologische Herleitung. Um über das Verhältnis Martin Luthers zur „Zivilgesellschaft“ Aussagen treffen zu können, kommt man nicht daran vorbei, sich mit seinem Verständnis von einer paternalistischen Gesellschaftsstruktur auseinander zu setzen – Kapitel 5. Im 6. Kapitel werden exemplarisch drei mögliche Impulse für die Entwicklung einer modernen Zivilgesellschaft erörtert, um im letzten Kapitel Luthers Ansichten zu reflektieren und aus einer zivilgesellschaftlichen Brille zu bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- ZIVILGESELLSCHAFT - EINE KURZE BEGRIFFSBESPRECHUNG
- DIE GESELLSCHAFTLICHEN & SOZIALEN VERHÄLTNISSE IM SPÄTMITTELALTER
- DIE REFORMATION - MOTIVATION UND FORDERUNGEN
- DIE EXKLUSIVPARTIKEL DER RECHTFERTIGUNGSLEHRE
- DER ABLASSHANDEL
- LUTHERS VERSTÄNDNIS VON WIDERSTAND UND OBRIGKEIT
- MÖGLICHE IMPULSE DER REFORMATION FÜR DIE ZIVILGESELLSCHAFT
- BILDUNGSTEILHABE & BILDUNGSGERECHTIGKEIT
- PRIESTERTUM ALLER GETAUFTEN
- FREIHEIT DES CHRISTENMENSCHEN
- FAZIT: LUTHER UND ZIVILGESELLSCHAFT – PASST DAS ZUSAMMEN?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet das Verhältnis von Reformation und Zivilgesellschaft im historischen Kontext. Das zentrale Ziel ist es, zu untersuchen, ob die reformatorischen Forderungen mit einer modernen Zivilgesellschaft in Einklang zu bringen sind. Dabei wird der Fokus hauptsächlich auf Martin Luther gelegt, dessen „Zwei-Reiche-Lehre“ sowie seine Äußerungen zu Widerstand und Obrigkeit für das Thema relevant sind.
- Begriffsklärung der Zivilgesellschaft
- Soziale und wirtschaftliche Situation der spätmittelalterlichen Bevölkerung
- Forderungen der Reformatoren und deren theologische Herleitung
- Luthers Verständnis von einer paternalistischen Gesellschaftsstruktur
- Mögliche Impulse der Reformation für die Entwicklung einer modernen Zivilgesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung thematisiert den Widerspruch zwischen Protestantischer Kirche und Zivilgesellschaft und führt in die Fragestellung der Arbeit ein. Das zweite Kapitel bietet eine kurze Begriffsklärung der Zivilgesellschaft und betrachtet deren historische Entwicklung von Aristoteles über Augustinus bis hin zu Thomas von Aquin. Kapitel drei beleuchtet die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der spätmittelalterlichen Bevölkerung, um die Ursachen der Reformation im Kontext nachvollziehbar zu machen. Kapitel 4 befasst sich mit den Forderungen der Reformatoren und deren theologische Herleitung, insbesondere mit der Lehre von der Rechtfertigung und dem Ablasshandel. Kapitel 5 untersucht Luthers Verständnis von einer paternalistischen Gesellschaftsstruktur anhand seiner Ansichten zu Widerstand und Obrigkeit. Im sechsten Kapitel werden drei mögliche Impulse der Reformation für die Entwicklung einer modernen Zivilgesellschaft erörtert: Bildungsteilhabe und -gerechtigkeit, das Priestertum aller Getauften und die Freiheit des Christenmenschen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Reformation, Zivilgesellschaft, Martin Luther, Zwei-Reiche-Lehre, Widerstand, Obrigkeit, Bildungsteilhabe, Priestertum aller Getauften, Freiheit des Christenmenschen.
Häufig gestellte Fragen
Passen Martin Luthers Lehren zur modernen Zivilgesellschaft?
Die Arbeit untersucht dieses Spannungsfeld und hinterfragt, ob Luthers paternalistische Ansichten mit den Werten einer unabhängigen Zivilgesellschaft vereinbar sind.
Was besagt Luthers "Zwei-Reiche-Lehre"?
Sie trennt zwischen dem geistlichen Reich (Glaube) und dem weltlichen Reich (Obrigkeit), was weitreichende Folgen für das Verständnis von Gehorsam und Widerstand hatte.
Welche Impulse gab die Reformation für die Bildung?
Die Forderung nach Bildungsteilhabe und Bildungsgerechtigkeit gilt als einer der wichtigsten Impulse für die Entwicklung einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft.
Warum gelten Kirchen in Deutschland formal nicht als Teil der Zivilgesellschaft?
Aufgrund ihres Status als Körperschaften des öffentlichen Rechts und ihrer engen Verbindung zum Staat (z. B. Kirchensteuer) widersprechen sie dem Prinzip der Staatsunabhängigkeit.
Was bedeutet das "Priestertum aller Getauften" für die Gesellschaft?
Dieses Konzept fördert die Gleichheit und Eigenverantwortung des Einzelnen, was als früher Vorläufer demokratischer und zivilgesellschaftlicher Teilhabe interpretiert werden kann.
- Citation du texte
- Christina Schütze (Auteur), 2017, Reformation & Zivilgesellschaft. Zusammenhänge und Widersprüche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/379462