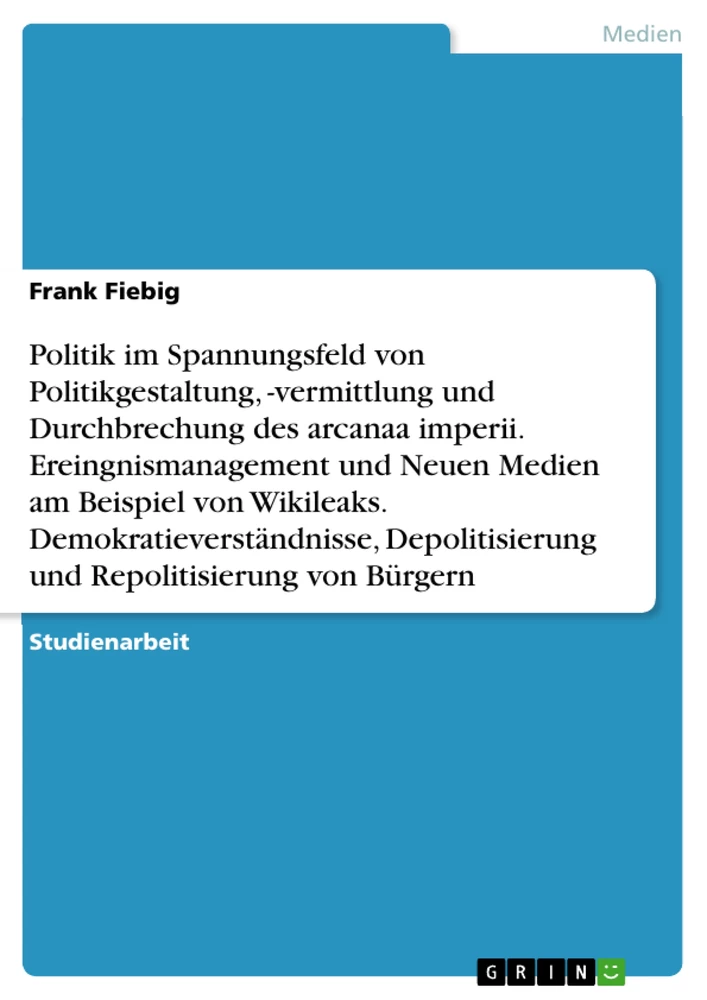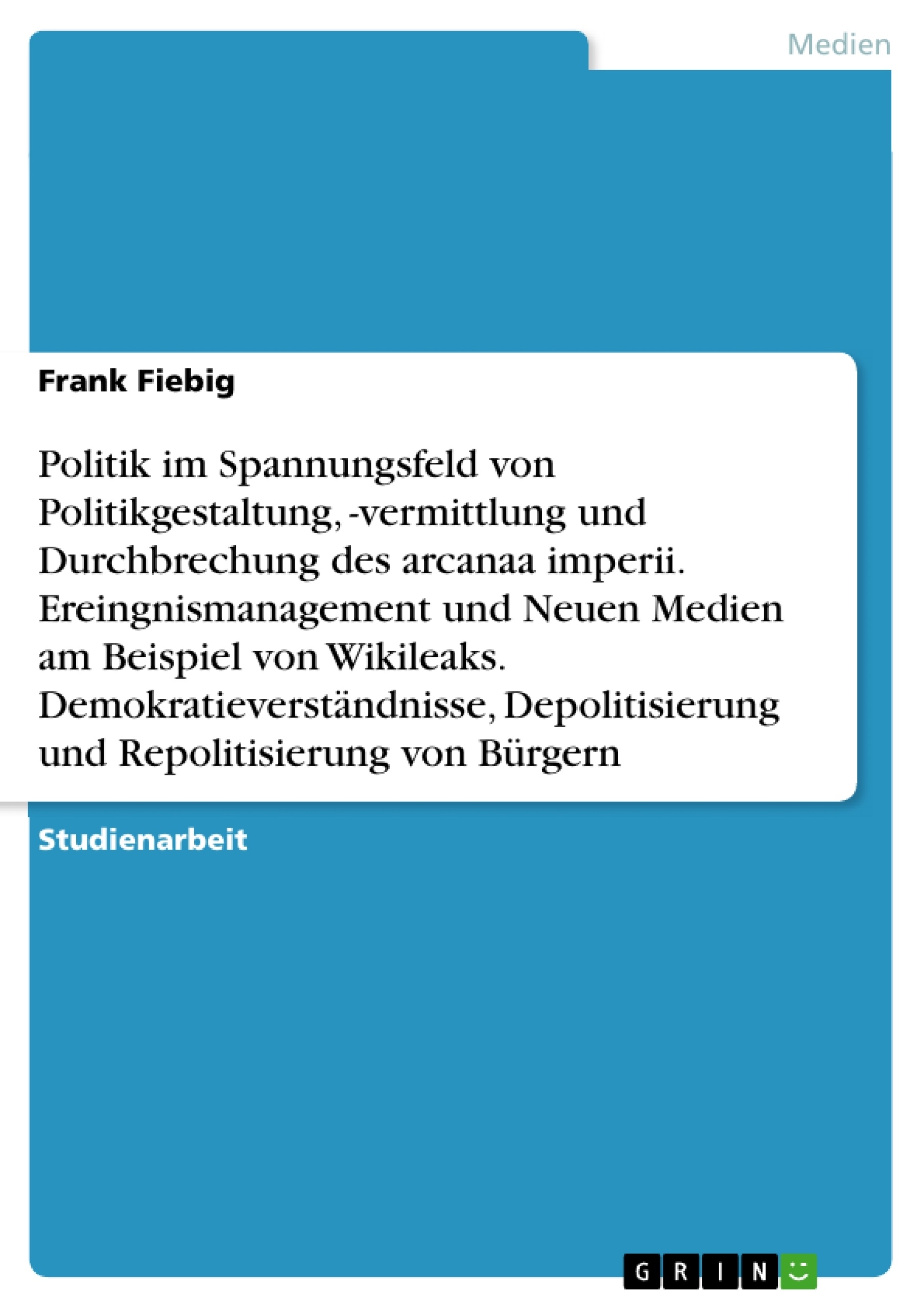„Diese Enthüllungen sind der 11. September für die weltweite Diplomatie, weil sie alle vertraulichen Beziehungen zwischen den Staaten in die Luft jagen.“ Mit diesen Worten kennzeichnete der italienische Außenminister Franco Frattini das Ereignis der Veröffentlichung der „Cablegates“, der ca. 250.000, zwischen dem US-Außenministerium und den amerikanischen Botschaften ausgetauschten, „geheimen oder vertraulichen Depeschen“, durch WikiLeaks. Mit einem „Angriff auf Amerika und die internationale Gemeinschaft“ setzte US-Außenministerin Hillary Clinton dies sogar gleich.
In dieser Arbeit soll aufgezeigt werden, dass das entscheidende Moment für diese Interpretationen über die Veröffentlichungen von WikiLeaks in der Ohnmächtigkeit der verschiedenen staatlichen Stellen gegenüber der Durchdringung des arcana imperii und ihrer Irreversibilität seitens einer international agierenden
Nicht-Regierungsorganisation (NGO) und ihrer Unterstützer mittels moderner Kommunikationsmittel und der Vernachlässigung von Partizipationsbestrebungen eines sich in der globalisierten Welt exkludiert wahrnehmenden Bevölkerungsteils zu finden ist. Dazu wird das Phänomen Wikileaks im Kontext des Ereignismanagements unter stark demokratietheoretischen Gesichtspunkten untersucht. Diese Arbeit wird somit eine solche Ausrichtung erhalten, in der die These vertreten wird, dass die Neuen Medien, insbesondere WikiLeaks zu einer Repolitisierung der Bevölkerung, und Integration von sich exkludiert fühlenden Bevölkerungsteilen erheblich Anteil tragen.
Des Weiteren sind die Lehren auch auf das Krisen- und Ereignismannagement von Wirtschaftsbetrieben übertragbar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Postdemokratische Gesellschaftsverhältnisse
- MASSENMEDIEN - NEUE MEDIEN - WIKILEAKS
- POLITIK DER ENTPOLITISIERUNG DER MACHT
- HERRSCHAFTSWISSEN UND INTRANSPARENZ
- WikiLeaks und Julian Assange
- DIE PERSON DES J. ASSANGE
- VON DEN CYPHERPUNKS ZU WIKILEAKS
- DIE IDEE WIKILEAKS - LEGITIMATION UND TRANSPARENZFORDERUNG
- STRUKTUR UND STRUKTURELLE PROBLEME VON WIKILEAKS
- LEGITIMATION VS. LEGALITÄT
- WikiLeaks und Ereignismanagement
- STRATEGIE - TAKTIK - FRIKTIONEN BZW. Taktik ALS EREIGNISMANAGEMENT
- WIKILEAKS UND DIE CABLE-GATES
- DIE FDP UND IHR PROBLEM MIT DEM \"MAULWURF\"
- KRISENMANAGEMENTS IM VERGLEICH
- AUSWIRKUNGEN DER VERÖFFENTLICHUNGEN
- Epilog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht WikiLeaks als neues Medium und Ereignismanagement im Kontext postdemokratischer Gesellschaftsverhältnisse. Sie analysiert die Ohnmächtigkeit staatlicher Stellen gegenüber der Verbreitung von Informationen durch WikiLeaks und hinterfragt die Auswirkungen auf die internationale Diplomatie und die Medienlandschaft.
- Die Bedeutung von WikiLeaks als neues Medium in einer sich verändernden Medienlandschaft
- Die Rolle von WikiLeaks bei der Enthüllung von Geheiminformationen und ihre Auswirkungen auf das internationale Politikgeschehen
- Das Verhältnis von WikiLeaks zu traditionellen Medien und der Einfluss der neuen Medien auf die öffentliche Meinung
- Die Herausforderungen für das Ereignismanagement in Zeiten von WikiLeaks und die Bedeutung eines erfolgreichen Krisenmanagements
- Die Frage nach der Legitimität und Legalität von WikiLeaks und der ethischen Aspekte der Informationsfreigabe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und erläutert den Ausgangspunkt der Untersuchung: die Veröffentlichung der "Cablegates" durch WikiLeaks. Anschließend beleuchtet die Arbeit die postdemokratischen Gesellschaftsverhältnisse, die durch die Entwicklung der Massenmedien und der neuen Medien geprägt sind. Im Fokus steht die Frage, wie WikiLeaks in diesem Kontext zu verstehen ist.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Person Julian Assange und der Geschichte von WikiLeaks. Es beleuchtet die Entstehung und Struktur von WikiLeaks, die Legitimationsgrundlage und die Transparenzforderung, die WikiLeaks vertritt. Das vierte Kapitel analysiert WikiLeaks im Kontext des Ereignismanagements. Es werden die Strategien und Taktiken von WikiLeaks im Umgang mit Medien und Politik diskutiert, sowie die Auswirkungen der Veröffentlichungen auf die internationale Diplomatie und das Krisenmanagement verschiedener Staaten.
Schlüsselwörter
WikiLeaks, Neue Medien, Ereignismanagement, Postdemokratie, Transparenz, Geheimhaltung, Diplomatie, Krisenmanagement, Julian Assange, Cablegates, Medienlandschaft, Informationssicherheit, Gesellschaftliche Veränderung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff „arcana imperii“?
Es bezeichnet die Herrschaftsgeheimnisse des Staates. WikiLeaks wird in der Arbeit als Instrument zur Durchbrechung dieser Geheimhaltung analysiert.
Welche Bedeutung haben die „Cablegates“?
Die Veröffentlichung von ca. 250.000 diplomatischen Depeschen der USA durch WikiLeaks erschütterte die weltweite Diplomatie und wird oft als „11. September der Diplomatie“ bezeichnet.
Fördert WikiLeaks die Repolitisierung der Bürger?
Die Arbeit vertritt die These, dass WikiLeaks dazu beiträgt, sich exkludiert fühlende Bevölkerungsteile zu integrieren und das politische Interesse durch Transparenz neu zu wecken.
Wer ist Julian Assange im Kontext von WikiLeaks?
Julian Assange ist der Gründer von WikiLeaks. Die Arbeit beleuchtet seinen Hintergrund in der Cypherpunk-Bewegung und seine Rolle als Kopf der Organisation.
Ist das Krisenmanagement von WikiLeaks auf Unternehmen übertragbar?
Ja, die Arbeit zeigt auf, dass die Lehren aus dem Umgang mit WikiLeaks auch für das Ereignis- und Krisenmanagement in der Wirtschaft relevant sind.
- Quote paper
- Frank Fiebig (Author), 2011, Politik im Spannungsfeld von Politikgestaltung, -vermittlung und Durchbrechung des arcanaa imperii. Ereingnismanagement und Neuen Medien am Beispiel von Wikileaks. Demokratieverständnisse, Depolitisierung und Repolitisierung von Bürgern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/379628