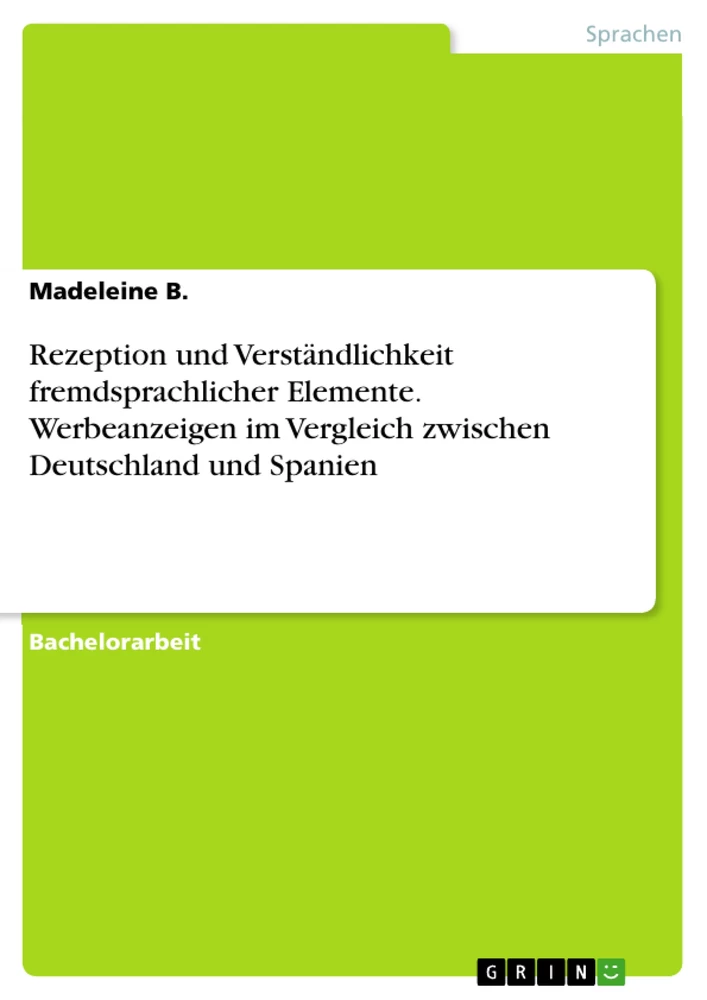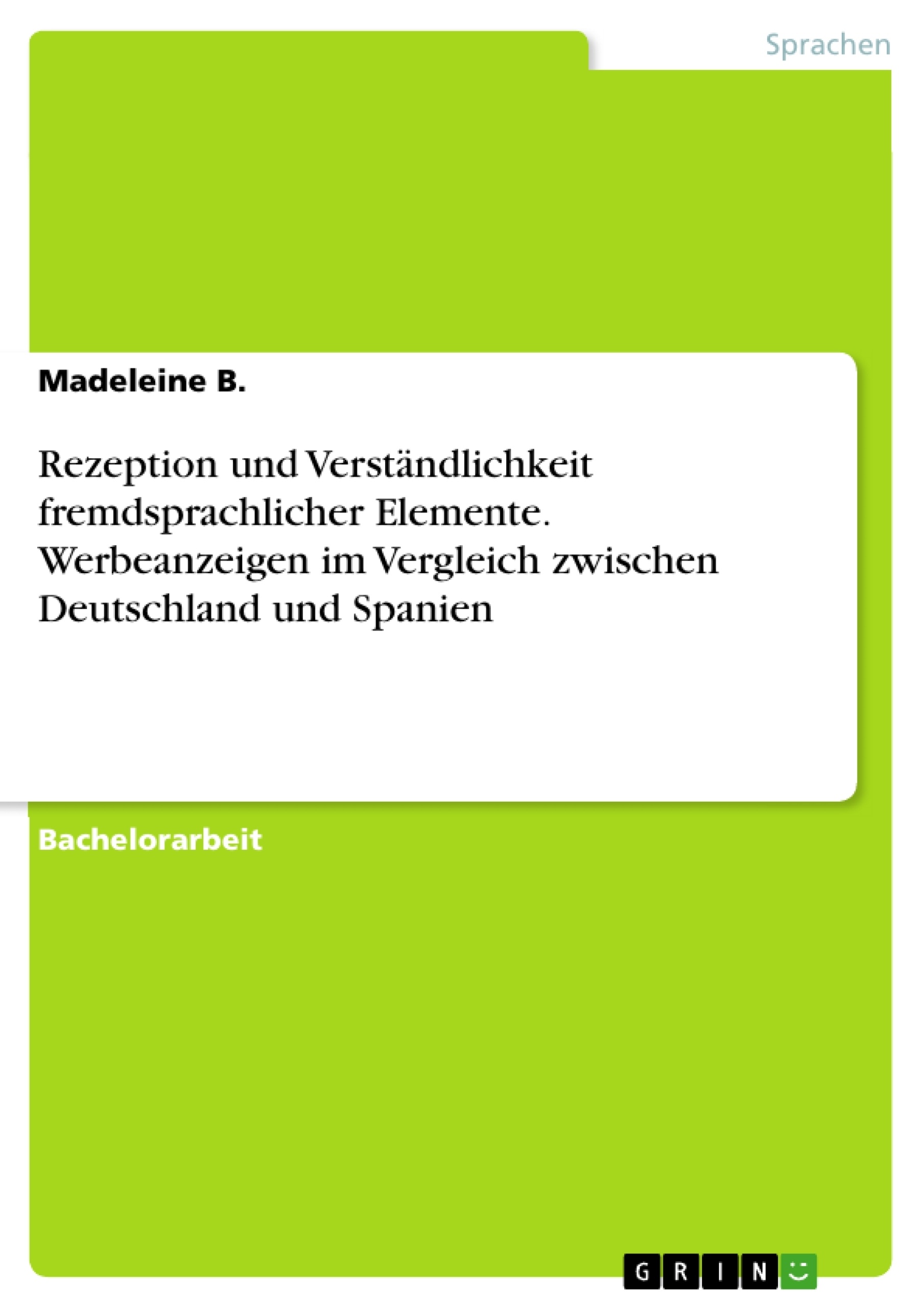In der vorliegenden Arbeit soll die Frage der Verständlichkeit und Rezeption englischer und französischer Lexeme im Rahmen einer durchgeführten Studie anhand von zwei ausgewählten Printanzeigen, je in deutscher und spanischer Version, geklärt werden.
Zur theoretischen Fundierung trägt dabei im ersten Teil die Erläuterung der Werbesprache als sprachwissenschaftlicher Untersuchungsgegenstand bei, der im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit um die Grundzüge der Textverständlichkeits- und der Rezeptionsforschung erweitert wird.
Der Hauptteil besteht aus den Ergebnissen der durchgeführten Studie, die nach fremdsprachlichen Kriterien der Anzeigen aufgeteilt wurden. Nach einer kurzen Einführung der Ziele und Methoden der Umfrage werden zuerst die Ergebnisse der Studie mit englischen Lexemen vorgestellt, die von der mit französischen gefolgt wird. Beide Auswertungen fokussieren dabei die Verständlichkeit der fremdsprachlichen Lexeme, die Art der Rezeption der Anzeige anhand festgelegter Konnotationen und freien Assoziationen und die allgemeine Rezeption der Fremdsprache in Werbeanzeigen. Die Ergebnisse der deutschen Studien werden dabei jeweils im Rahmen der Präsentation der spanischen Ergebnisse verglichen. Beide Betrachtungen greifen dabei stets auf den Theorieteil zurück. In der Schlussbetrachtung werden die aufgeworfenen Fragen zusammenfassend wiederaufgegriffen um zu klären, welche Besonderheiten und Unterschiede es im Hinblick auf die Rezeption fremdsprachlicher Elemente in Werbeanzeigen zwischen Deutschland und Spanien gibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aktueller Forschungsüberblick
- Das Korpus
- Werbesprache als Untersuchungsgegenstand
- Zum Begriff der Werbesprache
- Funktionen und Ziele der Werbesprache
- Fremdsprachliche Elemente in Werbetexten der Konsumgüterindustrie
- Englische Elemente
- Französische Elemente
- Rezeption und Verständlichkeit von Werbetexten
- Begriffsabgrenzung: Rezeption und Verständlichkeit
- Kriterien der Verständlichkeit und des Verstehen von Werbetexten
- Die rezipientenorientierte Perspektive
- Ausgangspunkt: Der Uses-and-Gratifications-Ansatz
- Der konstruktivistische Ansatz
- Semantische und semiotische Bedeutungskonstruktion
- Studie zur Verständlichkeit und Rezeption von Fremdsprachen in Werbetexten: ein Vergleich zwischen Deutschland und Spanien
- Ziele und Hypothesen
- Methoden
- Englische Elemente in Werbetexten
- Die Ergebnisse der deutschen Studie
- Die Ergebnisse der spanischen Studie im Vergleich
- Französische Elemente in Werbetexten: Anzeige Boss
- Die deutsche und spanische Anzeige von Boss Nuit
- Die Ergebnisse der deutschen Studie
- Die Ergebnisse der spanischen Studie im Vergleich
- Französische Elemente in Werbetexten: Anzeige Maybelline
- Die deutsche und spanische Anzeige von Maybelline
- Die Ergebnisse der deutschen Studie
- Die Ergebnisse der spanischen Studie im Vergleich
- Fazit: englische und französische Elemente in Werbetexten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Rezeption und Verständlichkeit fremdsprachlicher Elemente in Werbeanzeigen, insbesondere mit englischen und französischen Lexemen. Die Untersuchung konzentriert sich auf einen Vergleich zwischen Deutschland und Spanien und zielt darauf ab, Unterschiede in der Interpretation und Wirkung dieser Elemente in den jeweiligen Kulturräumen zu identifizieren.
- Die Rolle fremdsprachlicher Elemente in der Werbesprache
- Die Rezeption und Verständlichkeit von Werbetexten im interkulturellen Kontext
- Der Einfluss kultureller Kontexte auf die Interpretation von Werbebotschaften
- Die Rezeption und Wirkung fremdsprachlicher Elemente in Werbeanzeigen in Deutschland und Spanien
- Die Analyse von zwei Fallstudien: englische und französische Elemente in Werbeanzeigen von Boss Nuit und Maybelline
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Werbesprache ein und beleuchtet die wachsende Bedeutung fremdsprachlicher Elemente in der globalisierten Werbewelt. Der aktuelle Forschungsüberblick präsentiert relevante Studien aus verschiedenen Disziplinen, die sich mit Werbesprache, Textverständlichkeit und Rezeption befassen.
Das Kapitel "Werbesprache als Untersuchungsgegenstand" definiert den Begriff der Werbesprache und analysiert ihre Funktionen und Ziele. Es betrachtet die Integration fremdsprachlicher Elemente in Werbetexten der Konsumgüterindustrie, wobei insbesondere englische und französische Elemente untersucht werden.
Das Kapitel "Rezeption und Verständlichkeit von Werbetexten" beschäftigt sich mit der Bedeutung des Rezeptionsprozesses und den Kriterien der Verständlichkeit von Werbetexten. Es beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze, die die rezipientenorientierte Perspektive der Werbekommunikation in den Vordergrund stellen, darunter der Uses-and-Gratifications-Ansatz, der konstruktivistische Ansatz und die semantische und semiotische Bedeutungskonstruktion.
Das Kapitel "Studie zur Verständlichkeit und Rezeption von Fremdsprachen in Werbetexten: ein Vergleich zwischen Deutschland und Spanien" präsentiert die Methodik und Ergebnisse der durchgeführten Studie. Es analysiert die Verständlichkeit und Rezeption von englischen und französischen Lexemen in Werbeanzeigen, wobei die deutschen und spanischen Ergebnisse verglichen werden. Die Untersuchung umfasst sowohl eine Analyse der Konnotationen und Assoziationen, die die Rezipienten mit den fremdsprachlichen Elementen verbinden, als auch eine allgemeine Bewertung der Rezeption der Fremdsprachen in Werbeanzeigen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind: Werbesprache, Fremdsprachen, Rezeption, Verständlichkeit, interkulturelle Kommunikation, Kulturvergleich, Deutschland, Spanien, englische Elemente, französische Elemente, Konnotationen, Assoziationen, Werbewirkung.
Häufig gestellte Fragen
Warum werden Fremdsprachen in der Werbung eingesetzt?
Fremdsprachen wie Englisch oder Französisch werden genutzt, um bestimmte Konnotationen (z. B. Internationalität oder Exklusivität) zu wecken.
Verstehen Konsumenten englische Slogans immer richtig?
Die Studie untersucht die Verständlichkeit und zeigt, dass Lexeme oft unterschiedlich rezipiert werden, was zu Fehlinterpretationen führen kann.
Gibt es Unterschiede bei der Rezeption zwischen Deutschland und Spanien?
Ja, die Arbeit vergleicht die Ergebnisse beider Länder und stellt fest, dass kulturelle Hintergründe die Wirkung fremdsprachiger Elemente beeinflussen.
Welche Rolle spielt Französisch in der Kosmetikwerbung?
Französische Elemente werden oft mit Eleganz und Qualität assoziiert, wie die Beispiele von Boss Nuit und Maybelline in der Arbeit zeigen.
Was ist der "Uses-and-Gratifications-Ansatz" in der Werbeforschung?
Dieser Ansatz betrachtet die Werbung aus der Perspektive des Rezipienten und fragt, welche Bedürfnisse durch die Mediennutzung befriedigt werden.
- Quote paper
- Madeleine B. (Author), 2013, Rezeption und Verständlichkeit fremdsprachlicher Elemente. Werbeanzeigen im Vergleich zwischen Deutschland und Spanien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/379678