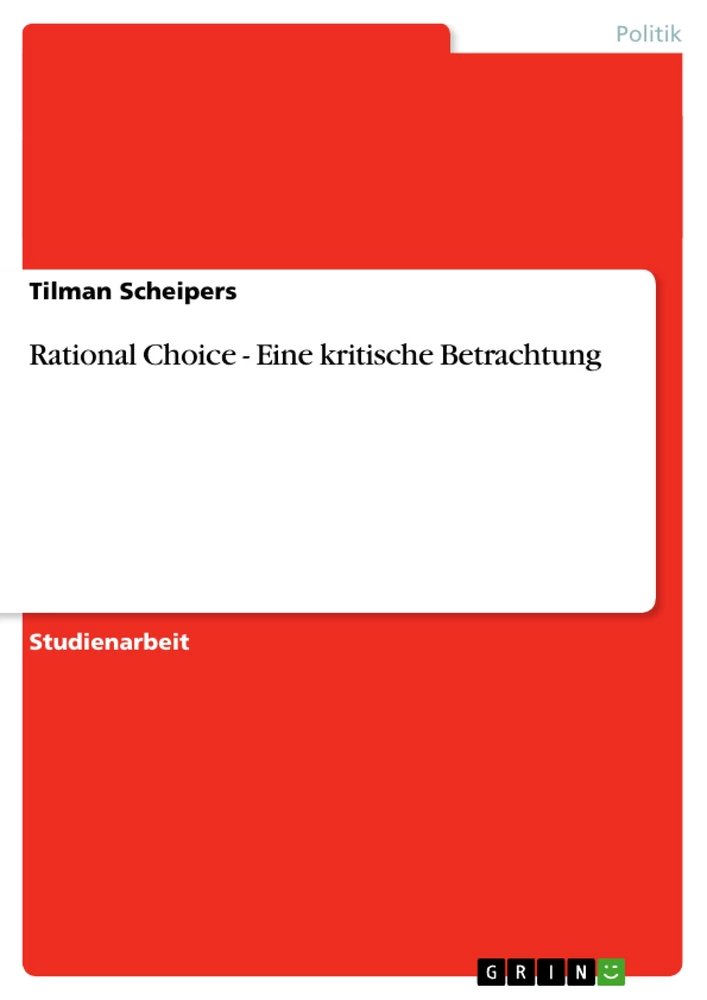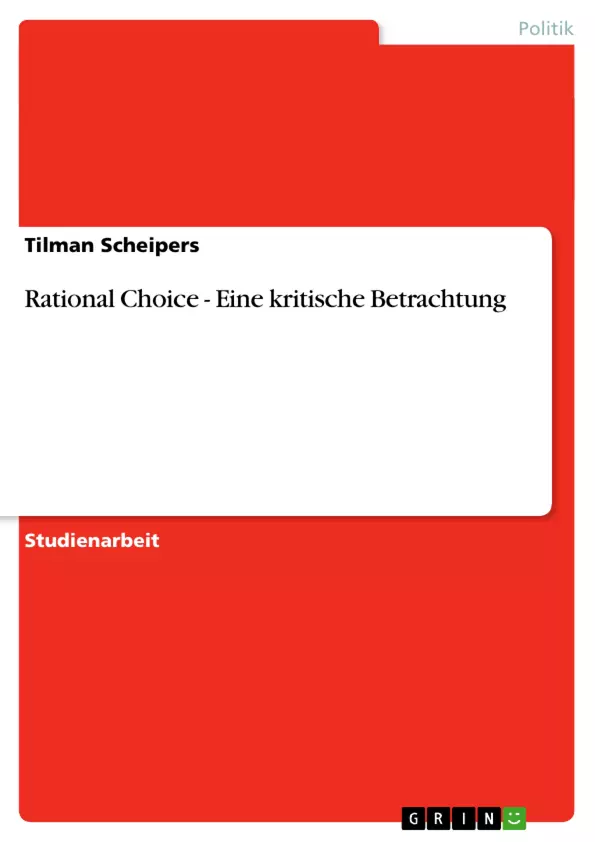In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wurde Bundeskanzler Gerhard Schröder die Frage gestellt, ob er glaube, dass die sich USamerikanische Regierung bei ihren Entscheidungen zu sehr nach religiösen Wertvorstellungen richte. Worauf der Bundeskanzler antwortete, dass er sich sicher sei, dass auch die Bush-Administration ihre Entscheidungen rein rational treffe.1 Er wird es nicht so gemeint haben, trotzdem könnte man ihm unterstellen, er gehe davon aus, dass alle politischen Entscheidungen rationale sind – rationale im Sinne des Rational-Choice-Ansatzes. Dieser Rational-Choice-Ansatz beschreibt einen theoretischen Vorgang, nach welchem der dazu gehörig typologisierte Mensch, der sogenannte Homo Oeconomicus, Entscheidungen fällt. Bei diesem Ansatz handelt es sich um den im Allgemeinen und in der Politikwissenschaft im Besonderen am meisten und heftigsten diskutierten. Wie es in der Natur viel diskutierter Themen liegt, haben diese nicht nur Befürworter, sondern auch Kritiker, die ihre Richtigkeit bezweifeln.
So verhält es sich auch mit dem Rational-Choice-Ansatz: Wie von Beyme erläutert, wird dem Ansatz vor allem vorgeworfen, sich empirisch schlecht belegen zu lassen und nur in Situationen mit sehr beschränkter Anzahl von Handlungsoptionen zufrieden stellende Aussagen liefern zu können. In Bezug auf Cox führt er an, dass sich die Kritik des Ansatzes vor allem gegen seine rigorosesten Verfechter wende und außerdem kein anderer Ansatz so scharfen Tests unterworfen werde wie der des Rational Choice.2
Doch es wird auch oft darauf hingewiesen wird, dass sich diese Auseinandersetzungen nicht durch Meinungsverschiedenheiten begründen, sondern vielmehr auf Missverständnissen beruhen. 3 Aus diesem Grund möchte diese Hausarbeit einen objektiven Blick auf den Rational- Choice-Ansatz werfen; das heißt zunächst ohne jegliche Wertung und anschließend sowohl Gründe für seine Befürwortung als auch für seine Ablehnung. So sollen im ersten Teil zunächst die Grundannahmen und die Methodik des Rational-Choice- Ansatzes vorgestellt und anschließend im zweiten Teil dann die Hauptbefürwortungs- und -kritikpunkte angesprochen werden. Obwohl es verschiedene Theoriezweige dieses Ansatzes gibt, wird im Rahmen der Arbeit der Rational-Choice-Ansatz dennoch als ein allgemeiner Überbegriff für die verschiedenen Teilbereiche verwendet, und der Auffächerung durch eine kurze Vorstellung dieser genüge getan sein.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DER RATIONAL-CHOICE-ANSATZ
- Die Grundannahmen
- Die Entscheidungsmethodik
- DIE KRITIK AM RATIONAL-CHOICE-ANSATZ
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit einer kritischen Betrachtung des Rational-Choice-Ansatzes. Ziel ist es, die Grundannahmen und Entscheidungsmethodik des Ansatzes darzulegen und anschließend sowohl Befürwortungs- als auch Kritikpunkte zu beleuchten. Dabei wird der Fokus auf die Anwendung des Rational-Choice-Ansatzes in der Politikwissenschaft gelegt.
- Die Grundannahmen des Rational-Choice-Ansatzes
- Die Entscheidungsmethodik des Rational-Choice-Ansatzes
- Die Kritik am Rational-Choice-Ansatz
- Die Anwendung des Rational-Choice-Ansatzes in der Politikwissenschaft
- Die Rolle des Homo Oeconomicus im Rational-Choice-Ansatz
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Hausarbeit führt in die Thematik des Rational-Choice-Ansatzes ein. Es wird der Zusammenhang zwischen dem Ansatz und politischen Entscheidungen beleuchtet, wobei der Fokus auf der Frage liegt, ob politische Entscheidungen als rationale Entscheidungen im Sinne des Rational-Choice-Ansatzes betrachtet werden können. Das Kapitel beleuchtet auch die Kontroverse um den Ansatz und die verschiedenen Perspektiven auf seine Gültigkeit.
Im zweiten Kapitel wird der Rational-Choice-Ansatz im Detail vorgestellt. Die Grundannahmen des Ansatzes werden dargelegt, insbesondere der methodologische Individualismus, die Entscheidung nach rationaler Wahl und die nutzenmaximierende Handlung. Zudem wird das Modell des Homo Oeconomicus und dessen Rolle im Rational-Choice-Ansatz erläutert.
Das dritte Kapitel widmet sich den verschiedenen Kritikpunkten am Rational-Choice-Ansatz. Es werden die Argumente derjenigen aufgezeigt, die den Ansatz als unrealistisch, empirisch nicht belegbar und in der Praxis nicht anwendbar ansehen. Zudem werden die verschiedenen Perspektiven auf die Kritik am Rational-Choice-Ansatz beleuchtet und die Diskussion um die Gültigkeit des Ansatzes vertieft.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen der Hausarbeit sind: Rational-Choice-Ansatz, methodologischer Individualismus, rationale Wahl, nutzenmaximierende Handlung, Homo Oeconomicus, Kritik am Rational-Choice-Ansatz, Politikwissenschaft, empirische Belege, Spieltheorie, strategische Interaktionen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Grundannahme des Rational-Choice-Ansatzes?
Der Ansatz geht davon aus, dass Individuen (als Homo Oeconomicus) Entscheidungen treffen, die ihren persönlichen Nutzen maximieren, basierend auf rationalen Abwägungen.
Was bedeutet „methodologischer Individualismus“?
Dies ist das Prinzip, soziale und politische Phänomene als Ergebnis der Handlungen und Entscheidungen einzelner Individuen zu erklären.
Welche Kritik wird am Rational-Choice-Ansatz geübt?
Kritiker werfen dem Ansatz vor, empirisch schwer belegbar zu sein, menschliche Emotionen zu ignorieren und nur in Situationen mit begrenzten Optionen zu funktionieren.
Wie wird der Rational-Choice-Ansatz in der Politikwissenschaft angewendet?
Er wird genutzt, um politisches Verhalten wie Wahlen, Koalitionsbildungen oder strategische Interaktionen (Spieltheorie) zu analysieren.
Beruht die Kritik am Ansatz oft auf Missverständnissen?
Ja, die Arbeit weist darauf hin, dass viele Auseinandersetzungen eher auf unterschiedlichen Definitionen von „Rationalität“ als auf tatsächlichen inhaltlichen Differenzen beruhen.
- Arbeit zitieren
- Tilman Scheipers (Autor:in), 2005, Rational Choice - Eine kritische Betrachtung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37972