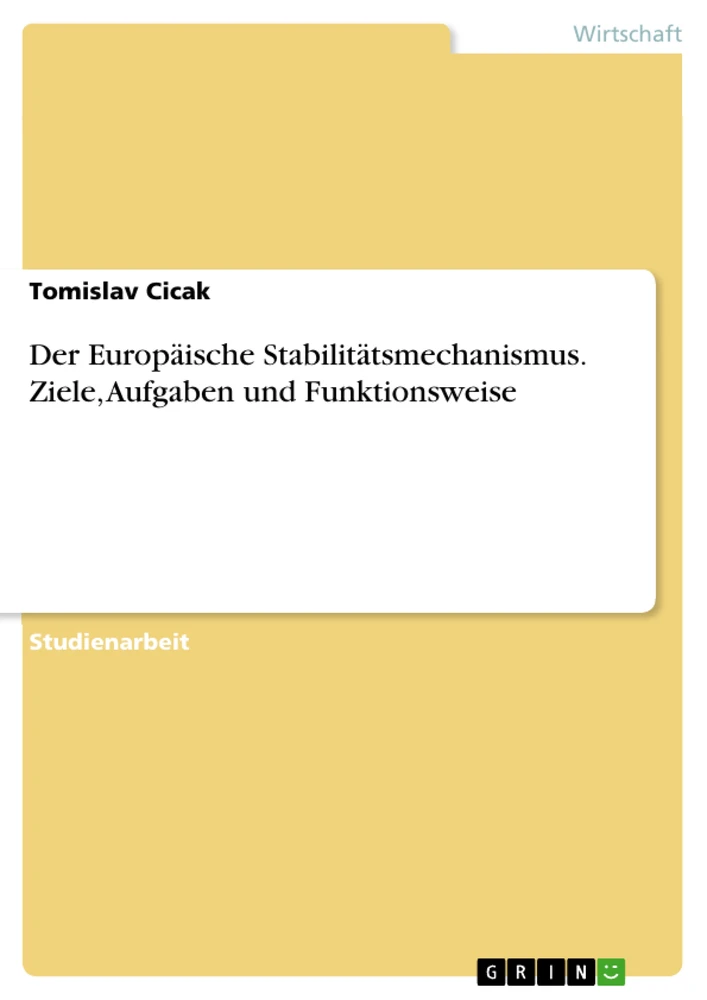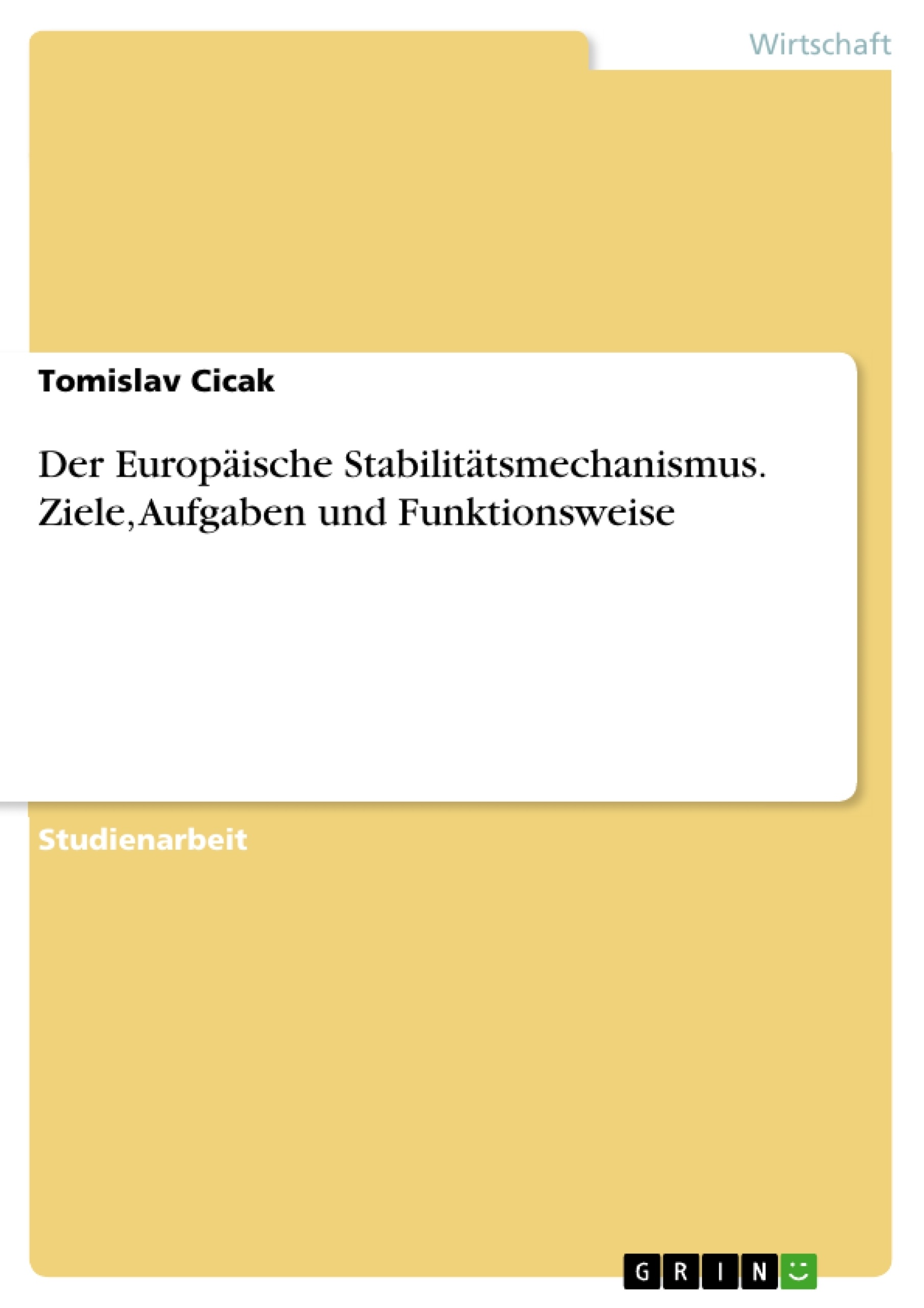Mit Einführung der einheitlichen Währungsunion schienen die Vorteile offensichtlich: Das Streben nach besserer Vernetzung, Handel und Frieden innerhalb der Euro-Länder. Doch schon zehn Jahren danach treten weltweit Schwierigkeiten auf, hohe Staatsverschuldungen und Arbeitslosenquoten sowie einem schwankenden Preisniveau innerhalb der EU. Der Wunsch nach dem Euro entwickelt sich zunehmend zu einer Last für die Bürger, die von nun an täglich mit dem Begriff der Euro-Krise in den Medien konfrontiert werden. Spekuliert wird viel, wo liegen die Ursachen und wie kann man diese Krise bewältigen?
Als Eurokrise bezeichnet man die seit 2009 anhaltende Krise im Euro-Raum, die vor allem die PIIGS Staaten (Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien) trifft, aber Konsequenzen für die gesamte Währungsunion hat. Man spricht auch von einer Wirtschafts-, Banken, und Staatschuldenkrise. Der Ursprung kann nicht nur auf eine Ursache zurückverfolgt werden, vielmehr spielen mehrere Faktoren eine prägnante Rolle. Die PIIGS Staaten waren schlussendlich so sehr verschuldet, dass es ihnen nicht mehr möglich war, diese Zahlungspflichten aus eigener Hand zu bewältigen. Die Krise entwickelte sich für ganz Europa als Bewährungsprobe womit die Unterstützung der Euro Länder, durch den Euro-Rettungsschirm sowie der EZB zwingend erforderlich war.
Diese Arbeit beschäftigt sich zunächst mit den Ursachen der Eurokrise, die den Euro-Rettungsschirm zur Folge hatte, bestehend aus dem vorläufigen EFSF, EFSM sowie dem IWF, und letztlich vom dauerhaften ESM abgelöst wurde. Zum ESM sind entscheidende Fragen zu beantworten, angefangen von der Zielsetzung, den finanziellen Mittel und den Voraussetzungen für eine Hilfe. Zum Schluss der Arbeit wird eine kritische Zusammenfassung zum Europäischen Stabilitätsmechanismus gegeben und ein Fazit zur Wirksamkeit des Euro Rettungsschirms gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Ursachenanalyse der Eurokrise
- Wirtschaftskraft und Verschuldung
- Die Wirtschafts- und Währungsunion
- Vorteile
- Kritik
- Der Vertrag von Maastricht
- Maastricht Kriterien
- Nichteinhaltung des Vertrags
- Verknüpfung von Rentabilität und Bonität
- Der Euro-Rettungsschirm
- Der vorläufige Stabilisierungsmechanismus
- Die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität
- Der Europäische Finanzstabilisierungsmechanismus
- Der Internationale Währungsfond
- Staatsanleihenkauf der EZB
- Das SMP Programm
- Outright Monetary Transactions
- Der Europäische Stabilisierungsmechanismus – ESM
- Ziele, Aufgaben und Funktionsweise
- Finanzielle Mittel
- Voraussetzungen
- Geldfluss an die Euroländer
- Kapital aus dem vorläufigen Stabilitätsmechanismus
- Kapital aus dem ESM
- Kritische Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit den Ursachen der Eurokrise, den verschiedenen Maßnahmen zur Rettung des Euros und insbesondere mit dem Europäischen Stabilisierungsmechanismus (ESM). Sie beleuchtet die Ziele, Aufgaben und Funktionsweise des ESM und analysiert seine Wirksamkeit im Hinblick auf die Stabilisierung der Eurozone.
- Ursachen der Eurokrise
- Der Europäische Stabilisierungsmechanismus (ESM) und seine Funktionsweise
- Die Rolle des ESM bei der Bewältigung der Eurokrise
- Die finanzielle Ausstattung des ESM
- Kritikpunkte und Herausforderungen für den ESM
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Die Arbeit führt in die Thematik der Eurokrise ein und beschreibt die Relevanz des ESM in diesem Kontext.
- Ursachenanalyse der Eurokrise: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen der Eurokrise, die sich auf die Wirtschaftskraft und Verschuldung der beteiligten Staaten, die Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion, den Vertrag von Maastricht und die Verknüpfung von Rentabilität und Bonität beziehen.
- Der Euro-Rettungsschirm: Dieses Kapitel stellt verschiedene Maßnahmen zur Rettung des Euros vor, darunter den vorläufigen Stabilisierungsmechanismus (EFSF, EFSM, IWF) und den Staatsanleihenkauf der EZB (SMP, OMT).
- Der Europäische Stabilisierungsmechanismus – ESM: Dieses Kapitel analysiert die Ziele, Aufgaben und Funktionsweise des ESM, beleuchtet die finanziellen Mittel und Voraussetzungen für Hilfsprogramme sowie die Art und Weise, wie der ESM Mittel an die Euroländer verteilt.
Schlüsselwörter
Eurokrise, Europäische Stabilisierungsmechanismus (ESM), Wirtschafts- und Währungsunion, Staatsverschuldung, Rentabilität, Bonität, Finanzhilfen, Finanzielle Stabilität, Eurorettung, Europäische Zentralbank (EZB).
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM)?
Der ESM ist ein dauerhafter Rettungsschirm, der überschuldeten Euro-Ländern Finanzhilfen gewährt, um die Stabilität der gesamten Währungsunion zu sichern.
Welche Staaten waren besonders von der Eurokrise betroffen?
Besonders betroffen waren die sogenannten PIIGS-Staaten: Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien.
Welche Vorläufer hatte der ESM?
Der ESM löste vorläufige Mechanismen wie die EFSF (Europäische Finanzstabilisierungsfazilität) und den EFSM ab.
Was sind die Voraussetzungen für Finanzhilfen aus dem ESM?
Hilfen sind an strenge Bedingungen geknüpft, oft in Form von Reformauflagen und Sparmaßnahmen, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit wiederherzustellen.
Welche Rolle spielt der Vertrag von Maastricht in der Krise?
Der Vertrag legte die Maastricht-Kriterien (z.B. Defizitgrenzen) fest. Die Nichteinhaltung dieser Kriterien wird als eine der Ursachen für die Eurokrise analysiert.
- Arbeit zitieren
- Tomislav Cicak (Autor:in), 2016, Der Europäische Stabilitätsmechanismus. Ziele, Aufgaben und Funktionsweise, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/379815