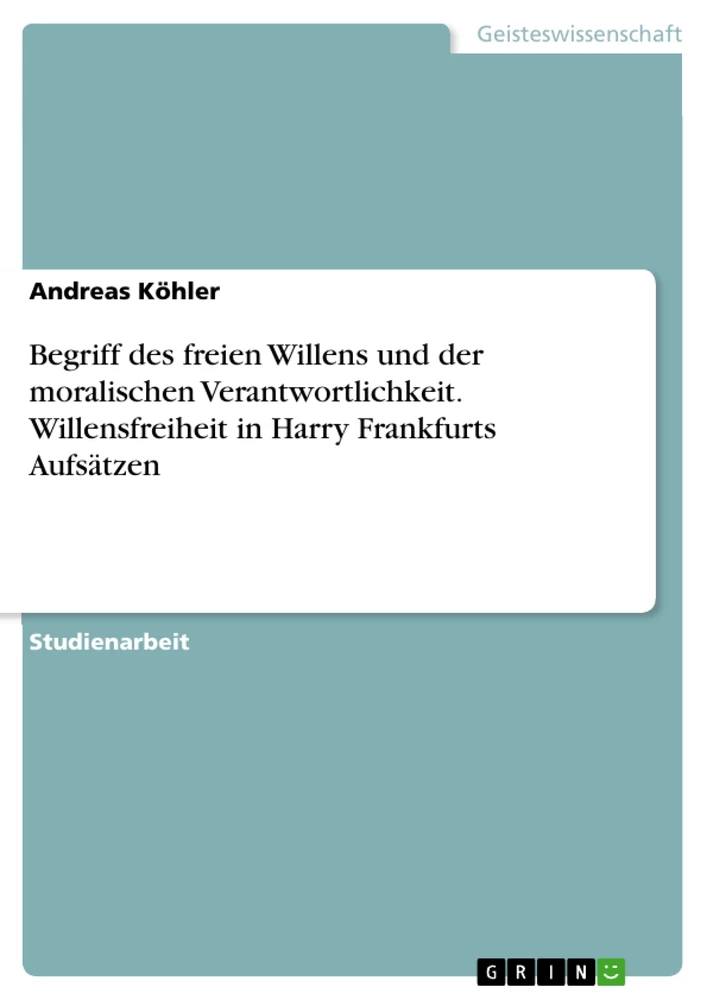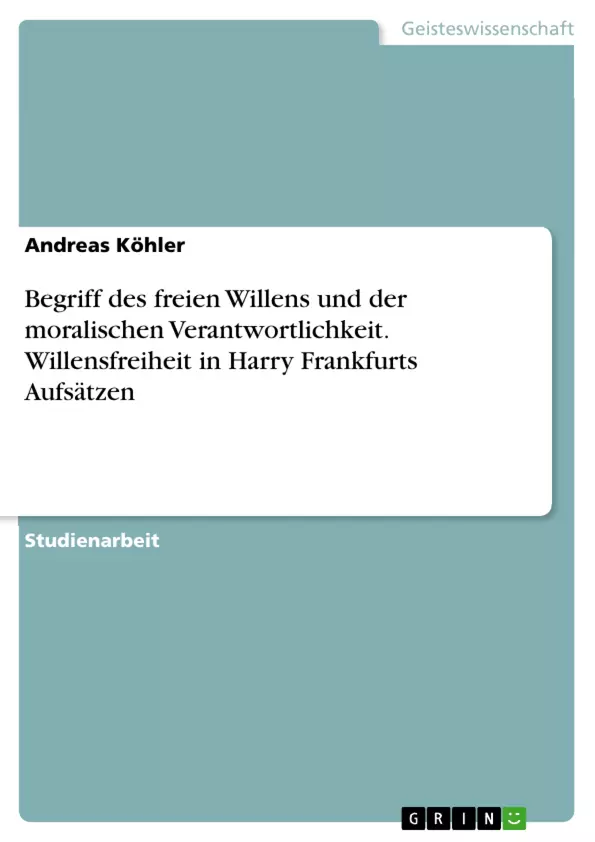Diese Wunschvorstellung des freien Willens wird wohl jeder schon einmal gehabt haben. Der Wunsch, Subjekt zu sein, ist Vater des Gedankens. Der Mensch möchte unabhängig handeln, selbst bestimmen, was er tun möchte, ohne Einfluss von äußeren Faktoren, wie zum Beispiel dem Willen anderer Menschen. Man möchte nicht gezwungen sein, etwas zu tun, nicht Objekt sein, sondern frei handeln, durch Gründe, die unser Ich bewusst gewählt hat. Dies ist jedoch nicht immer möglich.
Natürlich hat jeder Mensch Wünsche, von denen er hofft, dass sie in Erfüllung gehen. Sie können sich auf Grundbedürfnisse verschiedener Formen beziehen oder auch auf soziale Bedürfnisse. Wünsche können von Person zu Person unterschiedlich und sehr einfach, aber auch sehr komplex sein. Doch wie entwickeln sich Wünsche und was macht einen Wunsch eigentlich aus? Handeln wir immer so, wie wir uns es wünschen? Haben wir immer freie Entscheidungsgewalt und handeln nach unserem ausdrücklichen Willen, wenn wir handeln? Der Philosoph Harry G. Frankfurt hat sich damit auseinandergesetzt und in meiner Hausarbeit werde ich darauf eingehen, wie Frankfurts Gedanken zu diesem Thema aussehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Person
- Wünsche erster und zweiter Ordnung
- Volitionen zweiter Stufe
- Willensfreiheit unter Frankfurt
- Der Begriff der Person
- Triebhafte Wesen
- Unterschied zwischen Handlungs- und Willensfreiheit
- Willensfreiheit
- Moralische Verantwortlichkeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert den Begriff der Willensfreiheit basierend auf den Schriften von Harry G. Frankfurt. Dabei wird untersucht, wie Frankfurt die Entwicklung des Willens einer Person beschreibt, indem er die verschiedenen Stufen von Wünschen und deren Bedeutung für das Handeln beleuchtet.
- Die Unterscheidung von Wünschen erster und zweiter Ordnung
- Die Rolle von Volitionen zweiter Stufe für die Willensbildung
- Der Begriff der Person und seine Relevanz für die Willensfreiheit
- Der Unterschied zwischen Handlungs- und Willensfreiheit
- Die Bedeutung der Willensfreiheit für die moralische Verantwortlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Willensfreiheit vor und erläutert die Relevanz der Frage nach der Selbstbestimmung. Sie führt außerdem kurz die Gedanken des Philosophen Harry G. Frankfurt ein, der sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzte.
- Zur Person: Dieses Kapitel bietet eine kurze Biografie von Harry G. Frankfurt, einem einflussreichen amerikanischen Philosophen, der sich mit Fragen der Metaphysik, Ethik und Handlungstheorien beschäftigt hat.
- Wünsche erster und zweiter Ordnung: Hier wird Frankfurts Unterscheidung zwischen Wünschen erster Ordnung, die sich auf Handlungen beziehen, und Wünschen zweiter Ordnung, die sich auf Wünsche erster Ordnung beziehen, vorgestellt. Frankfurt argumentiert, dass es zu Konflikten zwischen diesen beiden Stufen von Wünschen kommen kann, da sie sich auf unterschiedliche Dinge beziehen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Hausarbeit sind die Willensfreiheit, die Wünsche erster und zweiter Ordnung, die Volitionen zweiter Stufe, der Begriff der Person, der Unterschied zwischen Handlungs- und Willensfreiheit und die moralische Verantwortlichkeit. Frankfurt betont die Bedeutung der eigenen Willensbildung und der Fähigkeit, selbstbestimmt zu handeln, in Verbindung mit der Frage nach den Motiven und Einflussfaktoren, die unsere Entscheidungen beeinflussen.
- Quote paper
- Andreas Köhler (Author), 2013, Begriff des freien Willens und der moralischen Verantwortlichkeit. Willensfreiheit in Harry Frankfurts Aufsätzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/379828