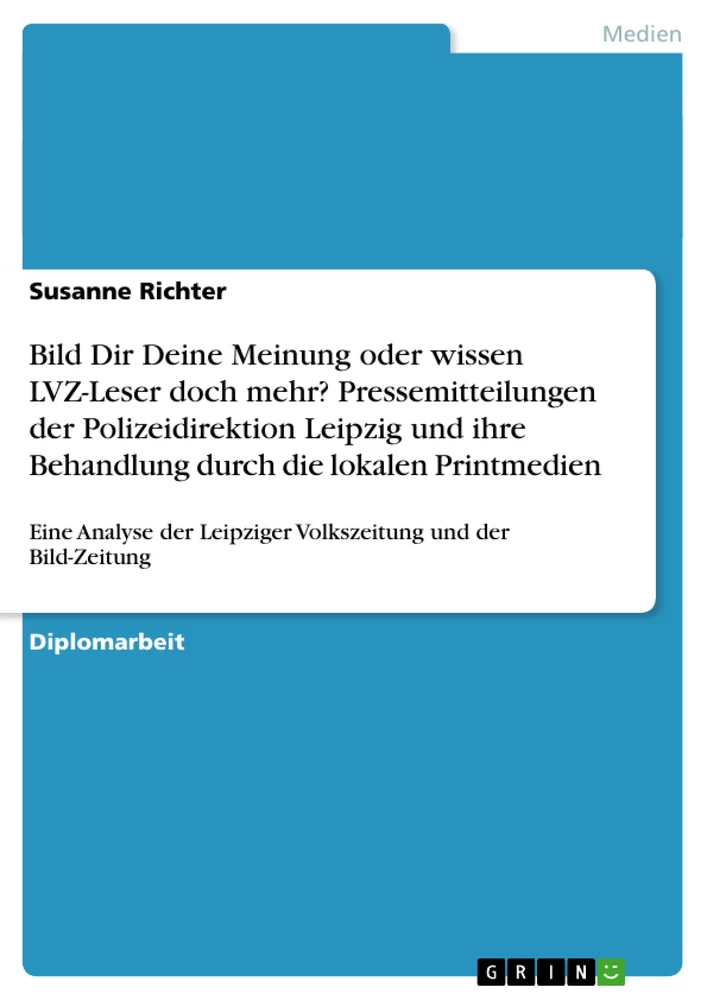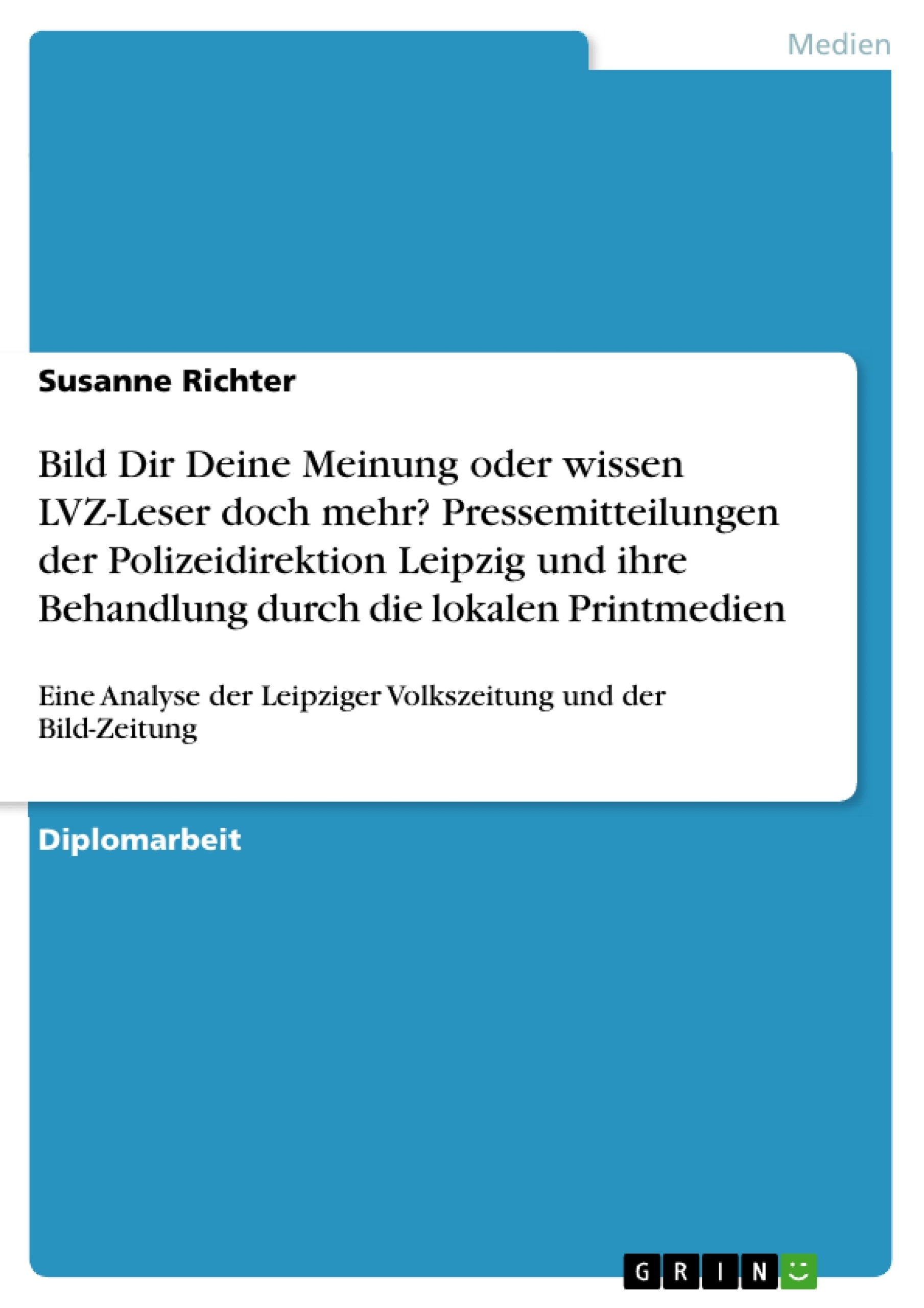1. Einleitung
1.1 Gegenstand der Arbeit
Nachrichtenagenturen, Public-Relations-Verlautbarungen beziehungsweise Pressemitteilungen2 und eigene Recherchen stellen jene Informationsquellen dar, derer sich Journalisten hauptsächlich bedienen. Nutzungsanteil und Nutzungsgrad sind dabei von Medium zu Medium und auch von Ressort zu Ressort meist sehr unterschiedlich. Der Mangel an finanziellen und redaktionellen Ressourcen, aber auch der Mangel an Zeit durch zusätzlich zu erledigende Aufgaben3 und das enorm gestiegene Informationsangebot schränken die Journalisten häufig ein. So bleibt ihnen weniger Zeit selbst zu recherchieren oder eigenständige Beiträge zu verfassen. Stattdessen greifen sie verstärkt auf die von außen angebotenen Texte zurück, selektieren, passen sie – entsprechend dem Zeitungstyp – inhaltlich, formal und stilistisch an, fassen zusammen und kürzen. Aus diesem Grund ist der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit von Behörden für den Journalismus sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht sehr wichtig. Die Zulieferung großer Mengen copyrightfreien Materials entlastet die Journalisten in ihrer täglichen Informationsbeschaffung und ist in einigen Ressorts sogar die Voraussetzung zur Aufrechterhaltung des journalistischen Betriebs geworden. Die Texte werden nicht nur von kommerziellen Unternehmen, Verbänden und Kulturbetrieben herausgegeben, sondern auch von Behörden, wie beispielsweise der Polizei.
In der Polizeidirektion Leipzig beschäftigen sich derzeit drei Mitarbeiter mit der Öffentlichkeits- bzw. Pressearbeit. Täglich geben sie zwischen drei und fünf Pressemeldungen an die Medien heraus, zahlreiche weitere Informationen werden telefonisch oder persönlich von Redakteuren und Mitarbeitern der Zeitungen sowie von Radio- und Fernsehsendern erfragt und später vorwiegend zu Meldungen, Nachrichten und Berichten verarbeitet. Was die Journalisten und ihre Leser, Hörer und Zuschauer vor allem interessiert, sind die schlechten Nachrichten, nach dem Motto: „Bad news are good news“. Ein Handtaschenraub hier, ein Wohnungseinbruch da, Zeugen hierfür gesucht, Hinweise dafür erbeten. Darauf, dass die Polizei mit solchen Pressemeldungen bzw. die Medien als deren Transporteur das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger beeinflussen, sei hier nur am Rande hingewiesen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Abkürzungsverzeichnis
- II. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
- III. Allgemeine Vorbemerkung
- IV. Danksagung
- 1. Einleitung
- 1.1 Gegenstand der Arbeit
- 1.2 Forschungsfrage und Zielsetzung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Das Verhältnis von Öffentlichkeitsarbeit und Journalismus
- 2.1 Der Forschungsstand: Ausgewählte Ansätze und Ergebnisse
- 2.1.1 Die Untersuchungen von Barbara Baerns und die Determinationshypothese
- 2.1.2 Weitere auf der Determinationshypothese basierende Studien
- 2.1.2.1 René Grossenbacher über die Transformationsleistungen der Journalisten
- 2.1.2.2 Romy Fröhlich und ihre Studie zum „qualitativen Einfluß von Pressearbeit auf die Berichterstattung“
- 2.1.2.3 Torsten Rossmanns Untersuchung zur „Öffentlichkeitsarbeit und ihrem Einfluß auf die Medien am Beispiel von Greenpeace“
- 2.1.2.4 „Aktivität und Passivität von Journalisten gegenüber Public Relations am Beispiel von Pressekonferenzen zu Umweltthemen“ – eine Analyse von Henrike Barth und Wolfgang Donsbach
- 2.1.2.5 Claudia Schweda und Rainer Opherden und ihre Untersuchung zu „Journalismus und Public Relations“
- 2.1.3 Die Weiterentwicklung der theoretischen Ansätze
- 2.1.3.1 Das Intereffikationsmodell von Bentele/Liebert/Seeling
- 2.2 Entwickelte Fragestellungen zur Beantwortung der Forschungsfrage
- 2.1 Der Forschungsstand: Ausgewählte Ansätze und Ergebnisse
- 3. Die Öffentlichkeitsarbeit der Polizeidirektion Leipzig
- 3.1 Die Öffentlichkeitsarbeit
- 3.1.1 Die Öffentlichkeitsarbeit nach innen
- 3.1.2 Die Öffentlichkeitsarbeit nach außen
- 3.2 Die Pressestelle und ihre Aufgaben
- 3.2.1 Die Polizei-Pressemitteilung
- 3.2.2 Besondere Anforderungen beim Schreiben einer Presseinformation
- 3.3 Aktive und reaktive Pressearbeit
- 3.4 Pressearbeit in besonderen Situationen
- 3.5 Das Verhältnis zwischen Medien und Pressestelle
- 3.1 Die Öffentlichkeitsarbeit
- 4. Methode und Auswahl des Untersuchungsmaterials
- 4.1 Auswahl der Zeitungen
- 4.2 Das Leitfadeninterview
- 4.3 Die Leipziger Volkszeitung
- 4.3.1.1 Ein kurzer historischer Abriss
- 4.3.1.2 Auflage, Reichweite und Leserkreis
- 4.3.1.3 Inhalt, Layout und Aufbau der LVZ
- 4.3.2 Die BILD-Zeitung
- 4.3.2.1 Die Geschichte der Boulevardzeitung
- 4.3.2.2 Auflage, Reichweite und Leserkreis
- 4.3.2.3 Themen, Methoden und Layout
- 4.4 Methodische Planung und Durchführung der Studie
- 4.4.1 Grundgesamtheit und Stichprobe
- 4.4.2 Das Kategoriensystem
- 4.4.3 Schwierigkeiten beim Erstellen des Kategoriensystems
- 4.4.4 Der Pretest
- 4.4.5 Gütekriterien der Messung
- 4.4.6 Codierung und Auswertung
- 5. Ergebnisse der Inhaltsanalyse
- 5.1 Organisationsdaten
- 5.1.1 Anzahl der von der Pressestelle ausgesendeten Meldungen pro Tag
- 5.1.2 Anzahl der von LVZ und BILD veröffentlichten Mitteilungen pro Tag
- 5.1.3 Veröffentlichung der Pressemitteilungen in LVZ und BILD
- 5.1.4 Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemeldungen in LVZ und BILD
- 5.2 Formale Ebene
- 5.2.1 Umfang der Überschriften der Pressemitteilungen und der Artikel in LVZ und BILD
- 5.2.2 Anzahl bzw. Art der Überschriften der Artikel in LVZ und BILD
- 5.2.3 Umfang der Texte der Pressemeldungen und der Artikel in LVZ und BILD
- 5.2.4 Form der Presseinformationen und der Artikel in LVZ und BILD
- 5.2.5 Redaktionelle Gewichtung der Artikel in LVZ und BILD
- 5.2.6 Darstellungsformen der Hauptbeiträge in LVZ und BILD
- 5.2.7 Typografische Hervorhebungen der Artikel in LVZ und BILD
- 5.2.8 Verhältnis von Text und Bild der Artikel in LVZ und BILD
- 5.2.9 Größe der Überschriften der Artikel in LVZ und BILD
- 5.3 Inhaltliche Ebene
- 5.3.1 Themen der Pressemeldungen und der Artikel in LVZ und BILD
- 5.3.2 Häufigkeit der Beantwortung der „W-Fragen“ in den Polizeipressemeldungen und in den Artikeln von LVZ und BILD
- 5.3.2.1 Beantwortung der „W-Fragen“ in den Artikeln im Vergleich zu den Pressemeldungen
- 5.3.2.2 Reihenfolge der „W-Fragen“ in den Artikeln im Vergleich zu den Pressemeldungen
- 5.3.3 Handelnde, die in den Pressemeldungen und in den Artikeln von LVZ und BILD genannt werden
- 5.3.3.1 Nennung der Handelnden in den Artikeln der LVZ und BILD im Vergleich zu den Pressemeldungen
- 5.3.3.2 Reihenfolge der Handelnden in den LVZ- und BILD-Artikeln im Vergleich zu den Polizeipressemeldungen
- 5.3.4 Nähere Angaben zum Täter/Tatverdächtigen in den Pressemeldungen und in den Beiträgen von LVZ und BILD
- 5.3.5 Nähere Angaben zum Opfer in der Pressemeldung und in der LVZ sowie in der BILD
- 5.3.6 Zitate in den Pressemitteilungen, in den Artikeln der LVZ und denen der BILD
- 5.3.6.1 Veränderungen der Zitate in den Artikeln der LVZ und der BILD im Vergleich zur Pressemitteilung
- 5.3.6.2 Anzahl der Zitate in den Artikeln der LVZ und der BILD im Vergleich zur Pressemeldung
- 5.3.6.3 Reihenfolge der Zitate in der LVZ und BILD im Vergleich zur Pressemeldung
- 5.3.7 Zusatzinformationen der Journalisten in den Artikeln von LVZ und BILD
- 5.3.8 Schwere des Deliktes in der Pressemitteilung und im Zeitungsbeitrag von LVZ und BILD
- 5.3.9 Quellennennung in den Artikeln von LVZ und BILD
- 5.3.10 Emotionalisierung in der Pressemitteilung und in der LVZ und BILD
- 5.3.10.1 Details der Emotionalisierung der Artikel in LVZ und BILD
- 5.3.11 Quantität der Übernahme durch die Journalisten
- 5.3.12 Qualität der Übernahme durch die Journalisten
- 5.3.13 Journalistische Standardisierung der Pressemitteilungen und der Zeitungsartikel
- 5.1 Organisationsdaten
- 6. Zusammenfassung und Überprüfung der Fragestellungen
- 7. Anhang
- 7.1 Transkripte der Leitfadeninterviews
- 7.1.1 Leitfadengespräch mit Birgit Schlegel
- 7.1.2 Leitfadengespräch mit Saskia Grätz
- 7.1.3 Leitfadengespräch mit Angela Wittig
- 7.2 Das Codebuch
- 7.2.1 Codeplan für die Pressemitteilungen
- 7.2.2 Codeplan für die Artikel in LVZ und BILD
- 7.2.3 Kommentar zu den Codeplänen
- 7.3 Gesetzestexte
- 7.3.1 Auszug der Grundrechte aus dem Grundgesetz
- 7.3.2 Auszug aus dem Sächsischen Gesetz über die Presse (SächsPresseG)
- 7.4 Übersicht zur Struktur der Polizeidirektion Leipzig
- 7.1 Transkripte der Leitfadeninterviews
- 8. Literatur- und Quellenverzeichnis
- 8.1 Primärquellen
- 8.2 Sekundärliteratur
- 8.3 Aufsätze aus Zeitschriften
- 8.4 Weitere Quellen
- 8.5 Internetadressen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Behandlung von Polizeipressemitteilungen durch die Leipziger Volkszeitung (LVZ) und die BILD-Zeitung. Die Arbeit zielt darauf ab, den Einfluss der Öffentlichkeitsarbeit der Polizeidirektion Leipzig auf die Berichterstattung dieser beiden Medien zu analysieren und Unterschiede in der Darstellung aufzuzeigen.
- Vergleichende Analyse der Berichterstattung von LVZ und BILD zu Polizeimeldungen.
- Untersuchung des Einflusses von Pressemitteilungen auf die journalistische Bearbeitung.
- Analyse der formalen und inhaltlichen Unterschiede in der Darstellung von Polizeimeldungen.
- Beurteilung der journalistischen Selektion und Transformation von Informationen.
- Bewertung des Verhältnisses zwischen Öffentlichkeitsarbeit der Polizei und Journalismus.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein, beschreibt den Gegenstand der Untersuchung – die Analyse der Berichterstattung von LVZ und BILD über Polizeipressemitteilungen – und formuliert die Forschungsfrage sowie die Zielsetzung der Arbeit. Der Aufbau der Arbeit wird ebenfalls skizziert, um dem Leser einen Überblick über den weiteren Verlauf zu geben. Die Einleitung legt den Fokus auf die Relevanz des Themas im Kontext des Verhältnisses von Öffentlichkeitsarbeit und Journalismus.
2. Das Verhältnis von Öffentlichkeitsarbeit und Journalismus: Dieses Kapitel beleuchtet den theoretischen Hintergrund der Arbeit, indem es verschiedene Ansätze und Ergebnisse aus der Forschung zum Verhältnis von Öffentlichkeitsarbeit und Journalismus zusammenfasst und diskutiert. Es werden unterschiedliche Modelle, wie die Determinationshypothese und das Intereffikationsmodell, vorgestellt und kritisch bewertet. Die Kapitel dient der fundierten Einordnung der eigenen Untersuchung in den bestehenden Forschungsstand.
3. Die Öffentlichkeitsarbeit der Polizeidirektion Leipzig: Dieses Kapitel beschreibt die Öffentlichkeitsarbeit der Polizeidirektion Leipzig, sowohl nach innen als auch nach außen. Es analysiert die Rolle der Pressestelle, ihre Aufgaben und die Anforderungen an die Erstellung von Pressemitteilungen. Die Unterscheidung zwischen aktiver und reaktiver Pressearbeit wird erläutert und das Verhältnis zwischen Medien und Pressestelle beleuchtet. Der Fokus liegt auf dem Kontext und den Rahmenbedingungen der untersuchten Pressemitteilungen.
4. Methode und Auswahl des Untersuchungsmaterials: Dieses Kapitel beschreibt die angewandte Methodik der Arbeit, insbesondere die Auswahl der Zeitungen (LVZ und BILD) und die Durchführung einer Inhaltsanalyse. Die Auswahlkriterien für die untersuchten Zeitungen werden dargelegt, ebenso wie das Vorgehen bei der Durchführung der Leitfadeninterviews mit Journalisten beider Zeitungen. Das Kapitel beschreibt detailliert die methodischen Schritte der Studie, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.
5. Ergebnisse der Inhaltsanalyse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Polizeipressemitteilungen und der entsprechenden Artikel in der LVZ und BILD. Es werden sowohl formale Aspekte wie Umfang, Überschriften und Layout, als auch inhaltliche Aspekte wie Themen, Zitate und Emotionalisierung der Berichterstattung verglichen und analysiert. Die Ergebnisse werden differenziert dargestellt, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Berichterstattung beider Zeitungen aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Polizeipressemitteilungen, Leipziger Volkszeitung (LVZ), BILD-Zeitung, Inhaltsanalyse, Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus, Medienberichterstattung, Determinationshypothese, Intereffikationsmodell, Transformation von Informationen, Selektion, Framing.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: "Analyse der Berichterstattung von Polizeipressemitteilungen in der Leipziger Volkszeitung und der BILD-Zeitung"
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Arbeit analysiert die Berichterstattung der Leipziger Volkszeitung (LVZ) und der BILD-Zeitung über Polizeipressemitteilungen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der beiden Medien und der Untersuchung des Einflusses der Öffentlichkeitsarbeit der Polizeidirektion Leipzig auf die jeweilige Darstellung.
Welche Forschungsfrage wird bearbeitet?
Die Arbeit untersucht, wie Polizeipressemitteilungen von der LVZ und der BILD-Zeitung aufgegriffen, verarbeitet und dargestellt werden. Es wird analysiert, inwieweit die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei die Berichterstattung beeinflusst und welche Unterschiede in der formalen und inhaltlichen Darstellung bestehen.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet eine Inhaltsanalyse von Polizeipressemitteilungen und den entsprechenden Artikeln in der LVZ und der BILD-Zeitung. Zusätzlich wurden Leitfadeninterviews mit Journalisten beider Zeitungen geführt, um den Prozess der Nachrichtenbearbeitung besser zu verstehen.
Welche Zeitungen wurden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf die Leipziger Volkszeitung (LVZ) und die BILD-Zeitung als repräsentative Beispiele für unterschiedliche journalistische Ausrichtungen.
Welche theoretischen Ansätze werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf relevante Theorien aus der Kommunikationswissenschaft, insbesondere die Determinationshypothese und das Intereffikationsmodell, um das Verhältnis zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Journalismus zu beleuchten.
Welche Aspekte der Berichterstattung wurden analysiert?
Die Analyse umfasst sowohl formale Aspekte (z.B. Umfang der Artikel, Überschriften, Layout) als auch inhaltliche Aspekte (z.B. Themenauswahl, Zitate, Emotionalisierung, Nennung von Handelnden, Quellennennung). Es wird untersucht, wie Informationen aus den Pressemitteilungen selektiert und transformiert werden.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse zeigen Unterschiede in der formalen und inhaltlichen Darstellung von Polizeimeldungen in der LVZ und der BILD-Zeitung auf. Es wird analysiert, wie die jeweilige journalistische Bearbeitung die Informationen aus den Pressemitteilungen verändert und welche journalistischen Strategien angewendet werden.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Literaturreview, Beschreibung der Methodik, Darstellung der Ergebnisse, Zusammenfassung und Schlussfolgerungen, sowie einen Anhang mit Transkripten der Interviews, dem Codebuch und weiteren Materialien.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Polizeipressemitteilungen, Leipziger Volkszeitung (LVZ), BILD-Zeitung, Inhaltsanalyse, Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus, Medienberichterstattung, Determinationshypothese, Intereffikationsmodell, Transformation von Informationen, Selektion, Framing.
Wo finde ich den vollständigen Inhaltsverzeichnis?
Das detaillierte Inhaltsverzeichnis mit allen Kapiteln und Unterkapiteln ist im HTML-Dokument enthalten.
- Quote paper
- Susanne Richter (Author), 2004, Bild Dir Deine Meinung oder wissen LVZ-Leser doch mehr? Pressemitteilungen der Polizeidirektion Leipzig und ihre Behandlung durch die lokalen Printmedien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38030