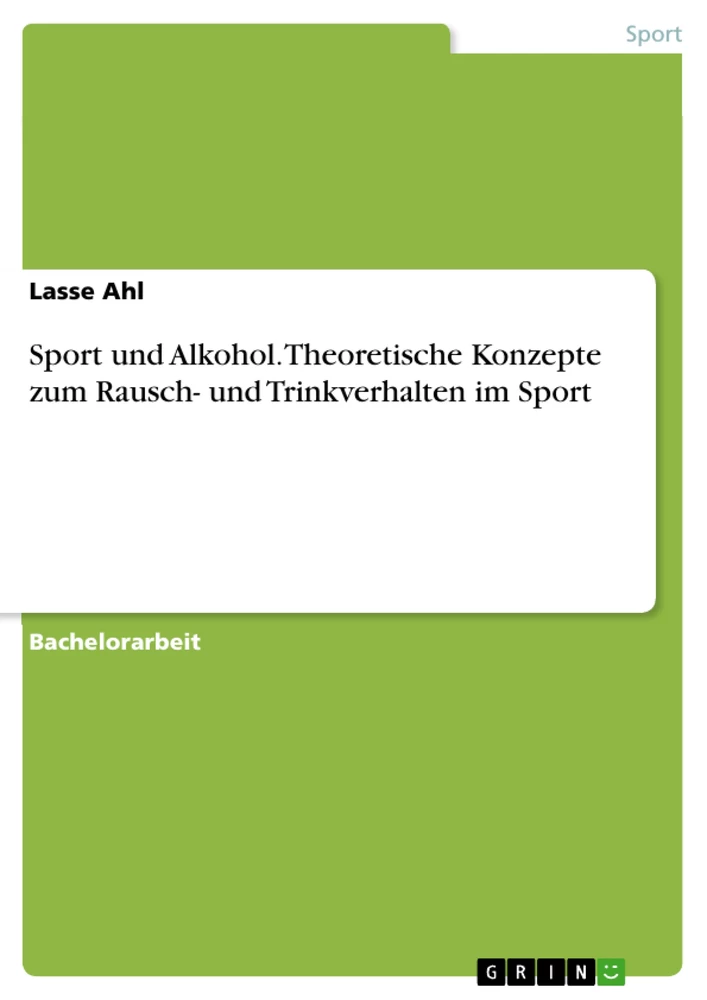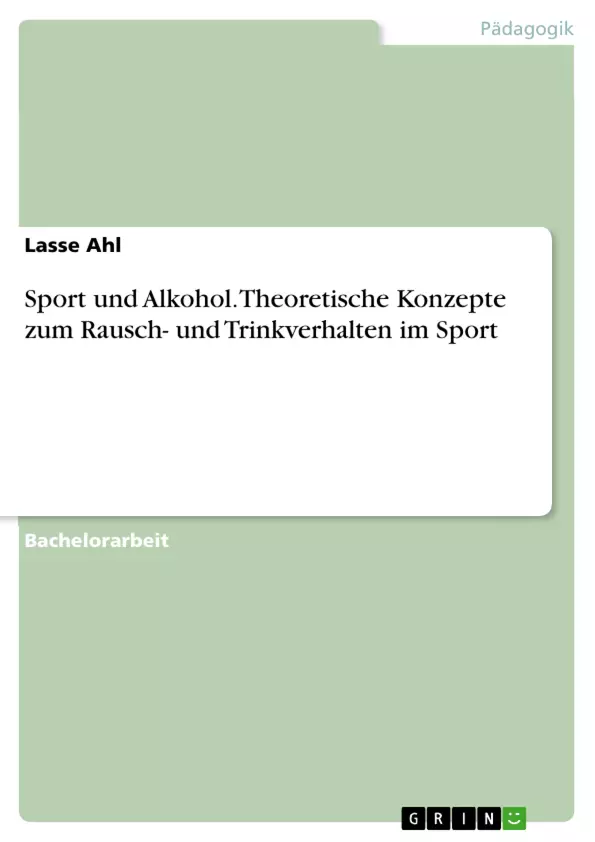Sport und Alkohol – das gilt in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals als Gegensatz. Doch insbesondere im Mannschaftssport scheint der Konsum von Alkohol weit verbreitet zu sein, vor allem der Fußball wird nicht selten im Zusammenhang mit dem exzessiven Konsum von Alkohol genannt. Bespiele aus dem Bereich der professionellen Spieler finden sich im Fußball allemal. Über Uli Borowka und Paul Gascoigne gibt es zahllose Anekdoten im Trinkkontext. James „Jimmy“ Greaves spritzte sich Wodka in die Orangen, die er mit zum Training nahm. Und George Best sagte einmal sinngemäß, dass er viel Geld für Alkohol, leichte Mädchen und schnelle Autos ausgegeben habe, den Rest habe er einfach „verprasst“. Doch auch auf Amateurebene scheint sportive Aktivität gepaart mit Alkoholkonsum zu sein. Ob bei Mannschaftsfeiern, Sportfesten oder der Siegesfeier nach einem gewonnen Spiel. Der obligatorische „Kasten Bier“ steht bei den meisten Mannschaftssportarten nach dem Spiel im Mittelpunkt der Kabine und des Interesses.
Die vorliegende Arbeit versucht die einzelnen Komponenten der theoretischen Konzepte des Rausch- und Trinkverhaltens im Sport zu detektieren und anschließend zusammenzuführen. Einleitend wird in Kapitel 2 die Terminologie des Alkoholbegriffs grob skizziert, um im Anschluss die für diese Arbeit essentielle, soziologisch-konstruktivistische Annahme der Wirklichkeitskonstruktion zu erläutern. In einem nächsten Schritt, dem Kapitel 3, muss dann eine kulturhistorische Einbettung des Rausch- und Trinkverhaltens der westlichen Hochkulturen vollzogen werden, da der Konsum von Alkohol in der europäischen Anthropologie als konstant erscheint. Kapitel 4 soll als Erklärung des Rauschzustandes in all seinen Merkmalen dienen, um den menschlichen Drang zum ‚veränderten‘ Bewusstsein erfassen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thematische Rahmenbedingungen
- Der Alkohol
- Der Begriff ,,Alkohol“
- Alkohol und seine physiologische Wirkung
- Die Konsumklassen
- Wirkungen des Alkohols auf den Sportler
- Die Konstruktion der Wirklichkeit
- Der (Drogen-) Rausch als Konstrukt
- Der Alkohol
- Kulturhistorische Einbettung
- Die Entdeckung des Alkohols
- Alkohol und Rauschzustände im Wandel der Geschichte
- (Drogen) Rausch in der Antike
- Der (Drogen-) Rausch im frühen Christentum
- Der (Drogen-) Rausch im Mittelalter
- Der Wandel der Vorstellungen von Rausch im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit
- Der (Drogen-) Rausch in der frühen Neuzeit
- Der (Drogen-) Rausch im 17. Und 18. Jahrhundert
- Der (Drogen-) Rausch im 19. Jahrhundert und die Erfindung der Sucht
- Der (Drogen-) Rausch im 20. Jahrhundert
- Zusammenfassende Bemerkungen und die „Rauschfeindlichkeit“ der westlichen Industriegesellschaft
- Rausch
- Definitionen und Auslöser von Rauschzuständen
- Definitionen - Der veränderte Bewusstseinszustand
- Auslöser und Ablauf von Rauschzuständen
- Das Rauscherleben
- Definitionen und Auslöser von Rauschzuständen
- Zum (jugendlichen) Risikoverhalten in der Risikogesellschaft
- Die Risikogesellschaft
- Das Aufwachsen in der Risikogesellschaft
- Risikoverhalten als Bewältigungsstrategie
- Kompetenzerwerb durch Risikoverhalten
- Der subjektive Nutzen jugendlichen Risikoverhaltens
- Sport, jugendliche Entwicklung und Alkoholkonsum
- Sport als Sozialisationsfeld
- Die sozial-integrative Kraft des Sports und der Rauschmittelkonsum
- Vergemeinschaftung und der Sportverein
- Der Sportverein und die Geselligkeit
- Individualsport vs. Mannschaftssport
- Unterschiede im Trinkverhalten
- Fußball, Vergemeinschaftung und der kollektive Rausch
- Gemeinschaft und Vergemeinschaftung
- Der Fußball und die Vergemeinschaftung
- Der kollektive Rausch
- Gemeinschaft und Vergemeinschaftung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die theoretischen Konzepte des Rausch- und Trinkverhaltens im Sport, insbesondere im Kontext des Mannschaftssports. Sie untersucht die Rolle des Alkohols als Rauschmittel und die Konstruktion der Wirklichkeit im Bereich des Sport- und Trinkverhaltens. Dabei wird die kulturhistorische Entwicklung des Rauschverhaltens in westlichen Kulturen betrachtet und das jugendliche Risikoverhalten im Kontext der Risikogesellschaft untersucht. Der Fokus liegt auf der Rolle des Sportvereins als soziales Umfeld für Alkoholkonsum und der Analyse des Vergemeinschaftungs- und Rauschphänomens im Fußball.
- Die Konstruktion des Rausch- und Trinkverhaltens im Sport
- Kulturhistorische Entwicklung des Rauschverhaltens in westlichen Kulturen
- Jugendliches Risikoverhalten im Kontext der Risikogesellschaft
- Der Sportverein als soziales Umfeld für Alkoholkonsum
- Vergemeinschaftung und kollektiver Rausch im Fußball
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die Verbindung von Sport und Alkohol, insbesondere im Mannschaftssport. Sie skizziert den weit verbreiteten Alkoholkonsum in diesem Bereich und beleuchtet Beispiele aus der professionellen und Amateur-Sportwelt.
- Thematische Rahmenbedingungen: Das Kapitel definiert den Begriff "Alkohol" und erläutert den soziologisch-konstruktivistischen Denkansatz der Wirklichkeitskonstruktion.
- Kulturhistorische Einbettung: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Rausch- und Trinkverhaltens in westlichen Kulturen von der Antike bis ins 20. Jahrhundert, beleuchtet die Rolle des Alkohols in verschiedenen Epochen und die Entstehung des Begriffs "Sucht".
- Rausch: Das Kapitel definiert Rauschzustände, erläutert ihre Auslöser und den Verlauf sowie das subjektive Rauscherleben.
- Zum (jugendlichen) Risikoverhalten in der Risikogesellschaft: Das Kapitel beschreibt die Risikogesellschaft, das Aufwachsen darin und das jugendliche Risikoverhalten als Bewältigungsstrategie. Es beleuchtet den Kompetenzerwerb durch Risikoverhalten und den subjektiven Nutzen des Alkoholkonsums.
- Vergemeinschaftung und der Sportverein: Dieses Kapitel untersucht den Sportverein als soziales Umfeld für Alkoholkonsum und die Unterscheidung zwischen Individual- und Mannschaftssportarten, wobei Unterschiede im Trinkverhalten beleuchtet werden.
- Fußball, Vergemeinschaftung und der kollektive Rausch: Das Kapitel beleuchtet die Verbindung von Fußball, Vergemeinschaftung und dem kollektiven Rausch, analysiert die Rolle des Fußballs als soziales Phänomen und untersucht die Dynamik des kollektiven Rauschzustandes im Fußballkontext.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Alkoholkonsum, Rauschverhalten, Sport, Vergemeinschaftung, Risikogesellschaft, Jugend, Fußball, Sportverein, Kulturgeschichte, Wirklichkeitskonstruktion und Sucht. Sie fokussiert auf die anthropologische und soziologische Perspektive des Rausch- und Trinkverhaltens im Kontext des Sportgeschehens.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Alkoholkonsum im Mannschaftssport so verbreitet?
Alkohol dient oft der Vergemeinschaftung, der Siegesfeier oder als ritueller Bestandteil der Geselligkeit im Sportverein, besonders im Fußball.
Wie wird der "Rausch" soziologisch eingeordnet?
Die Arbeit betrachtet den Rausch als soziologisch-konstruktivistisches Konstrukt der Wirklichkeitswahrnehmung und als Teil der menschlichen Anthropologie.
Welche Rolle spielt die "Risikogesellschaft" für jugendliche Sportler?
In einer Risikogesellschaft kann riskantes Trinkverhalten als Bewältigungsstrategie oder zum Kompetenzerwerb innerhalb einer Peer-Group dienen.
Gibt es Unterschiede im Trinkverhalten zwischen Individual- und Mannschaftssport?
Ja, die Arbeit untersucht, wie die soziale Dynamik in Mannschaften den Alkoholkonsum im Vergleich zu Einzelsportlern verstärkt.
Was ist mit dem "kollektiven Rausch" im Fußball gemeint?
Es beschreibt das Phänomen der emotionalen und physischen Entgrenzung innerhalb einer Gruppe, die durch gemeinsamen Erfolg und Alkoholkonsum verstärkt wird.
- Arbeit zitieren
- Lasse Ahl (Autor:in), 2015, Sport und Alkohol. Theoretische Konzepte zum Rausch- und Trinkverhalten im Sport, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380308