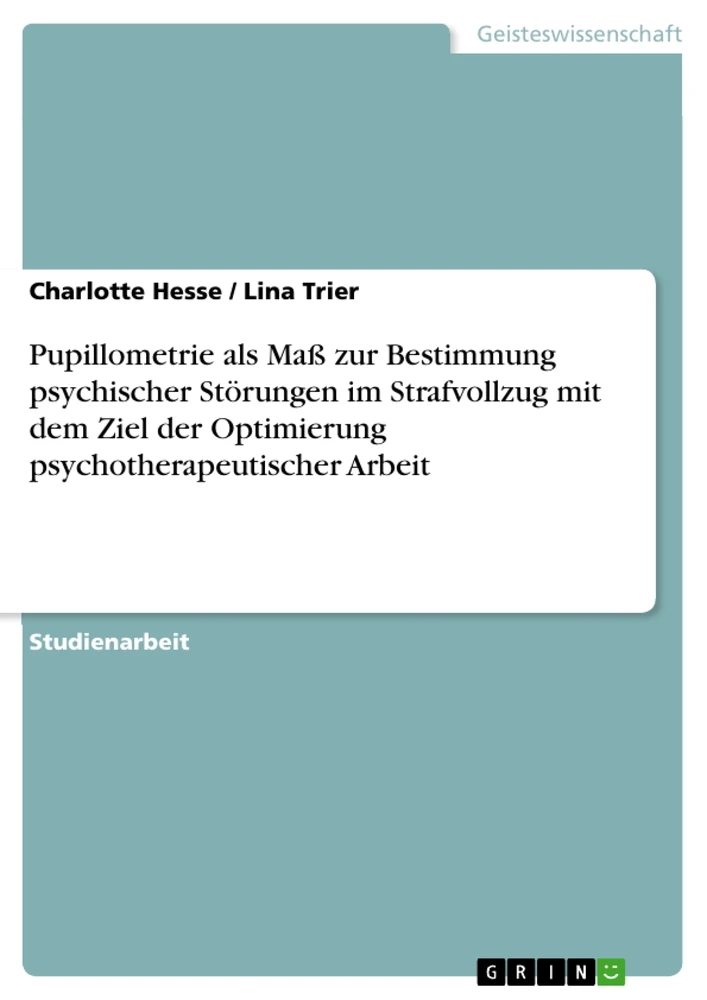Obgleich es sich um private, berufliche oder sonstige Situationen handelt, werden die Augen im Alltag oftmals als Spiegel der Seele bezeichnet. Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, diese mittels der Hinzuziehung des aktuellen Forschungsstandes im Bereich der Pupillometrie auf kognitive Prozesse anzuwenden.
Den Kernpunkt der Untersuchung, welche den Forschungsstand ergänzt, soll das soziale Umfeld einer Justizvollzugsanstalt bilden, welches durch eine hohe Belastung und Umstellung des Individuums intensive kognitive Prozesse hervorrufen kann. Konkret soll näher auf die Frage eingegangen werden, ob die Anwendung von Pupillometrie im Strafvollzug eine Arbeitsoptimierung in der psychologischen Diagnostik herbeiführen kann. Die Basis dieser Überlegung gründet zunächst auf dem Abstract ‚Pupillometry as a Measure of Cognitive Effort in Younger and Older Adults‘ von Piquardo, Isaacowitz und Wingfield aus dem Jahr 2010. Dieser belegt durch zwei Studien, dass kognitive Prozesse sich durch Pupillometrie abbilden lassen, was zu der Fragestellung inspiriert, inwiefern sich dies im Rahmen des Umganges mit Straftätern zur (Früh-)Erkennung von Störungsbildern anwenden lässt.
Zu Beginn werden die allgemeinen Grundzüge der Pupillometrie vertieft, wobei sich die Arbeit auf den allgemeinen Forschungsstand, Vorgehensweisen bei Messungen und auf die Leistungen von Pupillometrie in klinischer Psychologie und Forensik konzentriert. Im Rahmen des Forschungsstandes wird auch oben genannter Abstract als Hauptgrundlage ausführlich thematisch vertieft.
Um weitere nötige Grundlagen für diese Arbeit herauszuarbeiten, werden im folgenden Kapitel psychische Störungen im Strafvollzug thematisiert. Die Abschnitte begründen sich hierbei jeweils auf die meist frequentierten Störungen und Verhaltensauffälligkeiten und deren Ursachen, auf die Diagnostik im Strafvollzug und darauf folgend insbesondere deren Arbeitsabläufe, sowie die Problematik psychotherapeutischer Arbeit im Rahmen einer Justizvollzugsanstalt. Im vierten Kapitel soll nun ein Zusammenschluss der beiden vorhergegangenen Kapitel auf Basis der Fragestellung geleistet werden: Es soll untersucht werden, ob aufgrund des bestehenden Kenntnisstandes eine Optimierung der Arbeit im psychotherapeutischen Bereich geleistet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Pupillometrie
- 2.1. Allgemeiner Forschungsstand zu Pupillometrie und Kognition
- 2.2. Vorgehensweisen und Messungen
- 2.3. Leistung von Pupillometrie in der klinischen Psychologie und Forensik
- 3. Psychische Störungen und klinische Psychologie im Strafvollzug
- 3.1. meist frequentierte Störungsbilder und Verhaltensauffälligkeiten im Strafvollzug
- 3.2. Diagnostik im Strafvollzug
- 3.3. Problematik von psychotherapeutischer Arbeit im Strafvollzug
- 4. Zweckmäßige Utilisierung von Pupillometrie im Rahmen einer Vollzugsanstalt
- 4.1. Stilisierung der Störungsbilder und Verhaltensauffälligkeiten, bei welchen Pupillometrie Anwendung finden kann.
- 4.2. resultierende Arbeitsoptimierung im Psychotherapeutischen Bereich durch Pupillometrie
- 5. Fazit
- 6. Quellenverzeichnis
- 7. Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die Anwendung der Pupillometrie auf kognitive Prozesse im sozialen Umfeld einer Justizvollzugsanstalt zu untersuchen. Der Fokus liegt darauf, ob die Pupillometrie im Strafvollzug die Arbeitsoptimierung in der psychologischen Diagnostik fördern kann. Die Arbeit analysiert den aktuellen Forschungsstand im Bereich der Pupillometrie und beleuchtet die Problematik von psychischen Störungen und der psychotherapeutischen Arbeit im Strafvollzug.
- Anwendung der Pupillometrie im Strafvollzug
- Arbeitsoptimierung in der psychologischen Diagnostik
- Kognitive Prozesse im Strafvollzug
- Psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten
- Psychotherapeutische Arbeit im Strafvollzug
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Zielsetzung vor. Sie diskutiert, wie die Pupillometrie im Strafvollzug zur Optimierung der psychotherapeutischen Arbeit beitragen kann. Die Einleitung basiert auf der Erkenntnis, dass kognitive Prozesse durch die Pupillometrie abgebildet werden können, und erörtert, ob diese Erkenntnis für die (Früh-)Erkennung von Störungsbildern bei Straftätern nutzbar ist.
Kapitel 2: Pupillometrie Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die Pupillometrie als Messmethode. Es umfasst eine Definition, den allgemeinen Forschungsstand, die Messmethoden und die Leistung der Pupillometrie in der klinischen Psychologie und Forensik. Das Kapitel analysiert insbesondere das Paper "Pupillometry as a Measure of Cognitive Effort in Younger and Older Adults" von Piquardo, Isaacowitz und Wingfield, das die Basis für die Fragestellung der Arbeit bildet.
Kapitel 3: Psychische Störungen und klinische Psychologie im Strafvollzug Dieses Kapitel behandelt die Besonderheiten von psychischen Störungen im Strafvollzug. Es beleuchtet die häufigsten Störungsbilder und Verhaltensauffälligkeiten, die Diagnostik im Strafvollzug und die Problematik der psychotherapeutischen Arbeit im Strafvollzug. Das Kapitel untersucht die Ursachen für psychische Störungen im Strafvollzug und die Herausforderungen, die sich aus der spezifischen Umgebung des Strafvollzugs ergeben.
Kapitel 4: Zweckmäßige Utilisierung von Pupillometrie im Rahmen einer Vollzugsanstalt Dieses Kapitel verbindet die Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln, um die Anwendung der Pupillometrie im Strafvollzug zu untersuchen. Es identifiziert Störungsbilder, bei denen die Pupillometrie Anwendung finden könnte, und diskutiert, wie die Pupillometrie die Arbeit im psychotherapeutischen Bereich optimieren kann.
Schlüsselwörter
Pupillometrie, Strafvollzug, psychische Störungen, psychotherapeutische Arbeit, kognitive Prozesse, Diagnostik, Arbeitsoptimierung, Störungsbilder, Verhaltensauffälligkeiten, Forschungsstand, klinische Psychologie, Forensik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Pupillometrie?
Pupillometrie ist die Messung der Pupillengröße und deren Veränderung als Reaktion auf kognitive Anstrengung oder emotionale Reize.
Wie kann Pupillometrie im Strafvollzug helfen?
Sie könnte zur (Früh-)Erkennung von psychischen Störungen und kognitiven Belastungen bei Straftätern genutzt werden, um die psychologische Diagnostik zu optimieren.
Welche kognitiven Prozesse lassen sich über die Augen ablesen?
Studien belegen, dass die Pupillenweite direkt mit dem kognitiven Aufwand korreliert, den eine Person für eine Aufgabe oder in einer Belastungssituation aufbringt.
Warum ist die psychotherapeutische Arbeit im Gefängnis schwierig?
Herausforderungen sind das belastende soziale Umfeld, die hohe Frequenz an Störungsbildern und die spezifischen institutionellen Rahmenbedingungen einer JVA.
Welche Störungsbilder sind im Strafvollzug besonders häufig?
Die Arbeit thematisiert häufig frequentierte psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten, die bei Inhaftierten auftreten.
Bietet Pupillometrie Vorteile gegenüber klassischen Tests?
Da die Pupillenreaktion weitgehend unbewusst erfolgt, könnte sie objektivere Daten liefern als rein verbale Befragungen, die manipulierbar sein können.
- Quote paper
- Charlotte Hesse (Author), Lina Trier (Author), 2016, Pupillometrie als Maß zur Bestimmung psychischer Störungen im Strafvollzug mit dem Ziel der Optimierung psychotherapeutischer Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380411