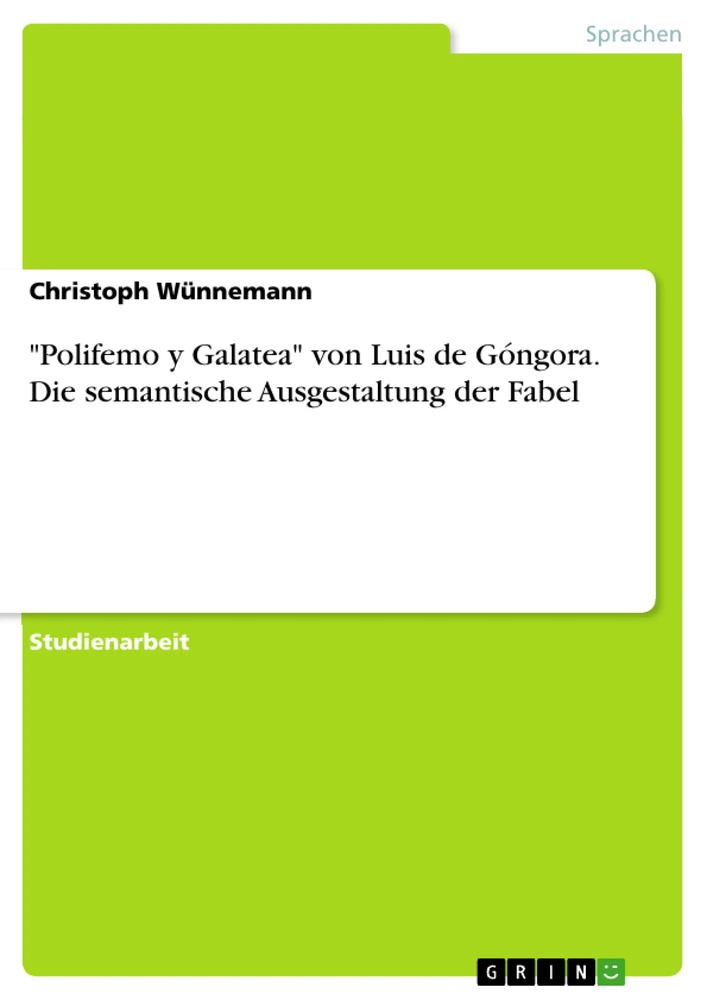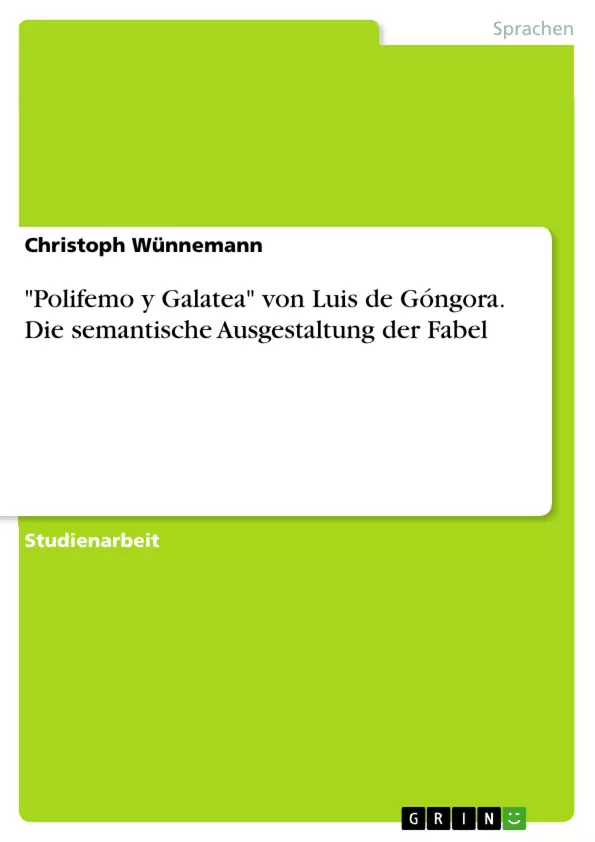Die Fabel "Polifemo y Galatea", die im Todesjahr ihres Autors herausgegeben wurde, gilt als eines der bedeutendsten Werke von Luis de Góngora y Argote (1561-1627). Wie für Fabeln aus dem 17. Jahrhundert üblich, bezieht sich dieses Werk auf Inhalte, die aus der griechisch-römischen Mythologie stammen.
In diesem Fall wird der Mythos um den Zyklopen Poly-phem, der Nymphe Galateia sowie dem Jüngling Akis nacherzählt. Im Zuge dieser Nacherzählung lässt Góngora viele inhaltliche Ähnlichkeiten zu der Darstellung des römischen Ge-schichtsschreibers Ovid erkennen, der diese Geschichte ebenfalls in den von ihm stammenden Metamorphosen beschreibt, sodass von einer bewussten Bezugnahme auf diese ausgegangen werden kann.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Inhalt dieser Fabel und dessen semantische Ausgestaltung zu erschließen, um diese frühneuzeitliche literarische Darstellung in ihrer Bedeutsamkeit im Allgemeinen und in ihrem literaturwissenschaftlichen Wert im Besonderen ansatzweise nachvollziehen zu können. Dabei sollen zum einen die rhetorischen Figuren, derer sich Góngora bedient, analysiert und zum anderen die intertextuellen Inhalte erschlossen werden, auf die er Bezug nimmt. Aus Platzgründen verzichtet diese Arbeit auf eine umfassende Analyse der strukturellen und syntaktischen Ausgestaltung dieser Fabel und beschränkt sich auf exemplarische Kurzbemerkungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die semantische und inhaltliche Ausgestaltung des „Polifemo“
- Beschreibung Polyphems sowie dessen Heimat
- Beschreibung Galateias und ihrer Wirkung auf andere
- Auftritt und Beschreibung des Akis
- Das Liebesspiel zwischen Akis und Galateia
- Der Gesang des Polyphem
- Die Entdeckung des Liebespaares und Tod des Akis
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, den Inhalt der Fabel „Polifemo y Galatea“ sowie dessen semantische Ausgestaltung zu erschließen. Sie soll die Bedeutsamkeit dieser frühneuzeitlichen literarischen Darstellung im Allgemeinen und ihren literaturwissenschaftlichen Wert im Besonderen aufzeigen. Dazu werden die rhetorischen Figuren, die Góngora verwendet, analysiert und die intertextuellen Inhalte erschlossen, auf die er Bezug nimmt.
- Die semantische und inhaltliche Ausgestaltung der Fabel
- Die rhetorischen Figuren, die Góngora verwendet
- Die intertextuellen Bezüge auf Ovids Metamorphosen
- Die Bedeutung des Arkadien-Motivs in der Fabel
- Die Darstellung von Liebe, Tod und Dichtung im Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Fabel „Polifemo y Galatea“ von Luis de Góngora ein und stellt die Zielsetzung der Arbeit sowie die wichtigsten Themen vor. Anschließend wird die semantische und inhaltliche Ausgestaltung der Fabel analysiert, wobei die Beschreibung Polyphems und seiner Heimat, sowie die Beschreibung Galateias und des Akis im Mittelpunkt stehen. Des Weiteren werden das Liebesspiel zwischen Akis und Galateia und der Gesang des Polyphem beleuchtet.
Schlüsselwörter
Fabel, Luis de Góngora, „Polifemo y Galatea“, Ovid, Metamorphosen, Arkadien, Liebe, Tod, Dichtung, Rhetorik, Intertextualität, semantische Ausgestaltung.
- Arbeit zitieren
- Christoph Wünnemann (Autor:in), 2016, "Polifemo y Galatea" von Luis de Góngora. Die semantische Ausgestaltung der Fabel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380419