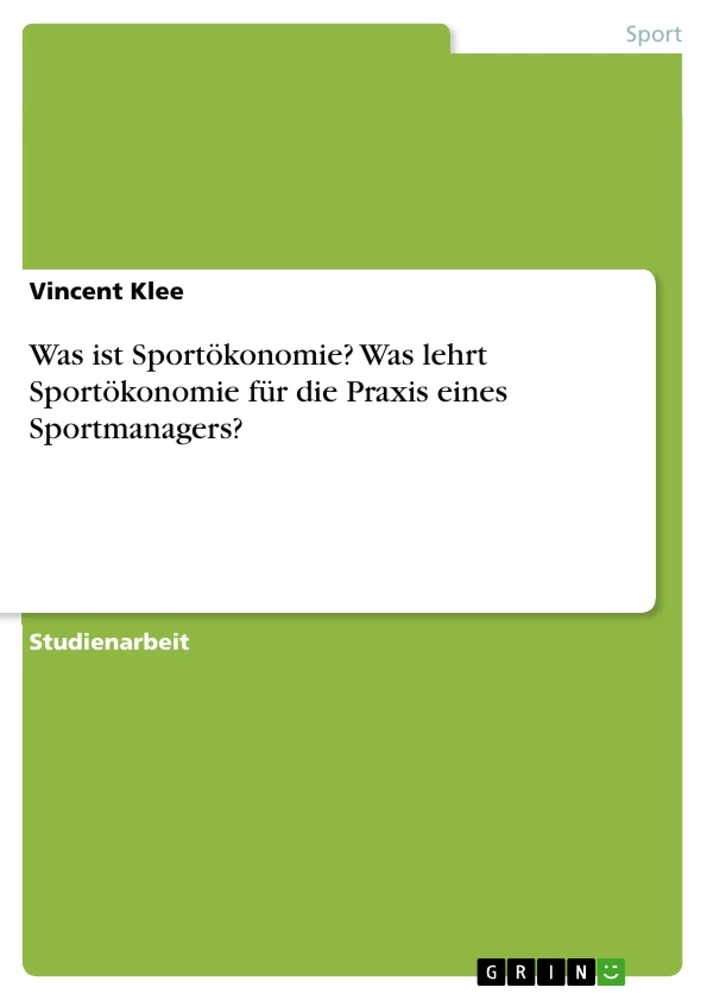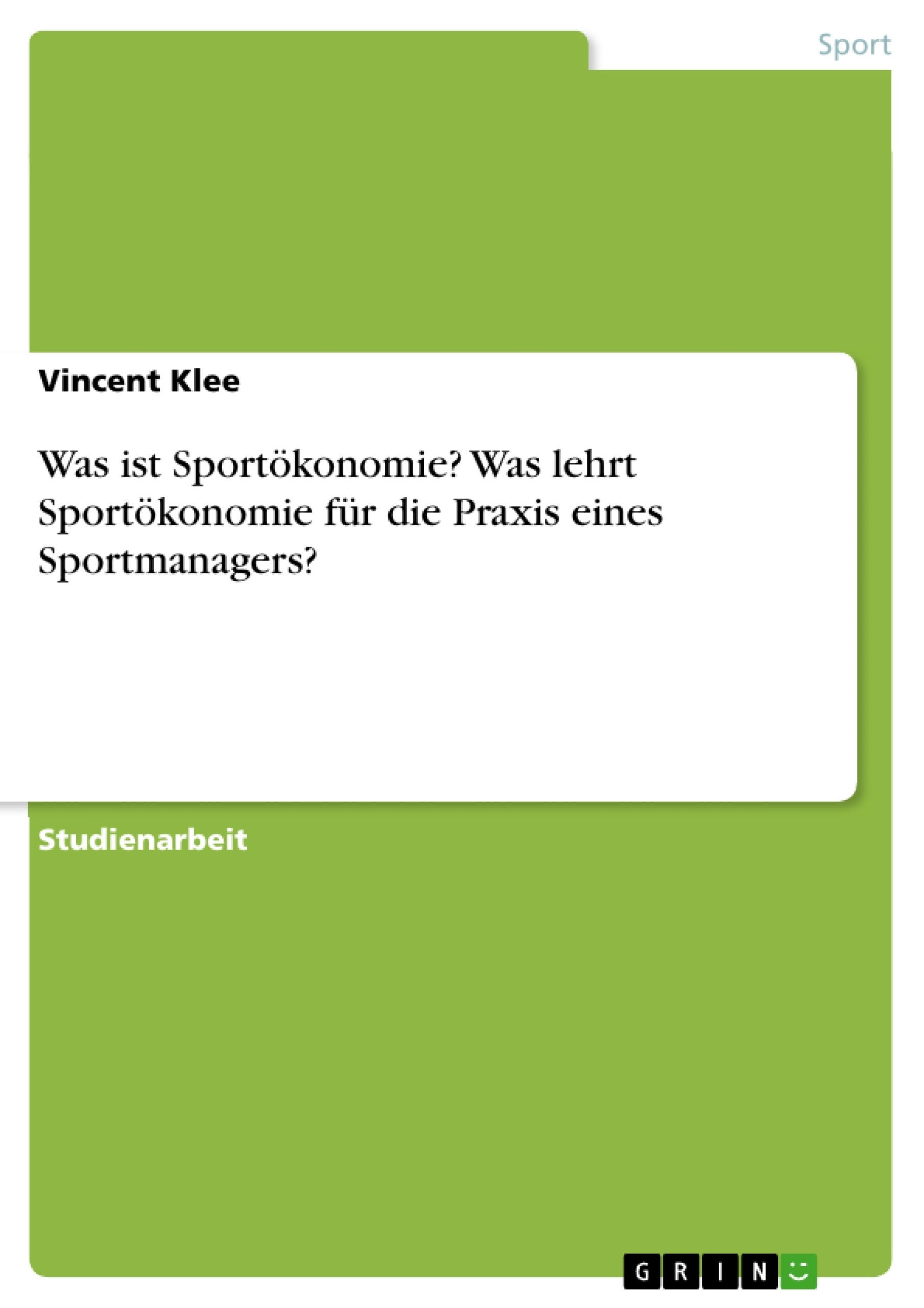Die beiden Hauptfragen, die in dieser Arbeit bestmöglich beantwortet werden sollen lauten: Was ist Sportökonomie? Was lehrt Sportökonomie für die Praxis eines Sportmanagers?
Bevor aber auf diese Fragen eingegangen werden kann, müssen zunächst einige wirtschaftliche Begriffe wie beispielsweise Ökonomie, Güter oder auch wirtschaftliche (ökonomische) Prinzipien und Herangehensweisen geklärt und erläutert werden. Es
folgt unteranderem die Definition des Begriffes Sport, indem schon ökonomische Aspekte integriert sind um es dem Leser zu vereinfachen. Da schon die Beantwortung der Frage „Was ist Sport“ unterschiedliche Meinungen aufwirft, werden zwangsläufig auch Probleme und Fragezeichen später bei der Erläuterung „Was ist Sportökonomie?“ auftreten.
Deswegen wird, wenn man auf Grundlage der ersten Frage die zweite Frage beantwortet natürlich weitere Unterschiede deutlich, vor allem im Bereich des Managers im Zusammenhang mit Sport und seinen Besonderheiten. In diesem Zusammenhang kann man sich auch die Frage stellen weit sich der Sportmanager von dem allgemeinen BWL`er unterscheidet.
Da die Ökonomie und vor allem die Sportökonomie kein starres Modell, sondern in der Praxis auf dem Markt angewendet werden, ist es notwendig, die erste Frage vor der zweiten zu beantworten. So sollen Missverständnisse und Unklarheiten
vermieden werden. Zu Beginn meiner Arbeit werde ich allerdings kurz den aktuellen Wissensstand und bereits stattgefundene Forschungsergebnisse zur Thematik darlegen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Fragestellung und Zielsetzung
- 1.1. Wissensstand und historische Entwicklung
- 2. Begriffserklärung
- 2.1. Sport
- 2.2. Ökonomie
- 2.2.1. Ökonomisches Prinzip
- 2.3. Sportökonomie
- 2.3.1. Grafik Sportökonomie
- 3. Besonderheiten des Sports
- 3.1. Präferenzbildung und Nachfrage
- 3.2. Produkte
- 3.3. Institutionelle Arrangements
- 4. Sportmanagement
- 4.1. Wichtigkeit des Sportmanagers
- 5. Fazit
- 5.1. Was ist Sportökonomie?
- 5.2. Was lehrt Sportökonomie für die Praxis eines Sportmanagers?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Sportökonomie und ihre Bedeutung für Sportmanager. Sie klärt den Begriff der Sportökonomie und beleuchtet die relevanten ökonomischen Prinzipien im Kontext des Sports. Die Arbeit analysiert zudem die Besonderheiten des Sports im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen.
- Definition und historische Entwicklung der Sportökonomie
- Ökonomische Prinzipien und ihre Anwendung im Sport
- Besonderheiten des Sportmarktes (Nachfrage, Produkte, Institutionen)
- Die Rolle des Sportmanagers im ökonomischen Kontext
- Unterschied zwischen Sportmanagement und allgemeiner Betriebswirtschaftslehre
Zusammenfassung der Kapitel
1. Fragestellung und Zielsetzung: Dieses Kapitel führt die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: Was ist Sportökonomie und welche Bedeutung hat sie für die Praxis eines Sportmanagers? Es wird die Vorgehensweise der Arbeit skizziert und die Notwendigkeit der Klärung grundlegender wirtschaftlicher Begriffe vor der Auseinandersetzung mit der Sportökonomie begründet. Die Notwendigkeit einer Abgrenzung vom allgemeinen Wissenstand wird hervorgehoben, um Missverständnisse zu vermeiden.
1.1. Wissensstand und historische Entwicklung: Der Abschnitt beleuchtet die junge Disziplin der Sportökonomie und deren historische Entwicklung. Er erwähnt frühe Arbeiten wie die von Rottenberg (1956) in den USA und den späteren, zögerlichen Beginn der Auseinandersetzung mit der Sportökonomie in Deutschland. Der Text beschreibt die zunehmende Kommerzialisierung des Sports ab den 1980er Jahren und die damit verbundene verstärkte Forschungsaktivität. Die Arbeit verweist auf unterschiedliche Forschungsansätze und den weiterhin bestehenden Bedarf an weiterer Forschung auf diesem Gebiet.
2. Begriffserklärung: Das Kapitel widmet sich der Definition der Kernbegriffe "Sport" und "Ökonomie". Es wird die Vielschichtigkeit und die Abhängigkeit des Begriffs "Sport" von verschiedenen Perspektiven (Alter, Geschlecht, Kultur) hervorgehoben. Die Definition von Ökonomie als Volkswirtschaftslehre wird erläutert, wobei die Knappheit von Ressourcen als zentrales Element betont wird. Der Abschnitt bereitet den Leser auf die anschließende Verknüpfung beider Begriffe in der Sportökonomie vor.
3. Besonderheiten des Sports: Dieser Abschnitt beleuchtet die Besonderheiten des Sports als Wirtschaftsbereich. Die Präferenzbildung und Nachfrage im Sport, die spezifischen Produkte des Sportmarktes sowie die institutionellen Arrangements werden untersucht und im Kontext der Sportökonomie analysiert. Der Fokus liegt darauf, die Unterschiede zwischen dem Sportmarkt und anderen Wirtschaftsbereichen herauszuarbeiten.
4. Sportmanagement: Dieses Kapitel analysiert den Beruf des Sportmanagers und dessen Bedeutung im Kontext der Sportökonomie. Es wird die Wichtigkeit des Sportmanagers im Hinblick auf die ökonomischen Aspekte des Sports beleuchtet und der Sportmanager von einem allgemeinen Betriebswirtschaftler abgegrenzt. Der Abschnitt betont den fachübergreifenden Charakter des Sportmanagements und dessen Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Sportökonomie, Sportmanagement, Ökonomische Prinzipien, Sportmarkt, Nachfrage, Produkte, Institutionen, Ressourcenknappheit, Kommerzialisierung des Sports, historische Entwicklung, BWL, VWL
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Sportökonomie
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über die Sportökonomie. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselbegriffe. Der Text beleuchtet die Definition und historische Entwicklung der Sportökonomie, ökonomische Prinzipien im Sport, Besonderheiten des Sportmarktes, die Rolle des Sportmanagers und den Unterschied zwischen Sportmanagement und allgemeiner Betriebswirtschaftslehre.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte des Textes?
Der Text untersucht die Sportökonomie und ihre Bedeutung für Sportmanager. Er klärt den Begriff der Sportökonomie, beleuchtet relevante ökonomische Prinzipien im Sportkontext und analysiert die Besonderheiten des Sports im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen. Die zentralen Themen sind die Definition und historische Entwicklung der Sportökonomie, ökonomische Prinzipien im Sport, Besonderheiten des Sportmarktes (Nachfrage, Produkte, Institutionen) und die Rolle des Sportmanagers.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text gliedert sich in mehrere Kapitel: Kapitel 1 behandelt die Fragestellung und Zielsetzung sowie den Wissensstand und die historische Entwicklung der Sportökonomie. Kapitel 2 erklärt die Begriffe "Sport" und "Ökonomie". Kapitel 3 analysiert die Besonderheiten des Sports als Wirtschaftsbereich (Präferenzbildung, Nachfrage, Produkte, Institutionen). Kapitel 4 befasst sich mit dem Sportmanagement und der Rolle des Sportmanagers. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen und beantwortet die zentralen Fragen nach der Definition der Sportökonomie und ihrer Bedeutung für Sportmanager.
Welche Besonderheiten des Sports werden im Text hervorgehoben?
Der Text betont die Besonderheiten der Präferenzbildung und Nachfrage im Sport, die spezifischen Produkte des Sportmarktes und die institutionellen Arrangements. Es wird deutlich gemacht, dass der Sportmarkt sich in vielen Aspekten von anderen Wirtschaftsbereichen unterscheidet.
Welche Rolle spielt der Sportmanager laut diesem Text?
Der Text hebt die Bedeutung des Sportmanagers im ökonomischen Kontext des Sports hervor. Er betont den fachübergreifenden Charakter des Sportmanagements und die Notwendigkeit, ökonomische Prinzipien zu verstehen. Der Sportmanager wird von einem allgemeinen Betriebswirtschaftler abgegrenzt.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text behandelt?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Sportökonomie, Sportmanagement, Ökonomische Prinzipien, Sportmarkt, Nachfrage, Produkte, Institutionen, Ressourcenknappheit, Kommerzialisierung des Sports, historische Entwicklung, BWL, VWL.
Was ist der Unterschied zwischen Sportmanagement und allgemeiner Betriebswirtschaftslehre laut diesem Text?
Der Text hebt den fachübergreifenden Charakter des Sportmanagements hervor und betont, dass es sich um mehr als nur die Anwendung allgemeiner betriebswirtschaftlicher Prinzipien handelt. Die spezifischen Besonderheiten des Sportmarktes erfordern ein spezielles Wissen und Können, das über die allgemeine Betriebswirtschaftslehre hinausgeht.
Welche Bedeutung hat die historische Entwicklung der Sportökonomie für den Text?
Die historische Entwicklung der Sportökonomie wird im Text als Kontextualisierung der heutigen Situation dargestellt. Sie zeigt den Wandel vom eher unkommerzialisierten Sport hin zu einem professionell und wirtschaftlich organisierten Sektor und begründet die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit den spezifischen ökonomischen Aspekten des Sports.
- Arbeit zitieren
- Vincent Klee (Autor:in), 2017, Was ist Sportökonomie? Was lehrt Sportökonomie für die Praxis eines Sportmanagers?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380428