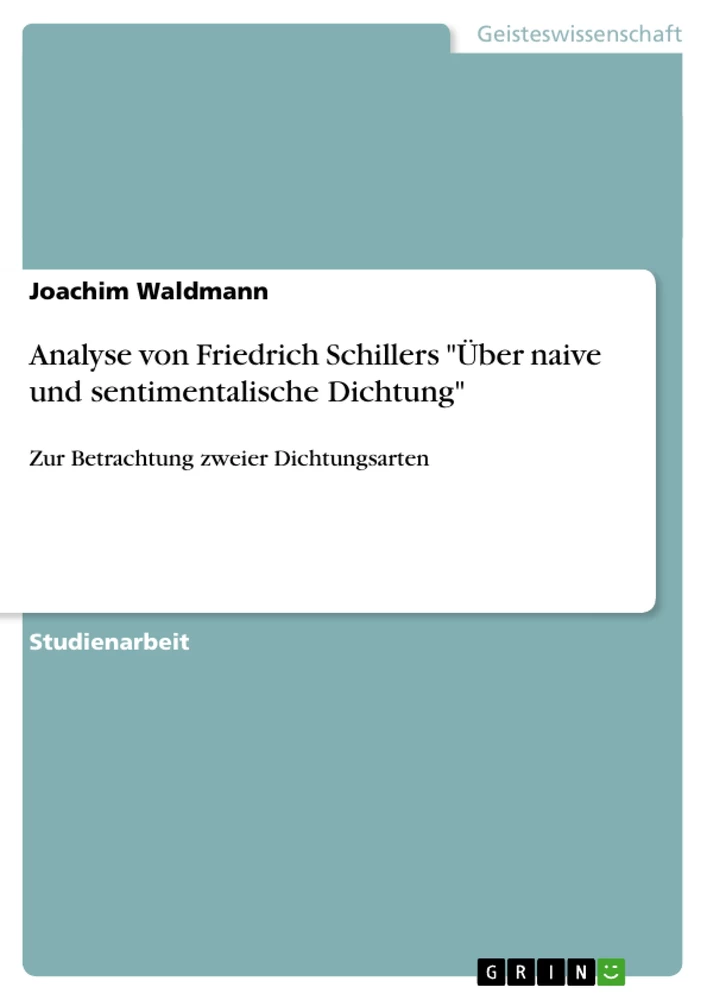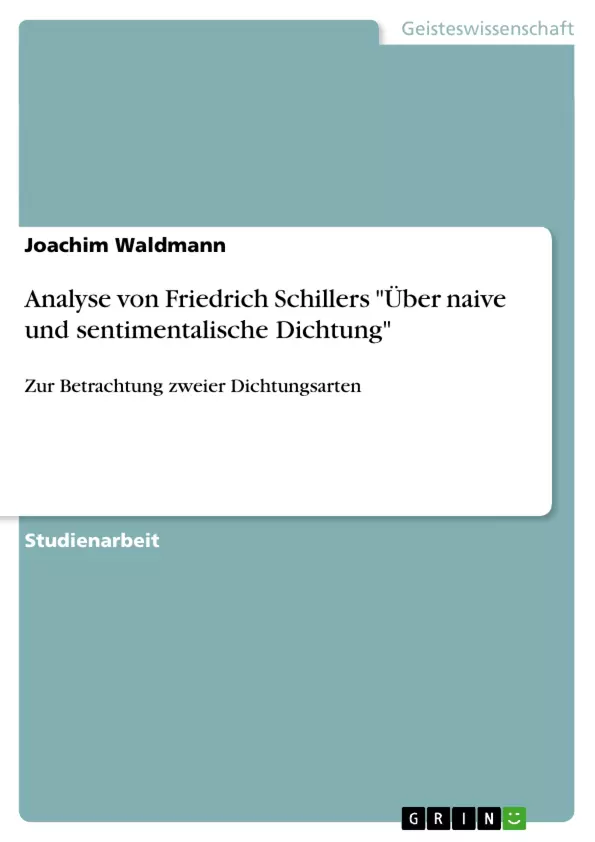Den Unterschied, den Schiller zwischen naivem und sentimentalischem Dichter macht, scheint vor allem darin zu liegen, dass der naive sich selbst – als Subjekt – nicht in das Werk einbringt. Zumindest merkt man als Leser an keiner Stelle, dass da ein Medium zwischen Wirklichkeit und geschriebenem Kunstwerk eingeschaltet ist. Es ist dabei irrelevant, ob der naive Dichter wirklich unreflektiert zu Werke ging oder ob er im Gegenteil äußerst bewusst daran arbeitete. Hauptsache ist, dass der Leser nichts von dem Dichter als Subjekt bemerkt. Der naive Dichter hält es also – aus welchen Gründen auch immer – nicht für notwendig, sich selbst kommentierend in sein Werk zu integrieren.
Der sentimentalische Dichter hingegen kommentiert die Wirklichkeit, die er abbildet. Er tritt hinter seinem Werk hervor. Als Bedingung besteht für Schiller, dass er der Wirklichkeit ein Ideal entgegenstellt. Die unterschiedliche Gewichtung zwischen Wirklichkeit und Ideal in einem Werk entscheidet, ob es sich um eine Satire, eine Elegie oder eine Idylle handelt.
Gegen Ende seiner Schrift kommt Schiller schließlich zum Ergebnis, das der vollendete Dichter naive und sentimentalische Eigenschaften in seiner Person vereinen muss.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Die Teilung der Welt in Gegensatzpaare
- 2. Das Gefühl des Naiven
- 2.1. Das Naive der Überraschung
- 2.2. Zwischenbemerkung
- 2.3. Das Naive der Gesinnung
- 3. Der Begriff des Genies
- 4. Der moderne Mensch und die alten Griechen
- 5. Naive und sentimentalische Dichtung
- 5.1. Der naive Dichter
- 5.2. Zwischenbemerkung
- 5.3. Der sentimentalische Dichter
- 6. Satire, Elegie und Idylle
- 6.1. Satire
- 6.2. Elegie
- 6.3. Idylle
- 7. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Schillers Abhandlung „Über naive und sentimentalische Dichtung“ untersucht die beiden zentralen Dichtungsformen und ihre Unterschiede. Die Schrift beleuchtet das Verhältnis von Natur und Kunst, die Rolle des Genies und den Gegensatz zwischen Antike und Moderne. Der Vergleich mit Goethe und die Auseinandersetzung mit Klopstock und Kleist ergänzen die Analyse.
- Unterscheidung naiver und sentimentalischer Dichtung
- Das Verhältnis von Natur und Kunst
- Der Begriff des Genies und seine Bedeutung
- Der Gegensatz zwischen Antike und Moderne
- Schillers eigene Position als sentimentalischer Dichter im Vergleich zu Goethe als naivem Dichter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Schiller führt in seiner Abhandlung die Unterscheidung zwischen naiver und sentimentalischer Dichtung ein. Er deutet die weiteren Themen an, die er behandeln wird, darunter den Begriff des Genies, die Kritik an zeitgenössischen Dichtern und die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Antike und Moderne. Die Beziehung zu Goethe, der als Beispiel für einen naiven Dichter dient, wird als wichtiger Aspekt der Analyse hervorgehoben.
2. Das Gefühl des Naiven: Schiller beschreibt hier das Wesen des Naiven, das aus einem interesselosen Staunen über die Natur entsteht. Die Natur wird als Urzustand der Einheit und Harmonie dargestellt, der im Gegensatz zur Kunst steht. Das Naive wird als moralisches Gefühl charakterisiert, das durch den Widerspruch zwischen dem Urteil der Vernunft und des Verstandes entsteht. Es verbindet kindliche Einfalt mit dem Bewusstsein der verlorenen Unschuld und der Sehnsucht nach Harmonie. Schiller unterscheidet zwischen dem naiven der Überraschung und dem naiven der Gesinnung.
2.1 Das Naive der Überraschung: Dieser Abschnitt präzisiert das Naive der Überraschung. Es erfordert einen Willen, der die Natur verleugnen kann, um deren unverfälschte Erscheinung als beschämendes Gegenstück zur Künstlichkeit zu offenbaren. Die Natur muss die Kunst zurechtweisen und die Wahrheit der Natürlichkeit gegenüber der Unwahrheit des Gekünstelten zeigen.
2.2 Zwischenbemerkung: In diesem Abschnitt wirft Schiller selbstkritische Fragen auf. Er hinterfragt die Grundlage seiner eigenen Überzeugung von der moralischen Natur der Natur und die Zuverlässigkeit seiner Beurteilungskriterien. Es stellt sich die Frage nach der Objektivität seiner ästhetischen Wertmaßstäbe und der Willkürlichkeit seiner Beurteilungen von naivem Verhalten im Vergleich zu bloßer Dummheit.
Häufig gestellte Fragen zu Schillers "Über naive und sentimentalische Dichtung"
Was ist der Hauptgegenstand von Schillers Abhandlung "Über naive und sentimentalische Dichtung"?
Schillers Abhandlung untersucht die beiden zentralen Dichtungsformen, die naive und die sentimentalische Dichtung, und deren Unterschiede. Sie beleuchtet das Verhältnis von Natur und Kunst, die Rolle des Genies und den Gegensatz zwischen Antike und Moderne.
Welche Themen werden in Schillers Abhandlung behandelt?
Die Abhandlung behandelt die Unterscheidung zwischen naiver und sentimentalischer Dichtung, das Verhältnis von Natur und Kunst, den Begriff des Genies und seine Bedeutung, den Gegensatz zwischen Antike und Moderne und Schillers eigene Position als sentimentalischer Dichter im Vergleich zu Goethe als naivem Dichter. Zusätzlich werden Satire, Elegie und Idylle als literarische Gattungen betrachtet.
Wie unterscheidet Schiller naive und sentimentalische Dichtung?
Schiller beschreibt das Naive als ein interesseloses Staunen über die Natur, das aus einem Urzustand der Einheit und Harmonie entsteht. Im Gegensatz dazu steht die sentimentale Dichtung, die sich der Vermittlung von Gefühlen und Emotionen bedient und die Distanz zur Natur reflektiert. Die naive Dichtung ist gekennzeichnet durch die unmittelbare Darstellung der Natur, während die sentimentale Dichtung die Natur durch die Brille der Reflexion und des Gefühls betrachtet.
Welche Rolle spielt der Begriff des Genies in Schillers Abhandlung?
Der Begriff des Genies ist zentral für Schillers Analyse. Er untersucht die Fähigkeiten und Eigenschaften des genialen Dichters, sowohl im naiven als auch im sentimentalen Kontext. Das Genie wird als Fähigkeit gesehen, die Natur auf einzigartige Weise darzustellen oder die Gefühle auf ergreifende Art und Weise auszudrücken.
Wie wird das Verhältnis von Natur und Kunst in der Abhandlung dargestellt?
Das Verhältnis von Natur und Kunst ist ein zentrales Thema. Schiller sieht die naive Dichtung als Ausdruck der unmittelbaren Natur, während die sentimentale Dichtung eine vermittelte, reflektierte Beziehung zur Natur aufweist. Die Kunst versucht, die Harmonie der Natur wiederherzustellen oder zumindest auszudrücken, die im sentimentalen Zustand verloren gegangen ist.
Welche Bedeutung hat der Vergleich zwischen Antike und Moderne in Schillers Abhandlung?
Der Vergleich zwischen Antike und Moderne dient Schiller als Grundlage für seine Unterscheidung zwischen naiver und sentimentalischer Dichtung. Er sieht die Antike als die Epoche des Naiven, während die Moderne durch die Reflexion und die Distanz zur Natur gekennzeichnet ist. Dieser Gegensatz ist jedoch nicht als absolute Gegenüberstellung zu verstehen, sondern als ein Kontinuum.
Welche Autoren werden in der Abhandlung erwähnt und wie werden sie eingeordnet?
Die Abhandlung erwähnt Goethe als Beispiel für einen naiven Dichter, im Gegensatz zu Schiller selbst, der sich als sentimentaler Dichter versteht. Weitere Autoren wie Klopstock und Kleist werden im Kontext der Analyse erwähnt und hinsichtlich ihrer Einordnung in die Kategorien der naiven oder sentimentalischen Dichtung diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Abhandlung und worum geht es in ihnen?
Die Abhandlung gliedert sich in mehrere Kapitel, beginnend mit einer Einleitung, die das Thema einführt. Es folgt eine detaillierte Beschreibung des "Gefühls des Naiven", unterteilt in verschiedene Abschnitte, gefolgt von Kapiteln über den Begriff des Genies, den modernen Menschen und die alten Griechen, naive und sentimentalische Dichtung, Satire, Elegie und Idylle und abschliessend eine Schlussbemerkung. Jedes Kapitel vertieft spezifische Aspekte der naiven und sentimentalischen Dichtung.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Abhandlung wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Naive Dichtung, Sentimentale Dichtung, Genie, Natur, Kunst, Antike, Moderne, Harmonie, Reflexion, Gefühl, Satire, Elegie, Idylle.
- Citation du texte
- Joachim Waldmann (Auteur), 2004, Analyse von Friedrich Schillers "Über naive und sentimentalische Dichtung", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38051