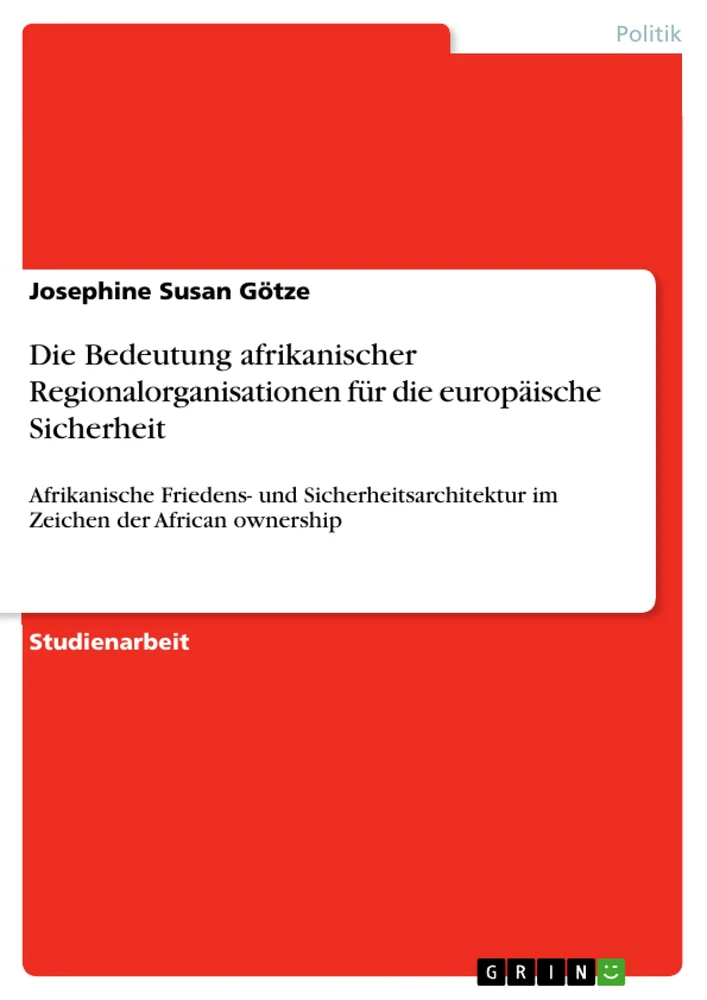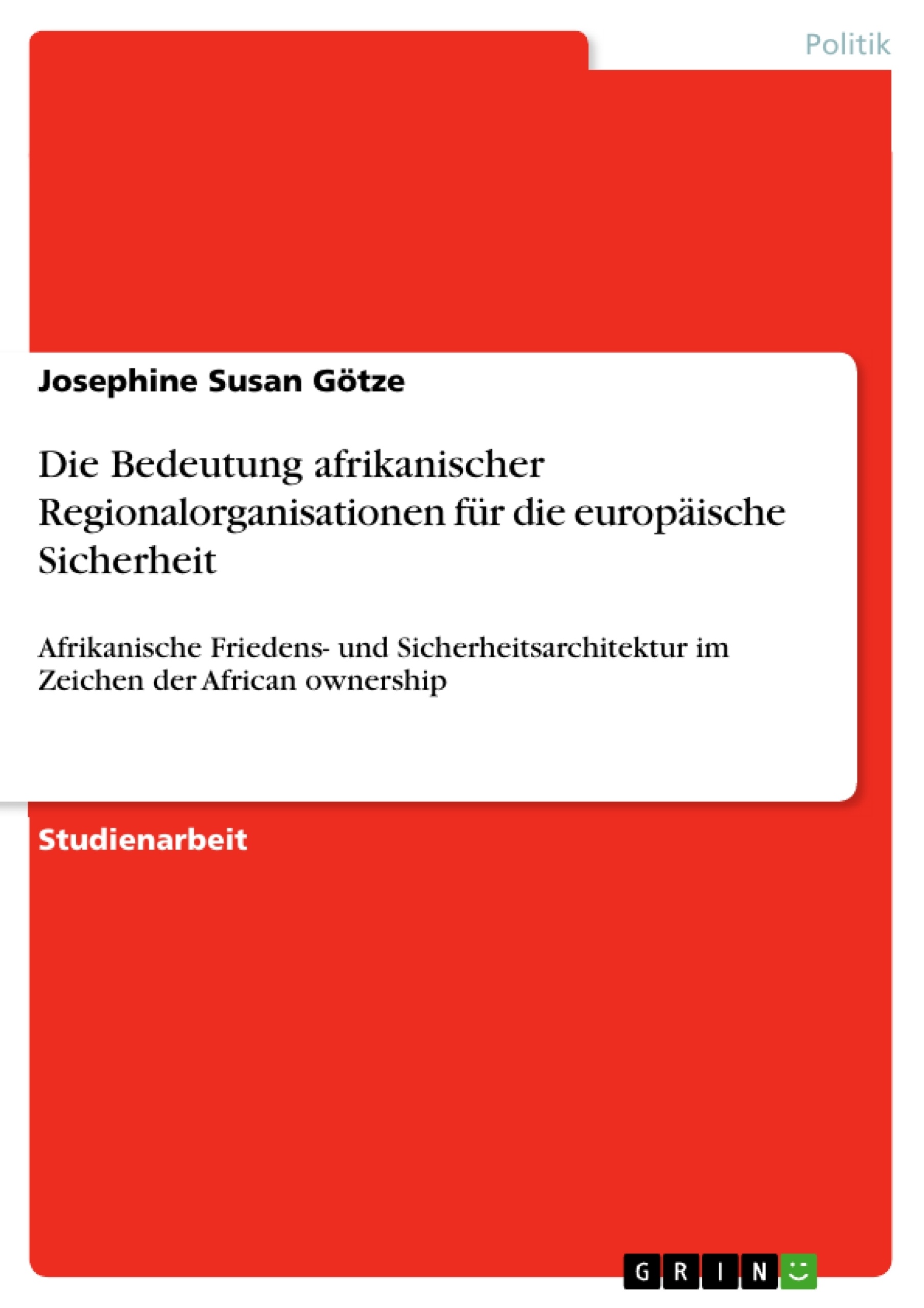In den 1990er Jahren war Afrika Schauplatz schwerer gewaltsamer innerstaatlicher und regionaler Konflikte, die die internationale Gemeinschaft wiederholt zu militärischen und humanitären Interventionen veranlasste. Die relative Entspannung der sicherheitspolitischen Lage und die Ereignisse vom 11 September 2001 führten jedoch zu einer nur kurzzeitigen Abkehr vom Kontinent, denn nicht erst seit der Flüchtlingskrise 2015 weiß man in der EU, dass gewaltsame Auseinandersetzungen und Instabilität in Afrika direkte und indirekte Auswirkungen auf die europäische Sicherheit haben.
Für die Bewältigung ihrer in der ESS von 2003 genannten globale Herausforderungen und Bedrohungen können (sub-)regionale Akteure in anderen Weltregionen relevant sein. In Afrika, dem am meisten von Konflikten und Instabilität gekennzeichneten Kontinent, übernehmen seit Längerem unterschiedliche Sicherheitsorganisationen auf regionaler, wie die AU, und auf subregionaler Ebene, wie beispielsweise die ECOWAS und die IGAD, eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Frieden, Sicherheit und Stabilität. Die potenzielle Bedeutung, die die von der AU 2004 geschaffene und die (sub-)regionalen Organisationen zusammenführende Afrikanische Friedens- und Sicherheitsarchitektur (AFSA) für die europäische Sicherheit hat, darf daher nicht unterschätzt werden.
Das Erkenntnisinteresse der Arbeit besteht in der Analyse der Bedeutung der AFSA und der sie integrierenden (sub-)regionalen Akteure für die europäische Sicherheit. Die Forschungsfrage lautet daher: „Welche Rolle spielt die AFSA und die sie formierenden (sub-)regionalen sicherheitspolitischen Akteure für die europäische Sicherheit?“. Grundlage der Analyse sind theoretische Betrachtungen zum (neo-)liberalen Institutionalismus, der die zentrale Rolle von Institutionen in den internationalen Beziehungen anerkennt.
An den darauffolgenden Teil zur verwendeten Methodik schließt sich die Vorstellung der in der ESS formulierten europäischen Sicherheitsinteressen an, die als Referenzpunkte zur Bewertung der AFSA und der (sub-)regionalen Akteure dienen sollen. Im Analyseteil soll nach einer Darstellung der AFSA anhand von drei Beispielen (Somalia, Sudan und Mal) gezeigt werden, inwieweit die (sub-)regionalen Akteure Hauptbedrohungen der europäischen Sicherheit bekämpfen konnten. Im Anschluss an die Diskussion der Stärken und Schwächen der AFSA und ihre Relevanz für die EU sollen in den Schlussbetrachtungen Handlungsempfehlungen für die EU gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie
- 3. Methode
- 4. Europäische Sicherheitsinteressen und (Sub-)Regionale Organisationen
- 5. Die Bedeutung von Regionalorganisationen für die Europäische Sicherheit: Afrikanische Sicherheitsarchitektur im Zeichen des African Ownership
- 5.1 Die Afrikanische Friedens- und Sicherheitsarchitektur: Institutioneller Aufbau, Akteure und African ownership-Prinzip
- 5.2 Peacekeeping in Afrika seit 2003: Afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme?
- 5.2.1 Von der subregionalen zu regionalen Ebene: IGAD (IGASOM-Mission) und AU (AMISOM) in Somalia
- 5.2.2 Von der regionalen zur globalen Ebene: AU (AMIS-Mission) und UN (UNMIS-Hybridmission) im Sudan
- 5.2.3 Von der subregionalen zur regionalen und globalen Ebene: ECOWAS (MICEMA-Mission), AU (AFISMA-Mission) und UN (MINUSMA-Mission) in Mali
- 5.3 Diskussion: Bilanz zur Afrikanischen Sicherheitsarchitektur und Relevanz für die EU
- 6. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Bedeutung der Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur (AFSA) und ihrer (sub-)regionalen Akteure für die europäische Sicherheit. Die zentrale Forschungsfrage untersucht die Rolle der AFSA und ihrer beteiligten Organisationen für die europäische Sicherheit. Der (neo-)liberale Institutionalismus dient als theoretischer Rahmen. Die Analyse basiert auf Fallstudien, die die Effektivität der AFSA bei der Bekämpfung von Sicherheitsbedrohungen in Afrika untersuchen.
- Die Rolle der AFSA in der afrikanischen Sicherheitslandschaft
- Der Einfluss (sub-)regionaler Organisationen auf die europäische Sicherheit
- Analyse von Fallstudien in Somalia, Sudan und Mali
- Bewertung der Stärken und Schwächen der AFSA
- Handlungsempfehlungen für die EU
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext afrikanischer Konflikte und deren Auswirkungen auf die europäische Sicherheit. Sie hebt die wachsende Bedeutung regionaler Organisationen wie der Afrikanischen Union (AU) und subregionaler Organisationen wie ECOWAS und IGAD hervor und führt die Forschungsfrage ein, die sich mit der Rolle der AFSA und ihrer Akteure für die europäische Sicherheit beschäftigt. Der (neo-)liberale Institutionalismus wird als theoretischer Rahmen vorgestellt. Der Aufbau der Arbeit, mit Theorie, Methodik, Analyse von Fallbeispielen und Schlussfolgerungen, wird skizziert.
2. Theorie: Dieses Kapitel befasst sich mit dem (neo-)liberalen Institutionalismus als theoretischem Fundament der Arbeit. Es erklärt die zentralen Annahmen des Ansatzes und seine Relevanz für die Untersuchung zwischenstaatlicher Kooperation im Sicherheitsbereich, insbesondere in Bezug auf die Rolle von Institutionen wie der AFSA und (sub-)regionalen Organisationen bei der Bewältigung gemeinsamer Sicherheitsherausforderungen. Die Argumentation zielt darauf ab zu zeigen, wie diese Institutionen Transaktionskosten reduzieren und die Erwartungsverlässlichkeit der Kooperation erhöhen können, was positive Auswirkungen auf die europäische Sicherheit haben kann.
3. Methode: Dieses Kapitel erläutert die gewählte Forschungsmethode: eine qualitative Fallstudie mit einem Most Similar Systems Design (MSSD). Es beschreibt die Auswahl der Fallbeispiele (Somalia, Sudan und Mali) und begründet die Auswahl anhand der Ähnlichkeiten der Fälle und der Unterschiede in den Interventionen von (sub-)regionalen und internationalen Akteuren. Die Methode dient dazu, die Faktoren zu identifizieren, die die europäische Sicherheit beeinflussen, indem sie die Auswirkungen der AFSA und ihrer Akteure in den ausgewählten Fällen analysiert.
4. Europäische Sicherheitsinteressen und (Sub-)Regionale Organisationen: Dieses Kapitel stellt die europäischen Sicherheitsinteressen dar, die als Referenzpunkte für die Bewertung der AFSA und ihrer (sub-)regionalen Akteure dienen. Es beschreibt die Herausforderungen und Bedrohungen, denen sich die EU gegenübersieht und wie (sub-)regionale Akteure in Afrika zur Bewältigung dieser Herausforderungen beitragen können.
Schlüsselwörter
Afrikanische Friedens- und Sicherheitsarchitektur (AFSA), (Sub-)Regionale Organisationen, Europäische Sicherheit, (Neo-)liberaler Institutionalismus, Peacekeeping, Somalia, Sudan, Mali, Konfliktbearbeitung, EU-Afrika-Beziehungen, African Ownership.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Die Bedeutung der Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur für die Europäische Sicherheit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Bedeutung der Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur (AFSA) und ihrer (sub-)regionalen Akteure für die europäische Sicherheit. Die zentrale Forschungsfrage untersucht die Rolle der AFSA und ihrer beteiligten Organisationen für die europäische Sicherheit.
Welcher theoretische Rahmen wird verwendet?
Der (neo-)liberale Institutionalismus dient als theoretischer Rahmen für die Analyse.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Fallstudie mit einem Most Similar Systems Design (MSSD). Die Fallbeispiele sind Somalia, Sudan und Mali.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Theoriekapitel, ein Methodenkapitel, ein Kapitel zu europäischen Sicherheitsinteressen und (sub-)regionalen Organisationen, ein Kapitel zur Afrikanischen Sicherheitsarchitektur mit Fallstudien zu Somalia, Sudan und Mali, und Schlussbetrachtungen.
Welche Fallstudien werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Interventionen der AFSA und ihrer Akteure in Somalia, Sudan und Mali, um die Effektivität der AFSA bei der Bekämpfung von Sicherheitsbedrohungen zu untersuchen.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle der AFSA in der afrikanischen Sicherheitslandschaft, den Einfluss (sub-)regionaler Organisationen auf die europäische Sicherheit, die Stärken und Schwächen der AFSA und Handlungsempfehlungen für die EU.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Afrikanische Friedens- und Sicherheitsarchitektur (AFSA), (Sub-)Regionale Organisationen, Europäische Sicherheit, (Neo-)liberaler Institutionalismus, Peacekeeping, Somalia, Sudan, Mali, Konfliktbearbeitung, EU-Afrika-Beziehungen, African Ownership.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext und die Forschungsfrage erläutert. Es folgen Kapitel zur Theorie, Methodik, europäischen Sicherheitsinteressen und (sub-)regionalen Organisationen sowie eine detaillierte Analyse der Fallstudien. Die Arbeit schließt mit Schlussbetrachtungen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die Bedeutung der AFSA für die europäische Sicherheit zu analysieren und Handlungsempfehlungen für die EU zu formulieren.
Wo finde ich das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis befindet sich am Anfang des Dokuments und listet alle Kapitel und Unterkapitel auf.
- Arbeit zitieren
- B.A. Josephine Susan Götze (Autor:in), 2017, Die Bedeutung afrikanischer Regionalorganisationen für die europäische Sicherheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380669