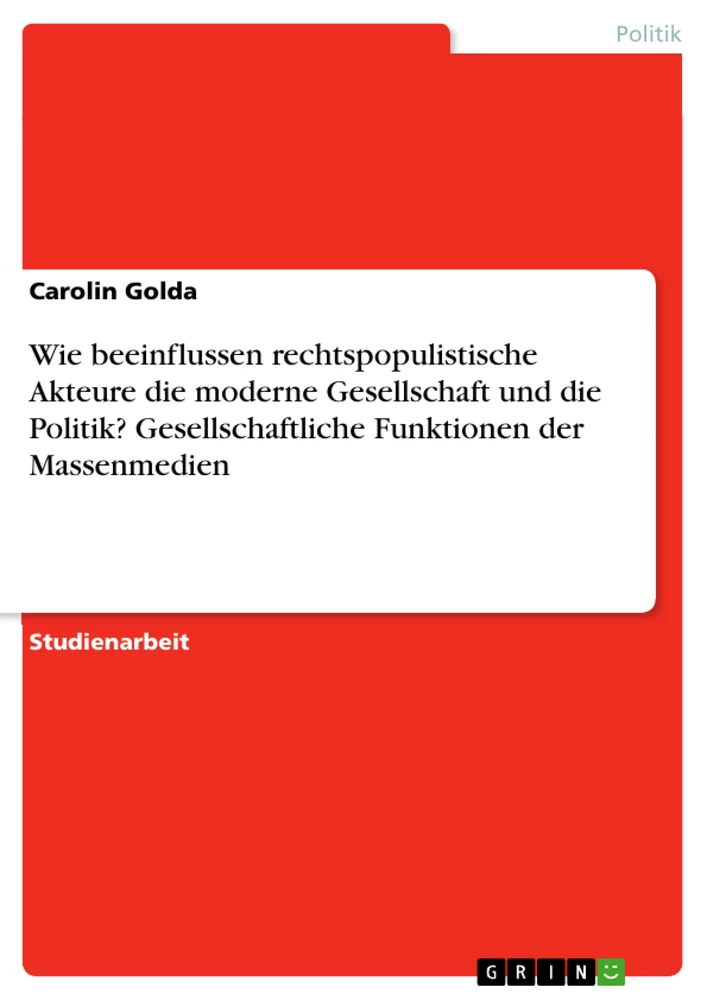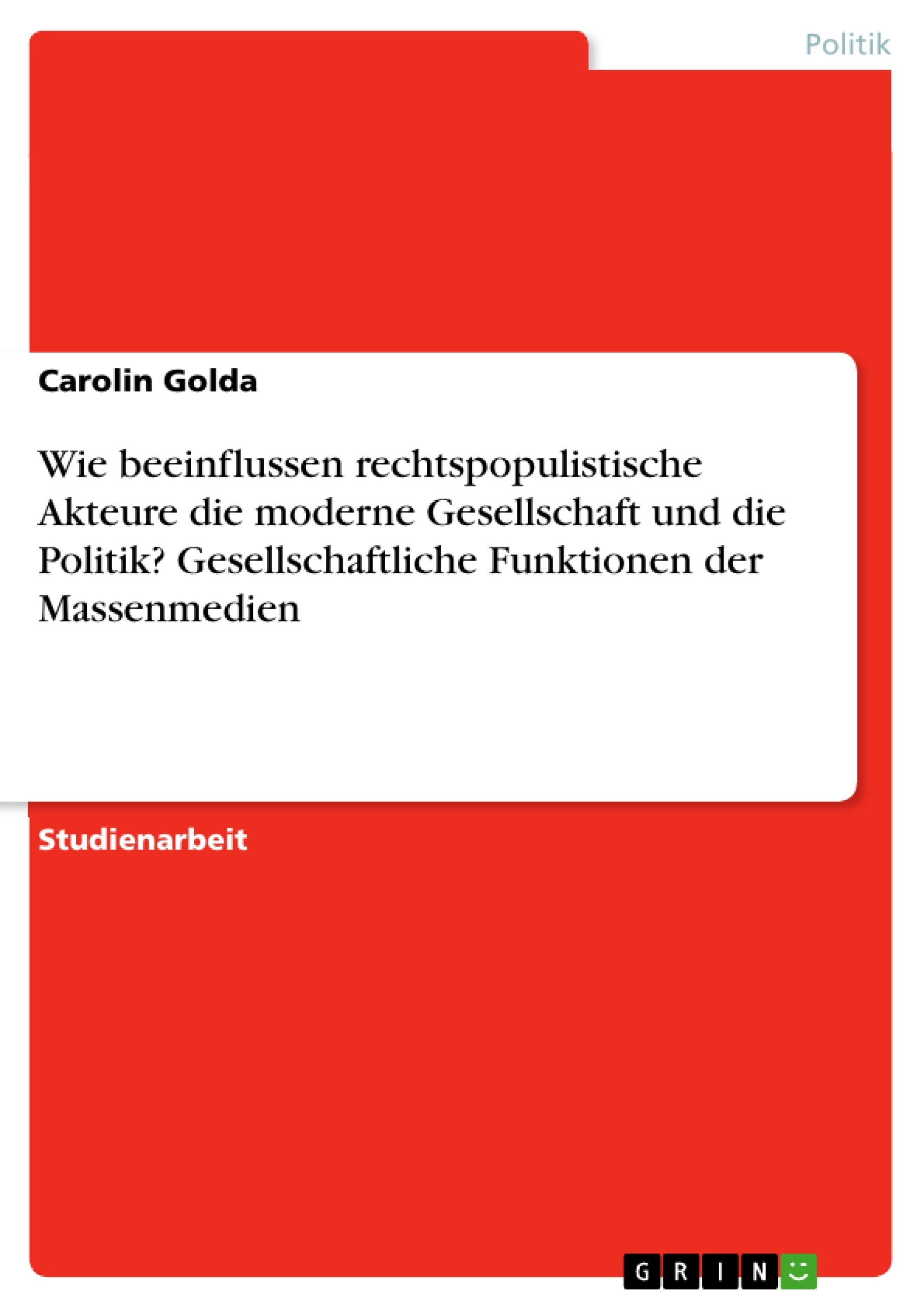Während man außerhalb Europas seit langem mit populistischen Bewegungen vertraut ist, trat dieses Phänomen bei uns im Laufe der 1970er Jahren auf. Sowohl Linker als auch rechter Populismus haben sich in vielen EU-Staaten etabliert, wirken in Regierungen mit und erfreuen sich über die Zustimmung und die zunehmende Wählerschaft. In Hinblick auf den Rechtspopulismus lässt sich deutlich erkennen, dass fremdenfeindliches Gedankengut nun nicht nur hinter verschlossenen Türen thematisiert wird, sondern überwiegend nach außen getragen wird – sowie in Deutschland, beispielsweise PEGIDA mit ihren sogenannten „Montags-Spaziergängen“.
Allerdings ist solch ein Aufstieg von rechten Bewegungen und Parteien auch in vielen weiteren Ländern zu beobachten und stehen in einem engen Verhältnis zu Massenmedien. Die Politik und Medien standen schon immer in einer besonderen Beziehung zueinander, die vor allem eine wechselseitige Relation aufweist. Gesellschaftsstrukturell bedingt ist die Politik als auch die Medien vermehrt auf die Akzeptanz des öffentlichen Publikums angewiesen und so legen sie großen Wert auf den Zuspruch der Bevölkerung. Doch warum wirkt der Rechtspopulismus für viele Menschen derzeit in diesem Maße verlockend und so überzeugend, dass sie ihn unterstützen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Populismus - Begriffsvielfalt
- 2.1 Merkmalsbestimmung des Populismus
- 2.2 Rechtspopulistische Bewegungen
- 3. Systemtheorie – Luhmann
- 3.1 Soziale / Protestbewegungen
- 3.2 Populismus auf systemtheoretischer Sicht
- 3.3 Populistische Logik
- 4. Massenmedien – Gesellschaftliche Funktion
- 4.1 Operativer Konstruktivismus und soziale Realitätskonstruktion
- 4.2 Populismus und Massenmedien
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie es rechtspopulistischen Akteuren gelingt, die moderne Gesellschaft und Politik zu beeinflussen. Sie untersucht die verschiedenen Ausprägungen des Populismus und seine Merkmale, insbesondere im Hinblick auf rechtspopulistische Bewegungen. Die Arbeit analysiert, wie Populismus im Rahmen der Systemtheorie nach Luhmann interpretiert werden kann, und beleuchtet die Rolle von Massenmedien in der Verbreitung und dem Erfolg populistischer Botschaften.
- Begriffserläuterung und Merkmalsbestimmung des Populismus
- Analyse rechtspopulistischer Bewegungen und ihrer Einflussfaktoren
- Systemtheoretische Interpretation des Populismus nach Luhmann
- Die Bedeutung von Massenmedien in der Kommunikation populistischer Akteure
- Die Wechselbeziehung zwischen Populismus und Massenmedien
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird der Begriff Populismus erläutert und seine verschiedenen Definitionen und Ausprägungen vorgestellt. Es wird auf die Bedeutung der „dünnen Ideologie“ des Populismus eingegangen und die zentralen Merkmale, wie Anti-Elitarismus, Moralisierung und Antipolitik, herausgearbeitet. Im zweiten Kapitel werden rechtspopulistische Bewegungen in den Fokus gerückt, und es wird analysiert, wie sie in den letzten Jahren durch das Ungleichgewicht von Rechtsstaat und Volkssouveränität an Einfluss gewonnen haben. Im dritten Kapitel wird die Systemtheorie nach Luhmann herangezogen, um zu verstehen, wie soziale und Protestbewegungen aus differenzierungstheoretischer Perspektive betrachtet werden können und wie Populismus innerhalb dieses theoretischen Rahmens gedeutet wird. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der gesellschaftlichen Funktion von Massenmedien und beleuchtet den Operativen Konstruktivismus und die soziale Realitätskonstruktion. Im fünften Kapitel wird die Wechselbeziehung zwischen Populismus und Massenmedien genauer betrachtet, indem untersucht wird, wie populistische Akteure die Regeln der massenmedialen Aufmerksamkeit für ihre Zwecke nutzen.
Schlüsselwörter
Populismus, Rechtspopulismus, Systemtheorie, Luhmann, Massenmedien, Operativer Konstruktivismus, soziale Realitätskonstruktion, Anti-Elitarismus, Moralisierung, Antipolitik, „dünne Ideologie“, Protestbewegungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen rechtspopulistische Akteure die moderne Politik?
Rechtspopulisten nutzen die Wechselbeziehung zu Massenmedien und öffentliche Proteste, um ihre Botschaften zu verbreiten und Wählerschaften in vielen EU-Staaten zu mobilisieren.
Was sind die zentralen Merkmale von Populismus?
Zu den Kernmerkmalen gehören Anti-Elitarismus, Moralisierung, Antipolitik und eine sogenannte „dünne Ideologie“.
Welche Rolle spielt die Systemtheorie nach Luhmann in dieser Arbeit?
Die Arbeit nutzt Luhmanns Systemtheorie, um Populismus und soziale Protestbewegungen aus einer differenzierungstheoretischen Perspektive zu interpretieren.
Was versteht man unter operativem Konstruktivismus?
Es beschreibt, wie Massenmedien soziale Realität konstruieren und wie populistische Akteure diese Regeln der medialen Aufmerksamkeit für sich nutzen.
Warum ist Rechtspopulismus für viele Menschen aktuell attraktiv?
Die Arbeit untersucht dies im Hinblick auf das Ungleichgewicht zwischen Rechtsstaat und Volkssouveränität sowie die Sehnsucht nach Akzeptanz und Zuspruch.
Was ist ein Beispiel für rechtspopulistische Bewegungen in Deutschland?
In der Arbeit wird beispielhaft PEGIDA mit ihren „Montags-Spaziergängen“ genannt.
- Quote paper
- Carolin Golda (Author), 2017, Wie beeinflussen rechtspopulistische Akteure die moderne Gesellschaft und die Politik? Gesellschaftliche Funktionen der Massenmedien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380758