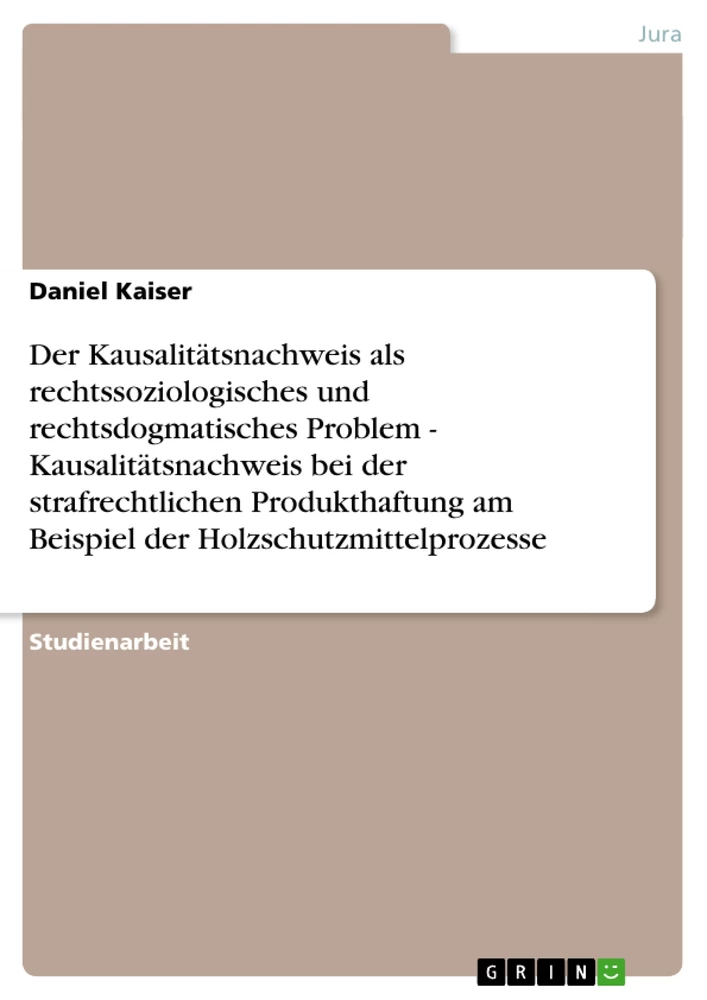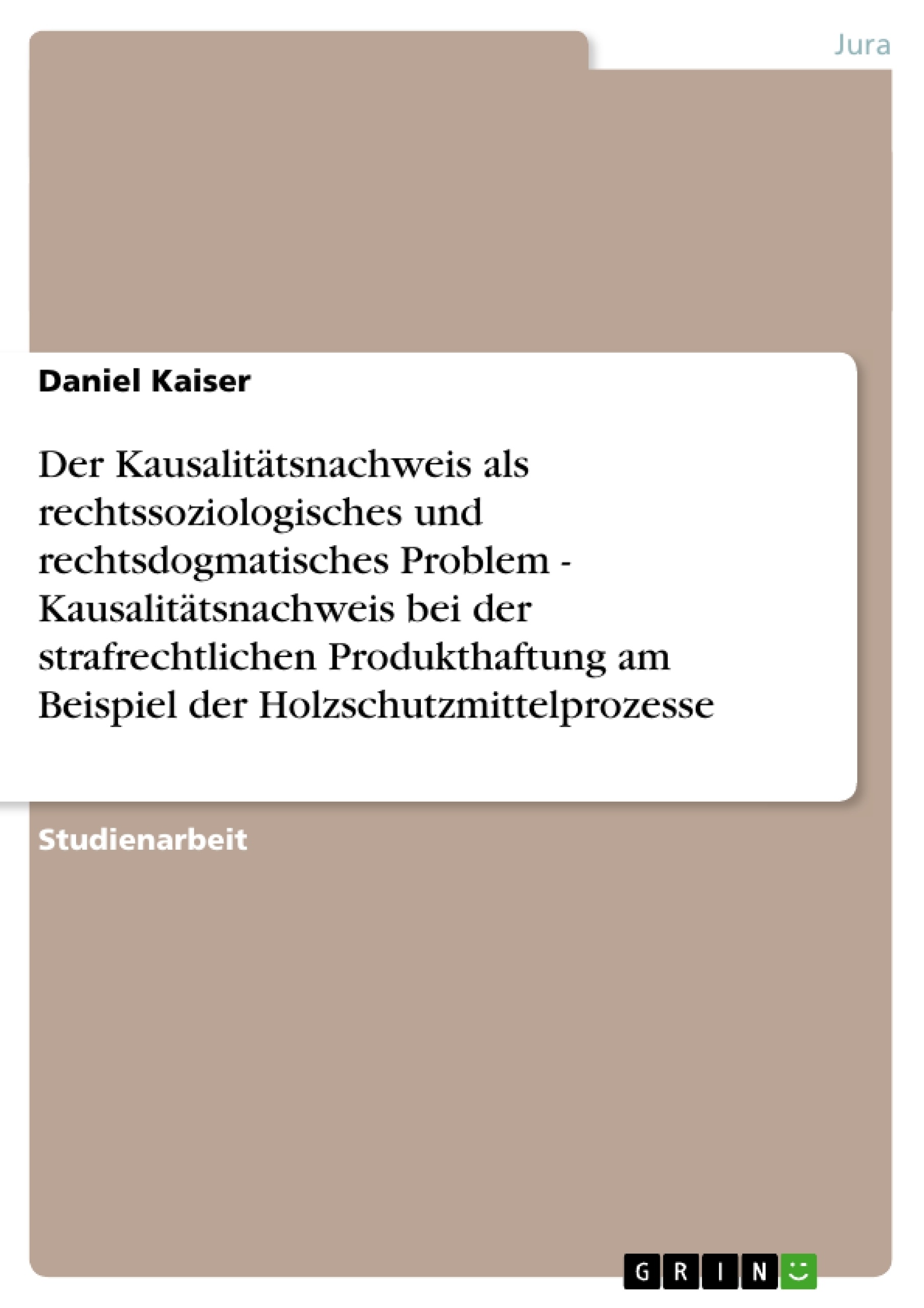. Die Entwicklung des Streitstandes vor den Holzschutzmittelprozessen
1. Das Contergan-Verfahren
a) Entscheidung des LG Aachen
Im Conterganfall war ein Hauptproblem des Verfahrens die Frage nach der Kausalität der Einnahme des thalidomidhaltigen Schlafmittels Contergan durch Schwangere für schwere Nervenschäden und Mißbildungen Neugeborener. Obwohl die als Sachverständigen gehörten Naturwissenschaftler in der Frage der generellen Eignung des Medikaments, das sog. Wiedemann- oder Dysmeliesyndrom hervorzurufen, zu diametral entgegengesetzen Ergebnissen gekommen waren und sich insbesondere ein Chemie-Nobelpreisträger gegen die Begründbarkeit eines Nachweises ausgesprochen hatte, bejahte das mit der Sache beschäftigte LG Aachen den Verursachungszusammenhang, indem es auf den Unterschied eines „Nachweises im Rechtssinne“ zu einem „naturwissenschaftlichen Nachweis“ abstellte. Unter dem Nachweis im Rechtssinne sei nämlich keineswegs der so genannte naturwissenschaftliche Nachweis zu verstehen, der eine mathematische, jede Möglichkeit des Gegenteils ausschließende Gewißheit, also absolut sicheres Wissen (vgl. BGH in: VRS 39, 103ff.) vorraussetze, sondern der für die strafrechtliche Beurteilung allein maßgebliche Beweis sei schon erbracht, wenn das Gericht von den zu beweisenden Tatsachen nach dem Inbegriff der Hauptverhandlung voll überzeugt sei.
Inhaltsverzeichnis
- I. Die Entwicklung des Streitstandes vor den Holzschutzmittelprozessen..
- 1. Das Contergan-Verfahren .....
- a) Entscheidung des LG Aachen.....
- b) Kritik Armin Kaufmanns
- c) Grundlagen der Kausalitätsfeststellung …..\n
- 2. Das Lederspray-Verfahren (Erdal-Fall).
- a) Entscheidung des LG Mainz.
- c) Kritik am Ausschlußverfahren des BGH\n
- II. Die Holzschutzmittelprozesse
- 1. Die besondere Problematik der Holzschutzmittelprozesse
- 2. Die Thesen des BGH und ihre Kritik.
- a) generelle Kausalität-konkreter Kausalitätsnachweis.
- aa) Kritik am Begriff der generellen Kausalität..\n
- bb) Lehre Engischs von der gesetzmäßigen Bedingung.
- cc) Notwendigkeit der Kenntnis der genauen Dosis-Wirkungs-Relation ? ………………………………….\n
- dd) materielle Verortung der generellen Kausalität\n
- ee) Einordnung der generellen Kausalität als prozessuale Problematik\n
- ff) Konsequenzen der Verortung .........\n
- b) Grenzen der freien richterlichen Beweiswürdigung\n
- aa) hinreichende Tatsachengrundlage\n
- bb) Entscheidung bei nicht allgemeingültigem Erfahrungswissen…....\n
- e) Das Ausschlußverfahren\n
- aa) substanzielle Änderung des Kausalitätsbegriffs\n
- bb) von der Kausalität zur Plausibilität …….....\n
- d) Wahrscheinlichkeitsurteile.........\n
- 3. Annäherung des strafrechtlichen an den zivilrechtlichen Kausalitätsnachweis?.
- a) Anscheinsbeweis - evidente Kausalität .\n
- b) Fälle strafrechtlicher Produkthaftung\n
- 4. weitere rechtssoziologische Aspekte..........\n
- a) Verständnislosigkeit zwischen Juristen und Naturwissenschaftlern..\n
- b) Auswirkungen des Verfahrens auf die Beschuldigten ……………..\n
- c) Das „Amalgam-Verfahren“.
- d) Medizinstatistik\n
- III. Resümee: Der Mensch in der Risikogesellschaft..\n
- Entwicklung des Streitstandes zum Kausalitätsnachweis
- Die Besonderheiten des Kausalitätsnachweises in Holzschutzmittelprozessen
- Kritik an den Thesen des BGH und deren Auswirkungen auf die Beweisführung
- Rechtssoziologische Aspekte der Beweisführung in Produkthaftungsprozessen
- Die Bedeutung des Kausalitätsnachweises in der Risikogesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die Problematik des Kausalitätsnachweises in strafrechtlichen Produkthaftungsprozessen zu untersuchen. Dies geschieht am Beispiel der Holzschutzmittelprozesse, die aufgrund der komplexen Zusammenhänge zwischen dem Einsatz von Holzschutzmitteln und möglichen gesundheitlichen Schäden besondere Herausforderungen für die Beweisführung darstellen.
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit untersucht die Entwicklung des Streitstandes zum Kausalitätsnachweis, beginnend mit dem Conterganfall. Hier werden die Entscheidung des LG Aachen, die Kritik Armin Kaufmanns und die grundlegenden Aspekte der Kausalitätsfeststellung erläutert. Auch das Lederspray-Verfahren wird in diesem Zusammenhang betrachtet.
Der zweite Teil konzentriert sich auf die Holzschutzmittelprozesse, die besondere Herausforderungen für den Kausalitätsnachweis mit sich bringen. Es werden die Thesen des BGH und ihre Kritik, die Grenzen der freien Beweiswürdigung sowie das Ausschlußverfahren und die Rolle von Wahrscheinlichkeitsurteilen analysiert.
Im dritten Teil wird die Annäherung des strafrechtlichen an den zivilrechtlichen Kausalitätsnachweis untersucht. Dabei wird die Bedeutung des Anscheinsbeweises und die Anwendung des Kausalitätsnachweises in Fällen strafrechtlicher Produkthaftung erörtert.
Der vierte Teil betrachtet weitere rechtssoziologische Aspekte der Beweisführung in Produkthaftungsprozessen. Hier werden die Verständnislosigkeit zwischen Juristen und Naturwissenschaftlern, die Auswirkungen des Verfahrens auf die Beschuldigten sowie das „Amalgam-Verfahren“ und die Rolle der Medizinstatistik thematisiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Kausalitätsnachweis in strafrechtlichen Produkthaftungsprozessen. Dabei werden wichtige Begriffe wie „generelle Kausalität“, „konkreter Kausalitätsnachweis“, „Ausschlußverfahren“, „Anscheinsbeweis“ und „Wahrscheinlichkeitsurteil“ behandelt. Weitere zentrale Themen sind die Rolle von Sachverständigen, die Beweiswürdigung und die rechtssoziologischen Aspekte der Beweisführung in der Risikogesellschaft.
- Citar trabajo
- Daniel Kaiser (Autor), 1998, Der Kausalitätsnachweis als rechtssoziologisches und rechtsdogmatisches Problem - Kausalitätsnachweis bei der strafrechtlichen Produkthaftung am Beispiel der Holzschutzmittelprozesse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38131