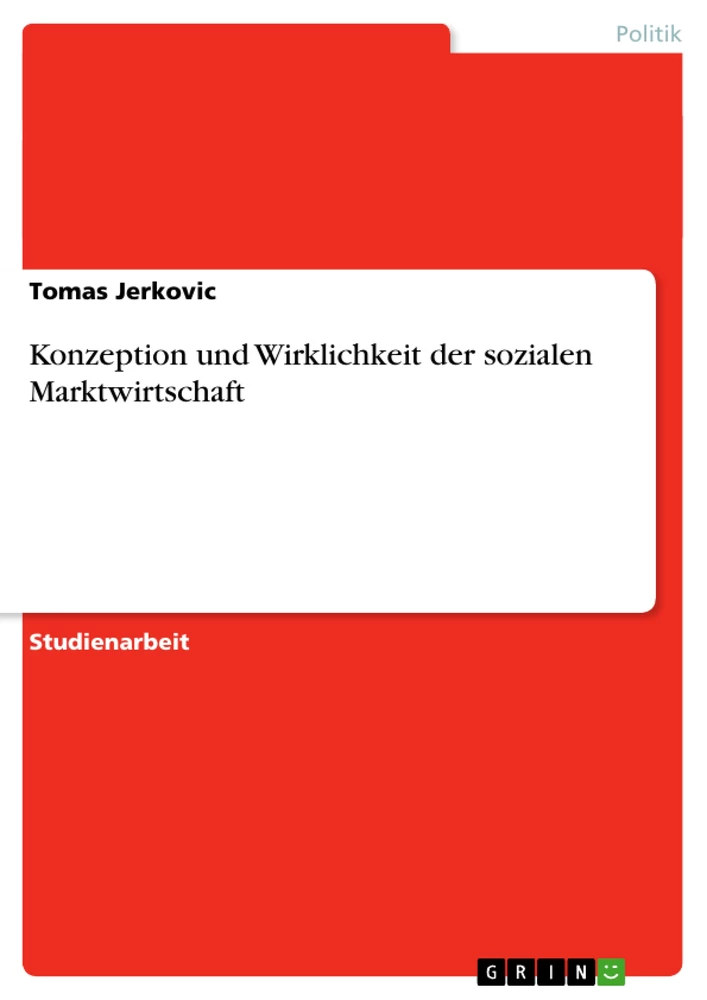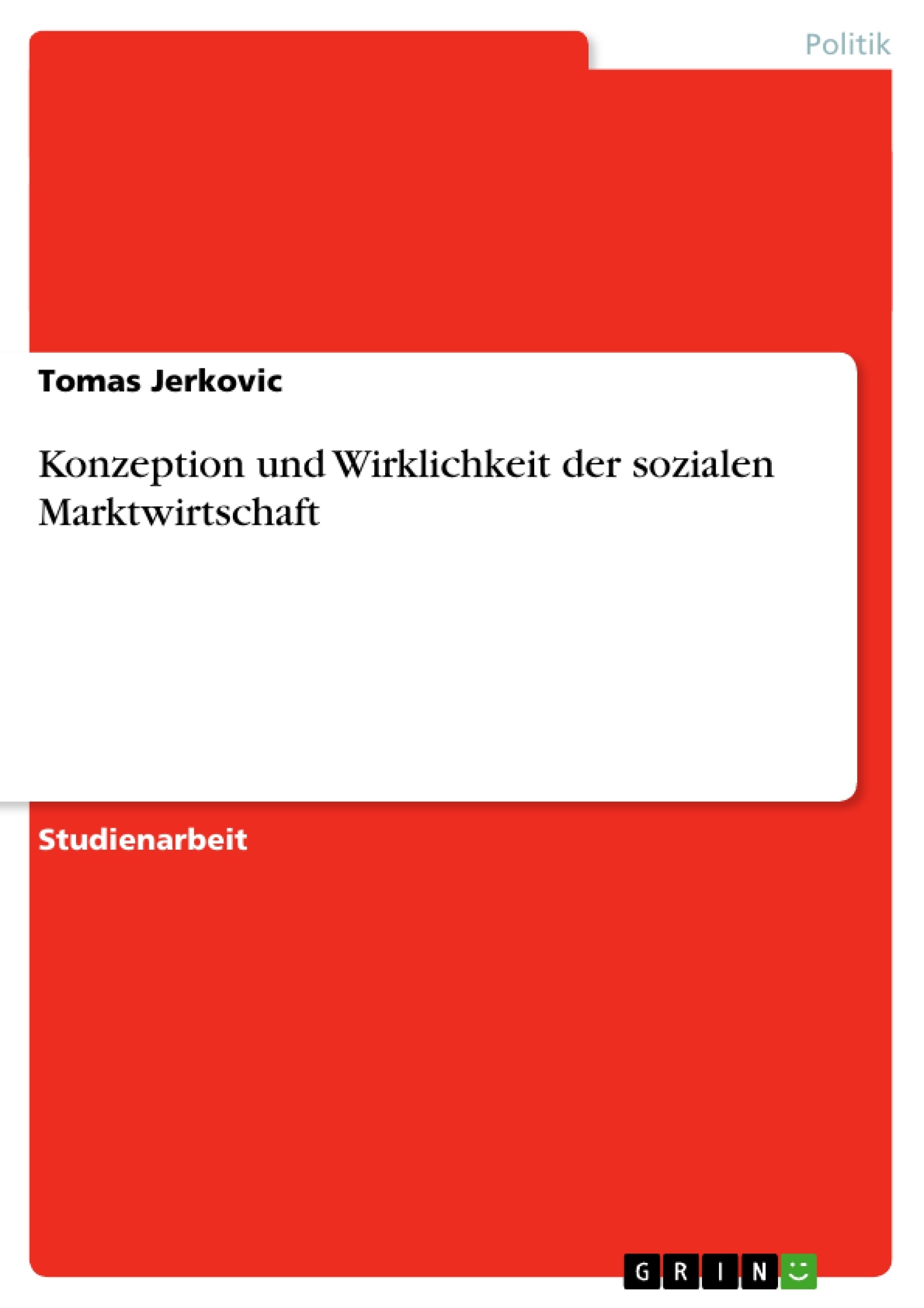Einleitung
Die soziale Marktwirtschaft wird oft als „dritter Weg“ zwischen den Extrempositionen liberale Marktwirtschaft ( kaum bzw. kein staatlicher Einfluß auf die Wirtschaft) und sozialistischer Zentralverwaltungswirtschaft ( hoher bzw. totaler staatlicher Einfluß auf die Wirtschaft) beschrieben. In diesem Zusammenhang ist es interessant zu erwähnen, daß das Grundgesetz keine Wirtschaftsform vorschreibt. Es gibt sowohl liberale Grundgesetzartikel (z.B. Art.2 GG: allgemeine Handlungsfreiheit) als auch eher soziale Grundgesetzartikel (z.B.Art.15 GG: Sozialisierung).
Das Bundesverfassungsgericht hat dazu 1954 entschieden: „Das Grundgesetz garantiert weder die wirtschaftspolitische Neutralität der Regierungs- und Gesetzgebungsgewalt noch eine nur mit marktkonformen Mitteln zu steuernde soziale Marktwirtschaft. Die wirtschaftspolitische Neutralität des Grundgesetzes besteht lediglich darin, daß sich der Verfassungsgeber nicht ausdrücklich für ein bestimmtes Wirtschaftssystem entschieden hat. Dies ermöglicht dem Gesetzgeber, die ihm jeweils sachgemäß erscheinende Wirtschaftspolitik zu verfolgen, sofern er dabei das Grundgesetz beachtet. Die gegenwärtige Wirtschafts- und Sozialordnung ist zwar eine nach dem Grundgesetz mögliche Ordnung, keineswegs aber die allein mögliche.“( Adam, Wirtschaftspolitik :57)
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Entwicklungsgeschichte
- 1. Einflüsse des zweiten Weltkriegs
- 2. Sozialgesetzgebung
- 3. Kartellgesetzgebung
- 4. Beitrag der „Freiburger Schule“
- a) Typologie der Wirtschaftssysteme
- b) Ordnungsbezug
- c) Gestaltbarkeit der Wirtschaftsordnung
- d) Grundannahmen
- 5. Beitrag Alfred Müller-Armacks
- a) Prinzip der Personalität
- b) Prinzip der Solidarität
- c) Prinzip der Subsidiarität
- d) Grundannahmen
- 6. Gesetzliche Regelungen
- III. Aufbau der sozialen Marktwirtschaft
- 1. Wettbewerbsordnung
- a) konstituierende Prinzipien
- b) regulierende Prinzipien
- 2. Geldordnung
- a) Gefahren
- b) geldpolitische Instrumente
- 3. Sozialordnung
- a) Leitideen
- b) Grundsätze der sozialen Sicherheit
- IV. Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzeption und die Wirklichkeit der sozialen Marktwirtschaft. Ziel ist es, die Entwicklungsgeschichte dieses Wirtschaftsmodells nachzuzeichnen und seine zentralen Elemente zu analysieren. Dabei wird insbesondere auf die Einflüsse des Zweiten Weltkriegs, die Rolle der „Freiburger Schule“ und den Beitrag Alfred Müller-Armacks eingegangen.
- Entwicklungsgeschichte der sozialen Marktwirtschaft
- Die Rolle der „Freiburger Schule“ im Ordoliberalismus
- Die Bedeutung von Wettbewerb und sozialer Gerechtigkeit
- Der Aufbau der sozialen Marktwirtschaft: Wettbewerbs-, Geld- und Sozialordnung
- Vergleich mit anderen Wirtschaftssystemen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die soziale Marktwirtschaft als „dritten Weg“ zwischen liberaler Marktwirtschaft und sozialistischer Zentralverwaltungswirtschaft vor und betont die wirtschaftspolitische Neutralität des Grundgesetzes, das keine spezifische Wirtschaftsform vorschreibt. Der Abschnitt beleuchtet die Debatte um die Vereinbarkeit liberaler und sozialer Prinzipien im deutschen Wirtschaftssystem.
II. Entwicklungsgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der sozialen Marktwirtschaft. Es beginnt mit den unmittelbaren Nachkriegswirkungen des Zweiten Weltkriegs, die einen Drang nach Wirtschaftsfreiheit hervorriefen, im Gegensatz zur erlebten Zwangswirtschaft. Die Sozialgesetzgebung Bismarcks und die Kartellgesetzgebung der Weimarer Republik werden als wichtige Vorläufer präsentiert. Der Beitrag der „Freiburger Schule“ mit ihrer Typologie von Wirtschaftssystemen, dem Ordnungsbezug und der Gestaltbarkeit der Wirtschaftsordnung wird detailliert dargestellt, ebenso wie die Grundannahmen dieses Denkansatzes. Schließlich wird der entscheidende Beitrag Alfred Müller-Armacks mit der Prägung des Begriffs „soziale Marktwirtschaft“ und dem Versuch, Freiheit und soziale Gerechtigkeit zu verbinden, hervorgehoben.
III. Aufbau der sozialen Marktwirtschaft: Das Kapitel beschreibt den Aufbau der sozialen Marktwirtschaft anhand von drei Säulen: der Wettbewerbsordnung, der Geldordnung und der Sozialordnung. Die Wettbewerbsordnung wird durch konstituierende und regulierende Prinzipien erläutert. Die Geldordnung behandelt die damit verbundenen Gefahren und geldpolitische Instrumente. Die Sozialordnung wird anhand ihrer Leitideen und Grundsätze der sozialen Sicherheit dargestellt. Der Abschnitt betont die komplexe Interaktion zwischen den einzelnen Ordnungen und deren Beitrag zum Gesamtsystem.
Schlüsselwörter
Soziale Marktwirtschaft, Ordoliberalismus, Freiburger Schule, Alfred Müller-Armack, Wettbewerbsordnung, Geldordnung, Sozialordnung, Wirtschaftsfreiheit, soziale Gerechtigkeit, Grundgesetz, Nachkriegsentwicklung, Bismarck, Kartellgesetzgebung.
Häufig gestellte Fragen zur Sozialen Marktwirtschaft
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Soziale Marktwirtschaft. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Entwicklungsgeschichte, den zentralen Elementen und dem Aufbau des Wirtschaftsmodells, inklusive der Rolle der Freiburger Schule und Alfred Müller-Armacks.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die zentralen Themen sind die Entwicklungsgeschichte der Sozialen Marktwirtschaft, die Einflüsse des Zweiten Weltkriegs, die Rolle der „Freiburger Schule“ und Alfred Müller-Armacks, der Aufbau der Sozialen Marktwirtschaft (Wettbewerbsordnung, Geldordnung, Sozialordnung), der Vergleich mit anderen Wirtschaftssystemen und die Verbindung von Wirtschaftsfreiheit und sozialer Gerechtigkeit.
Welche Rolle spielte die „Freiburger Schule“?
Die „Freiburger Schule“ wird als maßgeblich für die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft dargestellt. Ihr Beitrag umfasst eine Typologie von Wirtschaftssystemen, den Ordnungsbezug, die Gestaltbarkeit der Wirtschaftsordnung und die zugrundeliegenden Grundannahmen. Der Einfluss ihrer Ideen auf das Verständnis und die Gestaltung der Sozialen Marktwirtschaft wird detailliert erläutert.
Welche Bedeutung hatte Alfred Müller-Armack?
Alfred Müller-Armack wird als Schlüsselfigur hervorgehoben, der den Begriff „Soziale Marktwirtschaft“ prägte und versuchte, die Prinzipien von Wirtschaftsfreiheit und sozialer Gerechtigkeit zu vereinen. Seine zentralen Ideen, wie die Prinzipien der Personalität, Solidarität und Subsidiarität, werden im Dokument erklärt.
Wie ist die Soziale Marktwirtschaft aufgebaut?
Der Aufbau der Sozialen Marktwirtschaft wird anhand dreier Säulen beschrieben: der Wettbewerbsordnung (mit konstituierenden und regulierenden Prinzipien), der Geldordnung (einschließlich der damit verbundenen Gefahren und geldpolitischer Instrumente) und der Sozialordnung (mit ihren Leitideen und Grundsätzen der sozialen Sicherheit). Die Interaktion dieser drei Säulen wird als zentral für das Gesamtsystem betont.
Welche historischen Einflüsse prägten die Soziale Marktwirtschaft?
Die unmittelbaren Nachkriegswirkungen des Zweiten Weltkriegs, die Sozialgesetzgebung Bismarcks und die Kartellgesetzgebung der Weimarer Republik werden als wichtige Vorläufer der Sozialen Marktwirtschaft identifiziert. Das Dokument hebt den Wunsch nach Wirtschaftsfreiheit nach der Zwangswirtschaft des Nationalsozialismus hervor.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Sozialen Marktwirtschaft?
Schlüsselbegriffe umfassen: Soziale Marktwirtschaft, Ordoliberalismus, Freiburger Schule, Alfred Müller-Armack, Wettbewerbsordnung, Geldordnung, Sozialordnung, Wirtschaftsfreiheit, soziale Gerechtigkeit, Grundgesetz, Nachkriegsentwicklung, Bismarck, Kartellgesetzgebung.
- Citar trabajo
- Tomas Jerkovic (Autor), 1998, Konzeption und Wirklichkeit der sozialen Marktwirtschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38163