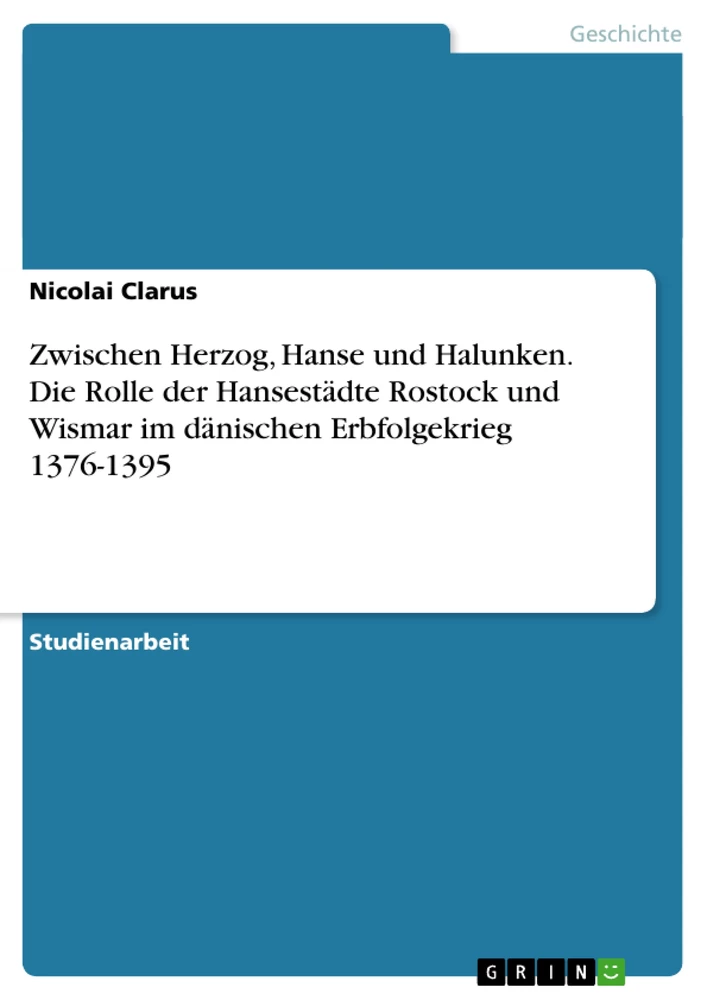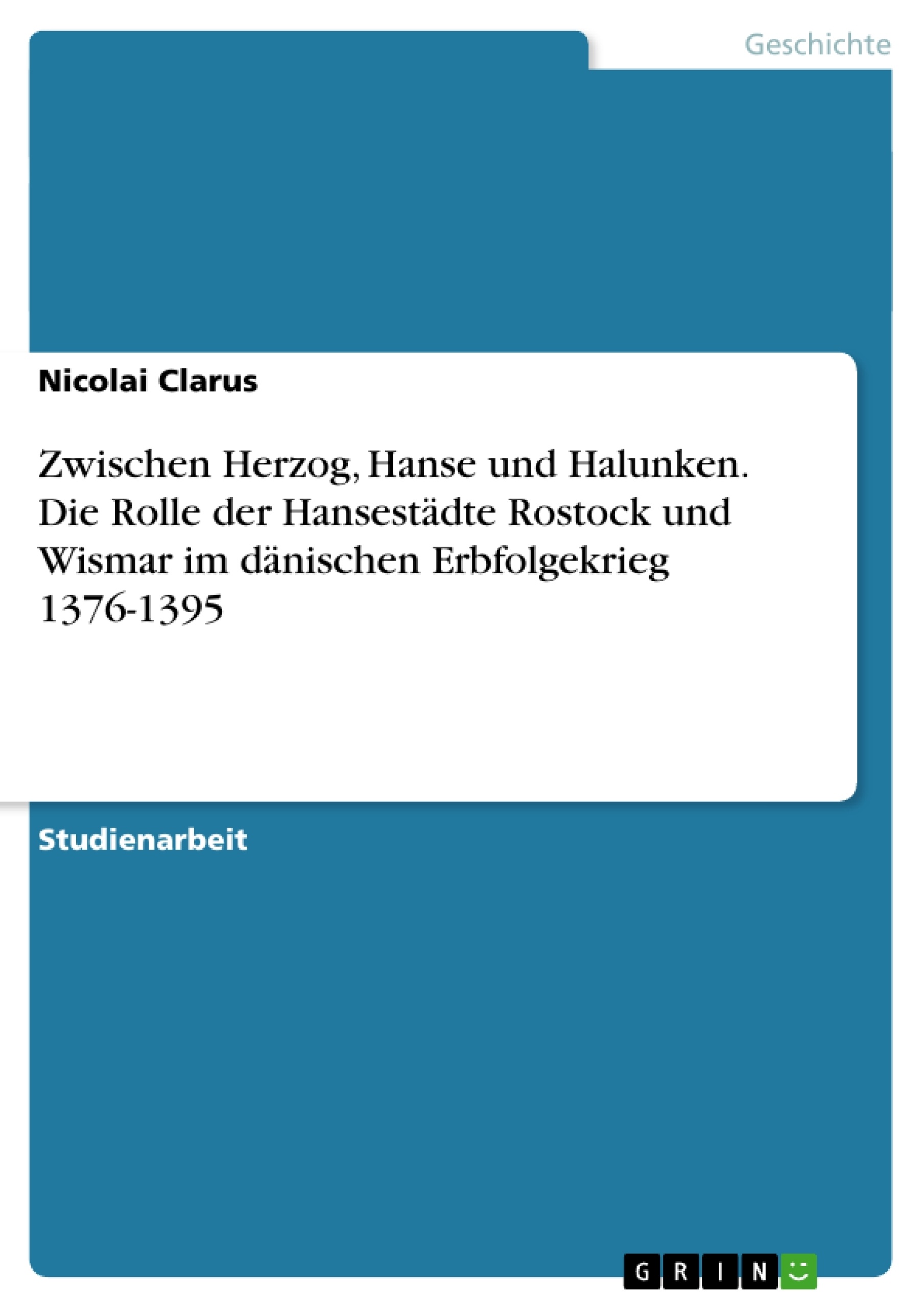Einleitung
In den Jahren 1376 bis 1395 sahen sich die mecklenburgischen Ostseestädte Rostock und Wismar vor eine diplomatische Zerreißprobe gestellt. Ihre Landesherren, die Herzöge von Mecklenburg, standen im Krieg mit Dänemark, einer von ihnen gar in seiner zusätzlichen Eigenschaft als König des Reiches Schweden. Rostock und Wismar, die mittels eines Aufstandes im Jahre 1311 erfolglos versucht hatten, die Herrschaftsgewalt ihres Landesherrn abzuschütteln1, waren keine Reichsunmittelbaren Städte und somit ihrem Territorialherren zur Treue verpflichtet. Die Unterstützung, die beide Städte den mecklenburgischen Herzögen im Krieg gegen Dänemark in Form der Öffnung ihrer Seehäfen für Kaperfahrer angedeihen ließen, war für sie wirtschaftlich zwar zunächst von großem Nutzen, widersprach aber diametral den Interessen der deutschen Hanse, deren Mitglieder Rostock und Wismar ebenfalls waren, da die angeworbenen Kaperfahrer schon sehr bald keine Unterscheidung zwischen feindlichen und neutralen Schiffen mehr machten. Auch die Tatsache, dass die Helfershelfer keineswegs zu uneingeschränkter Loyalität tendierten und zwischenzeitlich die Fronten wechselten, verkomplizierte die Situation zusätzlich. Aufgrund der zahlreichen auftretenden Akteure, die mit den verschiedensten Zielen auf beiden Seiten im Verlauf des Konflikts intervenierten und der rechtlichen Problematik, der die Akteure mit teils intriganter Genialität begegneten, entwickelte sich in den Jahren 1376 bis 1395 ein Drama in drei Akten, welches selbst einem William Shakespeare zur Ehre gereicht hätte.
Im Verlauf dieser Arbeit soll erörtert werden, wie es den Städten Rostock und Wismar in der Zeit der dänischen Erbfolgekriege von 1376 bis 1395 gelang, durch geschicktes Taktieren einerseits die Treueverpflichtung zu ihrem Landesherren in größtmöglichem Maße einzuhalten und andererseits ihre Interessen gegenüber der den mecklenburgischen Kaperfahrern feindlich gesinnten Hanse zu wahren und sich einem Ausschluss aus der Gemeinschaft, der sogenannten „Verhansung“ zu erwehren. Zum Zwecke dieser Untersuchung sollen vornehmlich die Bände 19 – 23 der Mecklenburgischen Urkundenbücher2 als Quellen dienen, in denen für den zu behandelnden Zeitraum sowohl ausgestellte Urkunden, als auch die mecklenburgische Angelegenheiten betreffenden Auszüge der Hanserecesse editiert sind...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Prolog
- 1. Akt: Der König ist tot, es lebe der König!
- 2. Akt: Seitenwechsel
- 3. Akt: Sein, oder nicht Sein
- Epilog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die diplomatische Strategie der mecklenburgischen Ostseestädte Rostock und Wismar während der dänischen Erbfolgekriege (1376-1395). Es wird analysiert, wie sie ihre Loyalität gegenüber ihren Landesherren mit ihren Interessen als Mitglieder der Hanse in Einklang brachten und einen Ausschluss aus der Hanse verhinderten.
- Die Loyalitätskonflikte zwischen Rostock und Wismar, ihren Landesherren und der Hanse.
- Die Rolle der Städte Rostock und Wismar im dänischen Erbfolgekrieg.
- Die wirtschaftlichen Folgen der Öffnung der Häfen für mecklenburgische Kaperfahrer.
- Die Auswirkungen des Stralsunder Friedens auf die strategischen Entscheidungen der Städte.
- Die Quellenlage und die Herausforderungen der historischen Forschung zu diesem Thema.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der Arbeit: Die mecklenburgischen Ostseestädte Rostock und Wismar befanden sich in einer schwierigen Lage zwischen ihren Landesherren, die im Krieg mit Dänemark standen, und der Hanse. Die Unterstützung der Mecklenburger durch die Städte führte zu Konflikten mit der Hanse, da die Kaperfahrten der Mecklenburger den neutralen Handel beeinträchtigten. Die Arbeit untersucht, wie Rostock und Wismar diese Herausforderungen bewältigten.
Prolog: Der Prolog beschreibt den Aufstieg Mecklenburgs zur Macht im späten 14. Jahrhundert. Herzog Albrecht II. erlangte die schwedische Krone für seinen Sohn Albrecht III. Albrecht II. plante außerdem, den dänischen Thron mit einem Mitglied des Hauses Mecklenburg zu besetzen. Diese Expansionspolitik bildet den Hintergrund für den folgenden Konflikt.
1. Akt: Der König ist tot, es lebe der König!: Nach dem Tod Waldemars IV. von Dänemark 1375 entbrannte ein Erbfolgekrieg. Die Hanse entschied sich für Olav IV. von Norwegen, während die Mecklenburger Albrecht IV. unterstützten. Diese Entscheidung zwang Rostock und Wismar, sich auf die Seite ihres Landesherren zu stellen, obwohl dies im Widerspruch zu den Interessen der Hanse stand. Der Akt beschreibt den Beginn des Krieges und die anfänglichen Strategien der Mecklenburger.
Schlüsselwörter
Rostock, Wismar, Mecklenburg, Dänemark, Hanse, dänische Erbfolgekriege (1376-1395), Kaperfahrten, Loyalitätskonflikt, Stralsunder Frieden, Albrecht II., Albrecht IV., Olav IV., Margarete I., Hanserecesse, Mecklenburgische Urkundenbücher, Detmar-Chronik.
Häufig gestellte Fragen: Diplomatische Strategien der mecklenburgischen Ostseestädte Rostock und Wismar während der dänischen Erbfolgekriege (1376-1395)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die diplomatische Strategie der mecklenburgischen Ostseestädte Rostock und Wismar während der dänischen Erbfolgekriege (1376-1395). Der Fokus liegt auf der Analyse, wie diese Städte ihre Loyalität gegenüber ihren Landesherren mit ihren Interessen als Mitglieder der Hanse in Einklang brachten und einen Ausschluss aus der Hanse verhinderten.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Loyalitätskonflikte zwischen Rostock und Wismar, ihren Landesherren und der Hanse; die Rolle der Städte im dänischen Erbfolgekrieg; die wirtschaftlichen Folgen der Öffnung der Häfen für mecklenburgische Kaperfahrer; die Auswirkungen des Stralsunder Friedens auf die strategischen Entscheidungen der Städte; und die Quellenlage und Herausforderungen der historischen Forschung.
Welche Akteure spielen eine wichtige Rolle?
Wichtige Akteure sind die Städte Rostock und Wismar, ihre mecklenburgischen Landesherren (insbesondere Herzog Albrecht II. und sein Sohn Albrecht IV.), die Hanse, Dänemark (mit Bezug auf Waldemar IV., Olav IV. und Margarete I.), und die beteiligten norwegischen Akteure.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, einen Prolog, drei Akte (Kapitel), und einen Epilog. Jeder Akt beschreibt einen Abschnitt des dänischen Erbfolgekriegs und die Reaktionen Rostocks und Wismars. Die Einleitung stellt den historischen Kontext dar, während der Prolog den Aufstieg Mecklenburgs beschreibt. Der Epilog rundet die Arbeit ab.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt den historischen Kontext (Einleitung), den Aufstieg Mecklenburgs (Prolog), den Beginn des Erbfolgekriegs und die anfänglichen Strategien (Akt 1), die Entwicklungen während des Krieges (Akt 2 & 3), und leitet zum Abschluss über (Epilog).
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind Rostock, Wismar, Mecklenburg, Dänemark, Hanse, dänische Erbfolgekriege (1376-1395), Kaperfahrten, Loyalitätskonflikt, Stralsunder Frieden, Albrecht II., Albrecht IV., Olav IV., Margarete I., Hanserecesse, Mecklenburgische Urkundenbücher, Detmar-Chronik.
Welche Quellen wurden wahrscheinlich verwendet?
Die Arbeit bezieht sich implizit auf Quellen wie die Mecklenburgischen Urkundenbücher und die Detmar-Chronik, sowie auf Hanserecesse (Akten der Hanse). Weitere Quellen könnten regionale Chroniken und diplomatische Korrespondenz umfassen.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Wissenschaftler und Studierende der Geschichte, insbesondere der Ostseegeschichte und der Hansegeschichte, bestimmt. Sie bietet eine strukturierte Analyse der diplomatischen Herausforderungen und Strategien der beiden Städte im Kontext der Erbfolgekriege.
- Quote paper
- Nicolai Clarus (Author), 2004, Zwischen Herzog, Hanse und Halunken. Die Rolle der Hansestädte Rostock und Wismar im dänischen Erbfolgekrieg 1376-1395, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38172