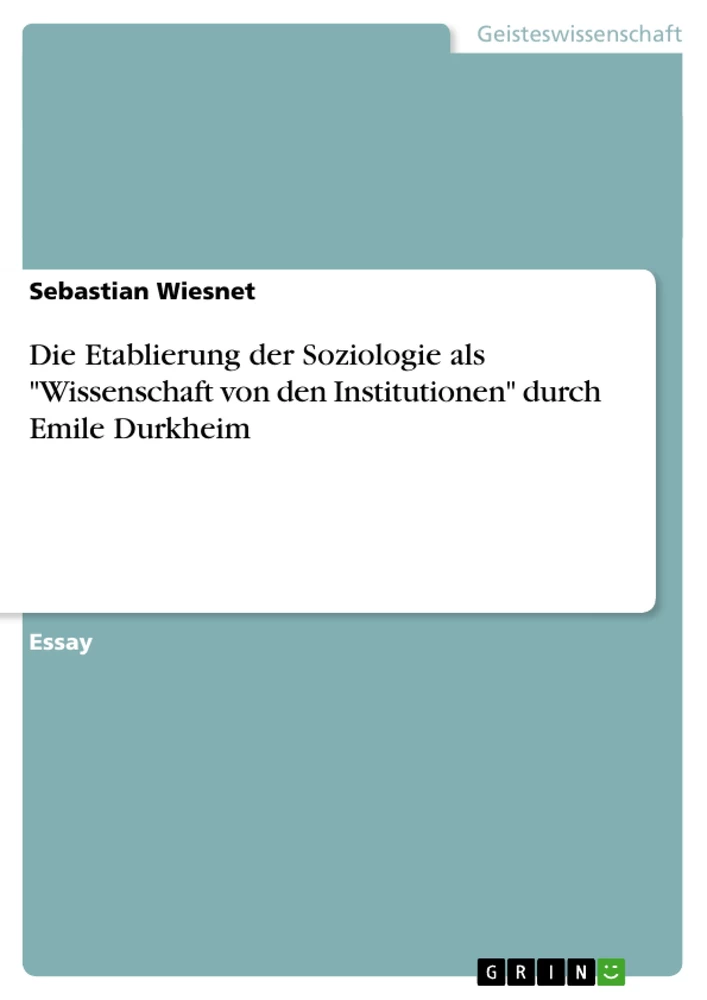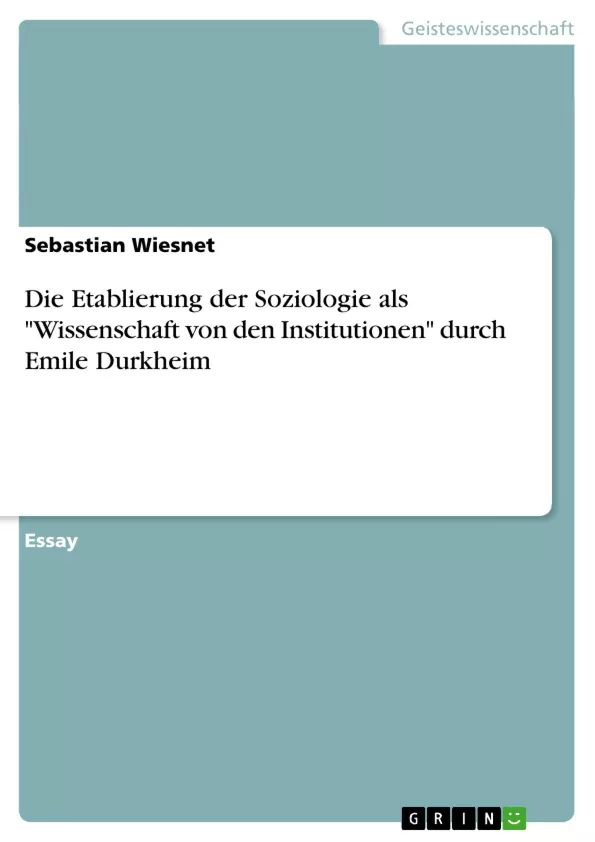Es ist gänzlich unmöglich, im Rahmen einer solch knapp bemessenen Arbeit die Bedeutung Durkheims für die Soziologie auch nur annähernd herauszuarbeiten. Dennoch soll – anhand der Betrachtung seines Werkes „Die Regeln der soziologischen Methode – versucht werden, seine Leistungen hinsichtlich der Etablierung der Soziologie als eigenständige Wissenschaft zumindest ansatzweise darzustellen: In seinen Ausführungen kritisiert Durkheim die bisherigen „soziologischen“ Arbeiten – vor allem diejenigen von Comte und Spencer – grundlegend. Er wirft ihnen eine praxisferne 1, methodisch unzureichende2, ja sogar teils willkürliche 3 Forschung vor, deren rein individualistische Betrachtungsweise4 keine soziologischen, sondern ausschließlich biologische 5 und psychologische 6 – und daher falsche – Erklärungen liefert. Parallel zur Kritik definiert er den – in seinen Augen – einzig wahren Gegenstandsbereich der Soziologie und erarbeitet zu dessen Erfassung ein eigenes Methodenwerk. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse versucht Durkheim weiterhin, die Soziologie als autonome Disziplin zu etablieren, indem er sie von anderen Wissenschaften abgrenzt.
Kapitel 1 widmet sich der grundlegenden Annahme Durkheims, dass die Gesellschaft eine Realität sui generis darstellt. Der daraus abgeleitete Gegenstandsbereich der Soziologie – der soziologische Tatbestand – wird in Kapitel 2 präzisiert. Die Methode für die Betrachtung des soziologischen Tatbestandes wird sodann in Kapitel 3 dargestellt. Sie soll verdeutlichen, warum die Soziologie von anderen Wissenschaften – etwa der Psychologie, der Philosophie und der Ökonomie – abzugrenzen ist (Kap. 4).
Inhaltsverzeichnis
- Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile
- - Die Gesellschaft als Realität sui generis
- Der soziologische Tatbestand als Gegenstandsbereich der Soziologie
- Die Methoden zur Erfassung des Gegenstandsbereichs
- Etablierung der Soziologie durch die Abgrenzung von anderen Wissenschaften
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay von Sebastian Wiesnet widmet sich der Etablierung der Soziologie als eigenständige Wissenschaft durch Emile Durkheim. Er analysiert Durkheims Kritik an früheren soziologischen Arbeiten und die Herausarbeitung eines eigenen Gegenstandsbereichs und Methodenwerks. Das Ziel ist es, Durkheims Leistungen hinsichtlich der Institutionalisierung der Soziologie zu beleuchten.
- Die Gesellschaft als Realität sui generis
- Der soziologische Tatbestand als Gegenstandsbereich der Soziologie
- Die Methoden zur Erfassung des soziologischen Tatbestandes
- Die Abgrenzung der Soziologie von anderen Wissenschaften
- Die Etablierung der Soziologie als eigenständige Disziplin
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile - Die Gesellschaft als Realität sui generis“
Durkheim argumentiert, dass die Gesellschaft nicht einfach die Summe ihrer individuellen Mitglieder ist, sondern eine eigene Realität sui generis darstellt. Dies wird anhand des Beispiels von Bronze verdeutlicht, die durch die Legierung von Metallen eine neue Qualität erhält.
Kapitel 2: „Der soziologische Tatbestand als Gegenstand der Soziologie“
Durkheim definiert den „soziologischen Tatbestand“ als den Gegenstandsbereich der Soziologie. Dieser ist durch drei Merkmale gekennzeichnet: Äußerlichkeit, Zwangscharakter und Allgemeinheit. Soziologische Tatbestände sind Normen, die dem Individuum durch Sozialisation von außen auferlegt werden und unabhängig von dessen Willen existieren. Sie beeinflussen das Handeln des Einzelnen und bilden ein „Zusammenhang von Phänomenen sui generis“.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Essays sind: Emile Durkheim, Soziologie, Gesellschaft, Realität sui generis, soziologischer Tatbestand, Äußerlichkeit, Zwangscharakter, Allgemeinheit, Methoden, Abgrenzung, Institutionalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Warum bezeichnet Durkheim die Gesellschaft als „Realität sui generis“?
Durkheim argumentiert, dass die Gesellschaft mehr ist als die Summe ihrer Teile (Individuen). Sie besitzt eigene Qualitäten und Gesetzmäßigkeiten, die nicht allein durch Psychologie oder Biologie erklärt werden können.
Was ist ein „soziologischer Tatbestand“?
Ein soziologischer Tatbestand ist der Gegenstand der Soziologie. Er zeichnet sich durch drei Merkmale aus: Äußerlichkeit (existiert unabhängig vom Individuum), Zwangscharakter (übt Druck auf das Individuum aus) und Allgemeinheit.
Wie grenzt Durkheim die Soziologie von der Psychologie ab?
Während die Psychologie individuelle Bewusstseinszustände untersucht, befasst sich die Soziologie mit kollektiven Phänomenen und sozialen Normen, die von außen auf den Einzelnen wirken.
Welche Kritik übte Durkheim an Auguste Comte und Herbert Spencer?
Er warf ihnen vor, praxisfern und methodisch unzureichend zu forschen sowie eine rein individualistische Betrachtungsweise zu verfolgen, die keine echten soziologischen Erklärungen liefert.
Was ist das Ziel von Durkheims Werk „Die Regeln der soziologischen Methode“?
Das Ziel war die Etablierung der Soziologie als autonome, wissenschaftliche Disziplin mit einem eigenen Gegenstandsbereich und einer spezifischen wissenschaftlichen Methode.
- Quote paper
- Sebastian Wiesnet (Author), 2005, Die Etablierung der Soziologie als "Wissenschaft von den Institutionen" durch Emile Durkheim, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38250