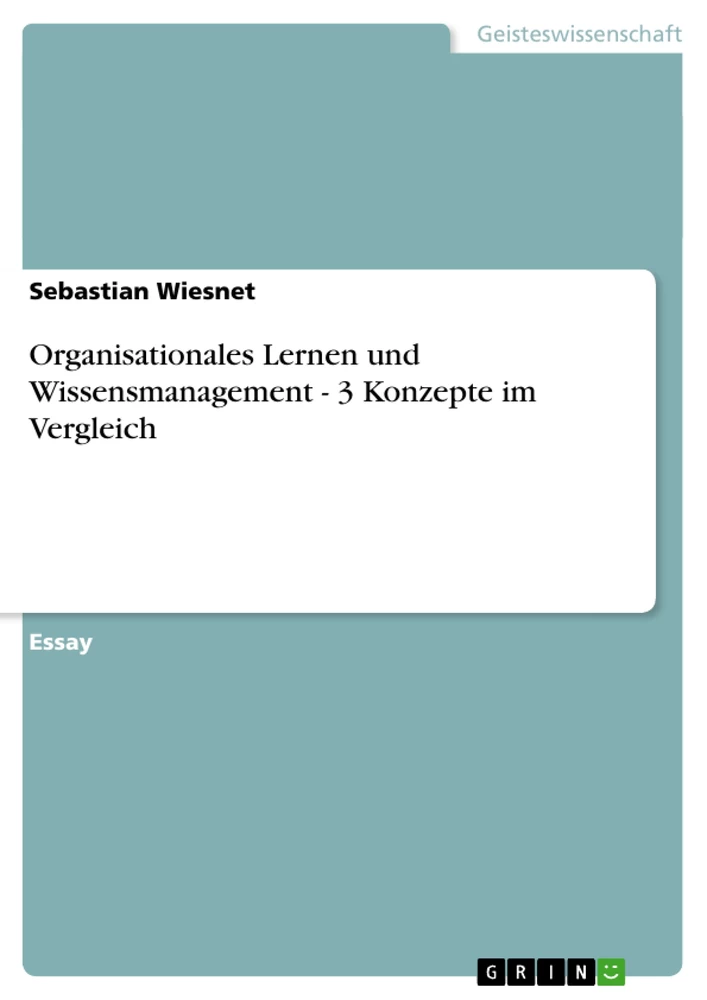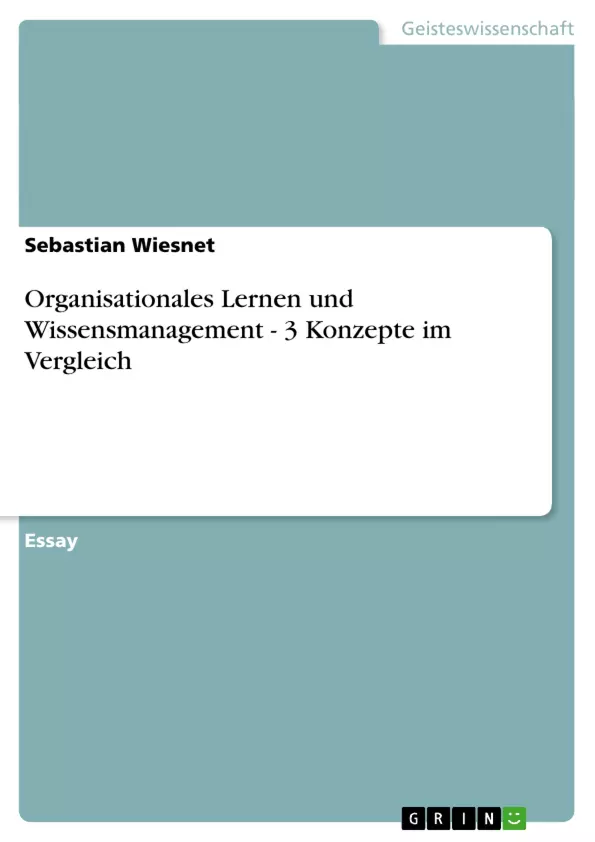Jede Theorie verlangt nach Selektion und jede Selektion beeinträchtigt das Erkenntnispotent ial und den Gültigkeitsbereich der Theorie. Nähert man sich einem äußerst komplexen und umfassenden Untersuchungsobjekt so wird bei dessen Analyse die Zahl derjenigen Aspekte, die man nicht berücksichtigen kann, wohl oder übel ein Ausmaß annehmen, das uns nicht wirklich erfreuen kann. Eine Organisation ist solch ein Untersuchungsobjekt. Man kann sich ihr aus verschiedenen (wissenschaftlichen) Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Methoden nähern, um einem von vielen möglichen Erkenntnisinteressen nachzugehen. Der Gegenstand der Erkenntnis, welcher in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehen soll, ist dabei relativ abstrakt; der Laie mag seine Existenz gänzlich bestreiten und die Experten sind sich uneins darüber, wie genau dieser Gegenstand beschaffen ist und wie er funktioniert: es geht um die Frage, wie Organisationen lernen (können). Um dieses Problem klären zu können, sollen im Folgenden die drei bekanntesten Konzepte von organisationalem Lernen und Wissensmanagement skizziert und anschließend kritisch beleuchtet werden, um deren Plausibilität und Wahrheitsgehalt – kurz: deren Erkenntnispotential – annähernd bestimmen zu können. Es handelt sich um das Konzept des Einschliefen- und Doppelschleifen-Lernens nach Argyris und Schoen (Kap. 1), die Theorie der Wissensbescha ffung im Unternehmen nach Nonaka und Takeuchi (Kap. 2), und um die Ausführungen von Karl Weick, der in der Auseinandersetzung mit der CODEStudie argumentiert, dass das Design einer Organisation keine stabile Gegebenheit, sondern eine fortwährende Improvisation ist. Aus dieser Annahme ergeben sich weitreichende Konsequenzen für das Verständnis von organisationalem Lernen und, damit verbunden, organisationalem Wandel. (Kap. 3)
Inhaltsverzeichnis
- Einschleifen-, Doppelschleifen- und Deuterolernen nach Argyris/Schoen
- Theorie der Wissensbeschaffung im Unternehmen nach Nonaka/Takeuchi
- Organisationales Design als Improvisation nach Weick
- Vergleichende Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay analysiert drei prominente Konzepte des organisationalen Lernens und Wissensmanagements, um deren Plausibilität und Erkenntnispotential zu bewerten. Die Untersuchung beleuchtet, wie Organisationen Wissen erwerben, verarbeiten und umsetzen, um sich an veränderte Bedingungen anzupassen und nachhaltig zu lernen.
- Organisationslernen als Reaktion auf Abweichungen zwischen erwarteten und tatsächlichen Handlungsergebnissen
- Die Rolle von Individuen und der Organisation als Ganzes im Lernprozess
- Verschiedene Arten des Lernens: Einschleifen-, Doppelschleifen- und Deuterolernen
- Die Bedeutung von Wissensbeschaffung und -management für die Organisation
- Das Konzept des organisationalen Designs als fortwährende Improvisation
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einschleifen-, Doppelschleifen- und Deuterolernen nach Argyris/Schoen
Dieses Kapitel stellt die Theorie des Einschleifen- und Doppelschleifen-Lernens von Argyris und Schoen vor. Die Autoren argumentieren, dass Organisationen lernen, indem sie auf Abweichungen zwischen ihren Zielen und den tatsächlichen Ergebnissen reagieren. Sie unterscheiden zwischen dem Einschleifen-Lernen, bei dem lediglich die Handlungsstrategie angepasst wird, und dem Doppelschleifen-Lernen, das eine Revision der zugrundeliegenden Werte und Normen erfordert.
Kapitel 2: Theorie der Wissensbeschaffung im Unternehmen nach Nonaka/Takeuchi
Dieses Kapitel befasst sich mit der Theorie der Wissensbeschaffung im Unternehmen von Nonaka und Takeuchi. Die Autoren analysieren, wie Unternehmen explizites und implizites Wissen durch verschiedene Prozesse wie Sozialisation, Externalisierung, Kombination und Internalisierung erwerben und weiterentwickeln.
Kapitel 3: Organisationales Design als Improvisation nach Weick
Dieses Kapitel befasst sich mit der Arbeit von Karl Weick, der argumentiert, dass das Design einer Organisation nicht statisch ist, sondern ein fortwährender Prozess der Improvisation. Weick untersucht, wie Organisationen in komplexen und dynamischen Umgebungen lernen, um sich anzupassen und zu überleben.
Schlüsselwörter
Organisationslernen, Wissensmanagement, Einschleifenlernen, Doppelschleifenlernen, Deuterolernen, Theorie der Wissensbeschaffung, organisationales Design, Improvisation, Wissensverankerung, Aktions- oder Handlungstheorie, espoused theory, theory in use, organisationaler Wandel.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Wiesnet (Autor:in), 2005, Organisationales Lernen und Wissensmanagement - 3 Konzepte im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38251