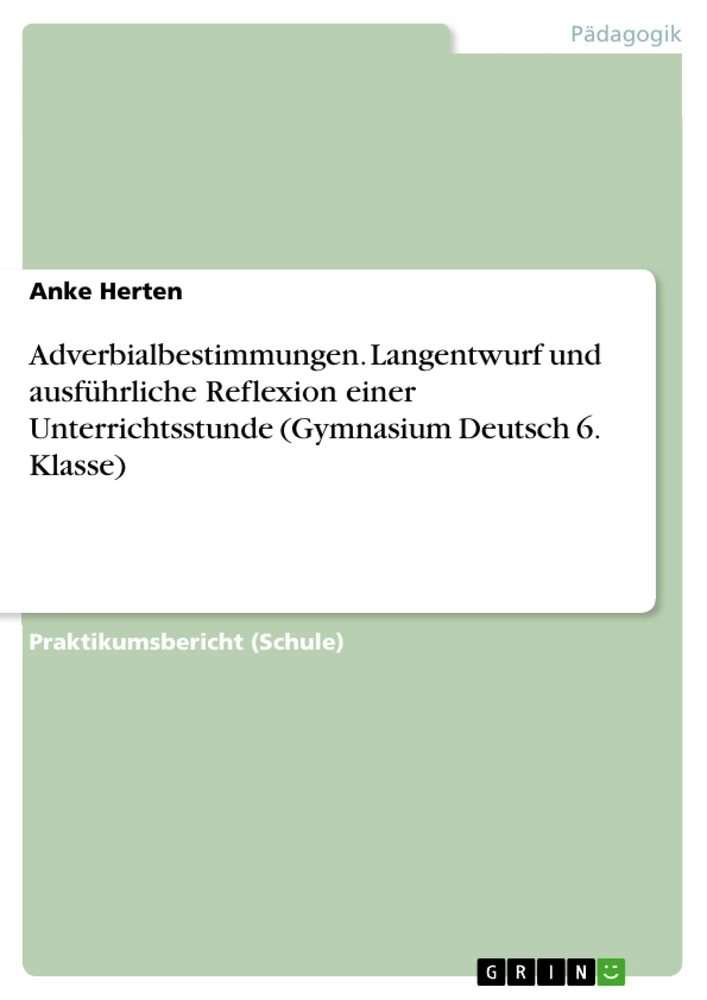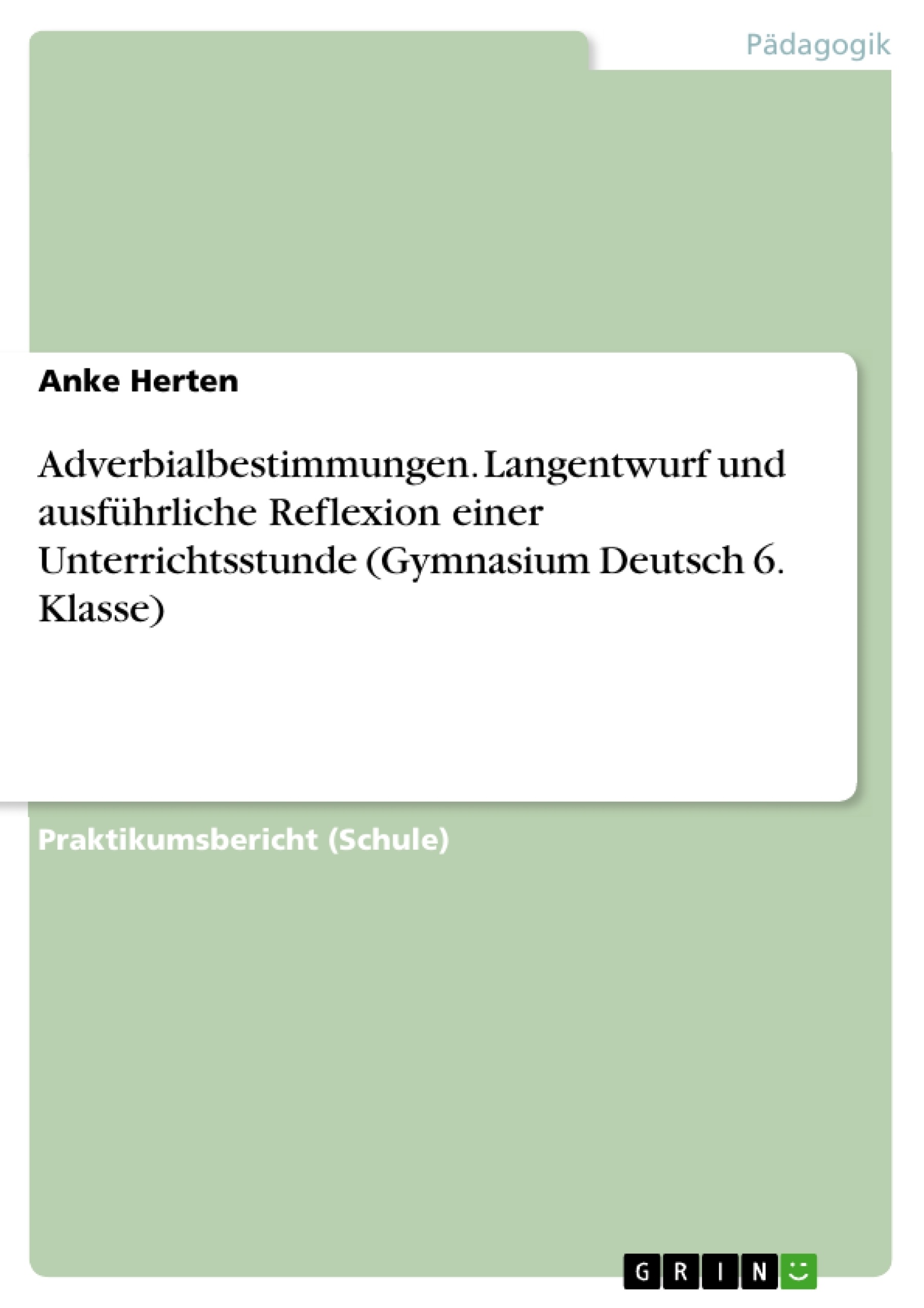Die hier vorgestellte Unterrichtseinheit zum Thema „Satzglieder/ Adverbialbestimmung“ umfasst sechs Doppelstunden und wurde mit einer Klassenarbeit abgeschlossen. Im Folgenden soll der Langentwurf die Unterrichtseinheit und eine der Doppelstunden ausführlich vorstellen und reflektieren. Die ausführliche dargestellte Doppelstunde behandelt die Funktion der Adverbialbestimmung.
Die Satzgliedanalyse ist eine wichtige Grundlage für das Verständnis der deutschen Sprache und soll die SuS in die Lage versetzen, Satzglieder nach Form und Funktion zu bestimmen und als Grundlage der Syntax zu verstehen. Im geplanten Unterricht stehen die Umstellprobe, die Frageproben und die AB mit ihrer Funktion im Fokus. Mithilfe der Glinzschen Umstellprobe kann ein Satz in seine Segmente zerlegt werden. Durch das Umstellen des Satzes wird deutlich, welche Wörter als Satzglieder zusammengehören. Mithilfe der Umstellprobe kann der Satz außerdem semantisch unterschiedlich akzentuiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Mein Fachpraktikum
- 2. Ausführlicher Unterrichtsentwurf
- 2.1 Stellung der Unterrichtseinheit im Unterrichtsgeschehen
- 2.2 Vorstellung der Unterrichtseinheit
- 2.3 Überlegungen zur Lerngruppe
- 2.4 Sachanalyse
- 2.5 Fachdidaktische Überlegungen
- 2.5.1 Didaktische Reduktion
- 2.5.2 Grob- und Feinziele des Unterrichts
- 2.5.3 Geplanter Unterrichtsverlauf
- 2.6 Methodische Überlegungen
- 3. Durchführung und fachdidaktische Reflexion der Unterrichtsstunde
- 4. Fachdidaktische Gesamtreflexion des Praktikums
- 5. Literaturverzeichnis
- 6. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Fachpraktikumsbericht beschreibt die Durchführung und Reflexion eines Deutsch-Fachpraktikums im Rahmen des Masterstudiums für das gymnasiale Lehramt. Der Fokus liegt auf der Vorstellung einer selbstentwickelten Unterrichtseinheit zum Thema „Satzglieder/ Adverbialbestimmung“ im 6. Jahrgang. Der Bericht beleuchtet die theoretischen Grundlagen, die Planung, die Durchführung und die Reflexion der Unterrichtseinheit, wobei insbesondere auf die didaktische Reduktion, die Festlegung von Zielen und den geplanten Unterrichtsverlauf eingegangen wird.
- Praktische Erprobung und Reflexion fachdidaktischer Theorien
- Steigerung der eigenen Lehrkompetenzen
- Entwicklung von Verstehens- und Verständigungskompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern
- Einführung und Vertiefung der Adverbialbestimmung als Satzglied
- Übung der Bestimmung von Satzgliedern im Textzusammenhang
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Mein Fachpraktikum Dieses Kapitel gibt einen allgemeinen Überblick über das Fachpraktikum und die Umgebung, in der es durchgeführt wurde. Hierbei werden die Schule, die Lerngruppe und die Organisation des Praktikums vorgestellt.
- Kapitel 2: Ausführlicher Unterrichtsentwurf Dieses Kapitel beinhaltet eine detaillierte Beschreibung der Unterrichtseinheit zum Thema „Satzglieder/ Adverbialbestimmung“, einschließlich der didaktischen Entscheidungen, der Lernziele und des geplanten Unterrichtsverlaufs.
- Kapitel 3: Durchführung und fachdidaktische Reflexion der Unterrichtsstunde Dieses Kapitel reflektiert die praktische Durchführung einer Doppelstunde innerhalb der Unterrichtseinheit. Es geht auf die Umsetzung der Planung, die Reaktion der Schülerinnen und Schüler und die erlebten Herausforderungen ein.
- Kapitel 4: Fachdidaktische Gesamtreflexion des Praktikums Dieses Kapitel bietet eine umfassende Rückschau auf das gesamte Fachpraktikum. Es werden die gewonnenen Erkenntnisse, die Reflexion der eigenen Lehrkompetenzen und die persönliche Entwicklung im Kontext des Praktikums beleuchtet.
Schlüsselwörter
Deutschdidaktik, Fachpraktikum, Sekundarstufe I, Satzgliedbestimmung, Adverbialbestimmung, Unterrichtseinheit, induktive Einführung, Lernwerkstatt, Klassenarbeit, Lerngruppe, Heterogenität, Inklusion, didaktische Reduktion, Unterrichtsverlauf, methodische Überlegungen, Reflexion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer Unterrichtseinheit zu Adverbialbestimmungen?
Schüler sollen lernen, Satzglieder nach Form und Funktion zu bestimmen und die Adverbialbestimmung als Grundlage der Syntax zu verstehen.
Was ist die Glinzsche Umstellprobe?
Es ist eine Methode zur Satzgliedanalyse, bei der Wörter im Satz umgestellt werden, um zu erkennen, welche Teile eine Sinneinheit (Satzglied) bilden.
Warum ist die didaktische Reduktion im Deutschunterricht wichtig?
Sie ermöglicht es, komplexe grammatikalische Themen für eine 6. Klasse so aufzubereiten, dass die wesentlichen Funktionen verständlich und lernbar bleiben.
Welche Rolle spielt die Heterogenität der Lerngruppe?
Die Planung muss verschiedene Leistungsniveaus berücksichtigen, um Inklusion und individuellen Lernerfolg in einer Gymnasialklasse zu gewährleisten.
Wie wird die Funktion der Adverbialbestimmung vermittelt?
Durch induktive Einführung und Frageproben lernen die SuS, wie Adverbialbestimmungen Umstände wie Zeit, Ort, Art und Weise oder Grund näher erläutern.
- Arbeit zitieren
- Anke Herten (Autor:in), 2017, Adverbialbestimmungen. Langentwurf und ausführliche Reflexion einer Unterrichtsstunde (Gymnasium Deutsch 6. Klasse), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/382575