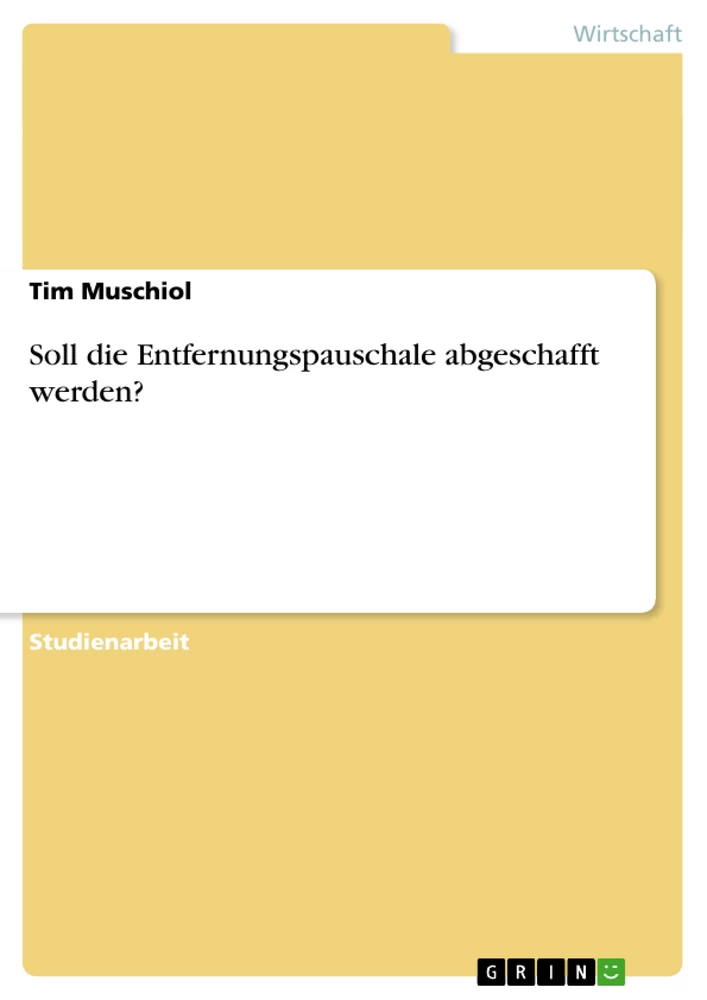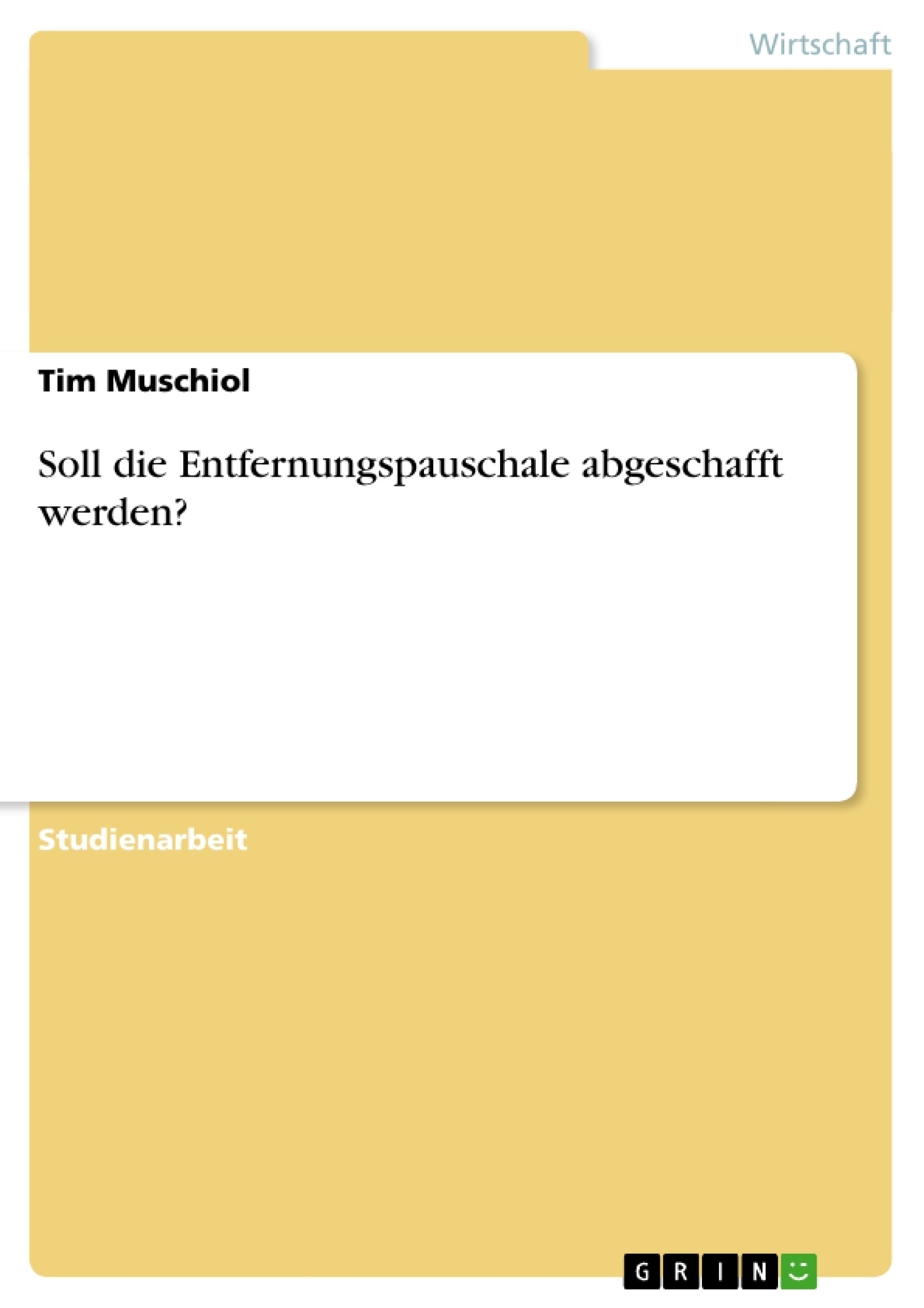Zum 01. Januar 2004 wurde erneut eine Änderung der gesetzlichen Behandlung der Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte beschlossen. Diesmal wird die Maßnahme als Steuersubventionsabbau ausgelegt, obwohl die gleiche Regierung drei Jahre zuvor die Entfernungspauschale gerade einführte, um mit der „steuerlichen Entlastungswirkung Wettbewerbsgleichheit zwischen den Verkehrsträgern [zu] schaffen“1.
So unterschiedlich die gesetzliche Regelung in Deutschland schon gestaltet war, so mannigfaltig sind die Ansichten bezüglich der Entfernungspauschale. Umstritten ist dabei nicht nur die generelle Anerkennung dieser Werbungskosten aus normativer Sicht, sondern ebenso die im deutschen Steuerrecht niedergelegte Regelung an sich: Dabei wird zum einen über ihre Höhe und zum anderen über die gesetzliche Umsetzung der Entfernungspauschale debattiert. Auch international besteht Unstimmigkeit über die Behandlung dieser Kosten: gewähren die Amerikaner und die Briten gar keinen Abzug, lässt die schweizer und finnische Lösung nur einen Abzug der Kosten in Höhe öffentlicher Verkehrsmittel zu. In den Niederlanden ist ein Ansatz unabhängig, hingegen ist die belgische und die ehemalig deutsche Regelung abhängig vom gewählten Verkehrsmittel.
Schon im Vorfeld sorgte die jetzt beschlossene Gesetzesänderung für Diskussionsbeiträge der unterschiedlichsten Interessengruppierungen: Abgesehen von der korrekten steuersystematischen Behandlung und der ökonomischen Wirkung sei die jetzige Regelung vor allem aus umwelt-, verkehrs- und siedlungspolitischen Überlegungen fragwürdig. Doch auch die wirtschaftswissenschaftlichen Ansichten divergieren in vielen Punkten: Fallen die Fahrten von der Wohnung zur Arbeit in die private Sphäre, weil der Arbeitnehmer sich schließlich frei entscheiden kann, wo er leben möchte oder sind die Fahrten gerade durch die Arbeit induziert, weil der Steuerpflichtige diese sonst gar nicht tätigte? Im ersten Fall wären die Kosten der Fahrt zur und von der Arbeit nicht, im zweiten Fall jedoch explizit bei der Besteuerung zu berücksichtigen.
Daher ist es Ziel dieser Arbeit, die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Entfernungspauschale zu erläutern und in Hinblick auf ihre Gerechtigkeit die unterschiedlichen Argumente darzulegen, um prüfen zu können, ob die Entfernungspauschale abgeschafft werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung.
- B. Kriterien für eine Beurteilung der Entfernungspauschale.
- 1. Ziel einer Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip.
- 2. Ökonomische Einordnung.
- 3. Umwelt- und verkehrpolitische Zielsetzungen.
- C. Beschreibung der gesetzlichen Regelung der aktuellen Entfernungspauschale.
- 1. Pauschale Abgeltung, Höchstbetrag und Verkehrsmittelunabhängigkeit.
- 2. Ermittlung der maßgeblichen Entfernung.
- 3. Entfernungspauschale ohne tatsächlich entstandene Aufwendungen.
- D. Analyse und Beurteilung der Entfernungspauschale.
- 1. Verstöße gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip.
- 2. Ökonomische Einordnung.
- 3. Eignung als umwelt- und verkehrpolitisches Lenkungsinstrument.
- E. Fazit und abschließende Bewertung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der aktuellen Diskussion um die Entfernungspauschale in Deutschland. Ziel ist es, die verschiedenen Perspektiven auf diese Steuerregelung zu beleuchten und die Argumente für und gegen ihre Abschaffung zu analysieren. Dabei werden insbesondere die Aspekte der Gerechtigkeit, der ökonomischen Auswirkungen und der umwelt- und verkehrspolitischen Relevanz der Entfernungspauschale betrachtet.
- Bewertung der Entfernungspauschale im Kontext des Leistungsfähigkeitsprinzips.
- Analyse der ökonomischen Auswirkungen der Entfernungspauschale auf die Arbeitsmarktgestaltung und das verfügbare Einkommen.
- Beurteilung der Entfernungspauschale als Instrument der Umwelt- und Verkehrspolitik.
- Diskussion verschiedener Ansätze zur Gestaltung der Entfernungspauschale im internationalen Vergleich.
- Bewertung der Argumente für und gegen die Abschaffung der Entfernungspauschale.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Problematik der Entfernungspauschale und ihrer Bedeutung in der deutschen Steuerpolitik. Es wird darauf hingewiesen, dass die Regelung in der Vergangenheit mehrmals geändert wurde und Gegenstand kontroverser Diskussionen ist.
Im zweiten Kapitel werden die Kriterien für eine Beurteilung der Entfernungspauschale anhand des Leistungsfähigkeitsprinzips, der ökonomischen Einordnung und der umwelt- und verkehrspolitischen Zielsetzungen vorgestellt.
Kapitel C beschreibt die gesetzliche Regelung der aktuellen Entfernungspauschale, einschließlich der Pauschalen Abgeltung, der Höchstbeträge und der Verkehrsmittelunabhängigkeit.
Kapitel D analysiert und beurteilt die Entfernungspauschale aus verschiedenen Perspektiven. Es werden insbesondere die Verstöße gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip, die ökonomischen Auswirkungen und die Eignung als Lenkungsinstrument im Bereich der Umwelt- und Verkehrspolitik untersucht.
Schlüsselwörter
Entfernungspauschale, Leistungsfähigkeitsprinzip, Ökonomische Effizienz, Umweltpolitik, Verkehrspolitik, Steuerrecht, Arbeitsmarkt, Kosten der Arbeit, Einkommensverteilung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Leistungsfähigkeitsprinzip im Steuerrecht?
Es besagt, dass jeder Bürger entsprechend seiner wirtschaftlichen Kraft zur Finanzierung des Staates beitragen soll. Werbungskosten wie Fahrtkosten mindern diese Leistungsfähigkeit.
Gehören Fahrtkosten zur Arbeit zur privaten Lebensführung?
Darüber wird gestritten. Ein Ansatz sagt: Ja, da der Wohnort frei wählbar ist. Der andere sagt: Nein, die Kosten sind beruflich veranlasst, da man ohne Job nicht pendeln müsste.
Ist die Entfernungspauschale ein ökologisches Lenkungsinstrument?
Kritiker bezweifeln das, da sie unabhängig vom Verkehrsmittel gezahlt wird und somit auch weite Pendelstrecken mit dem Auto steuerlich fördert, was Zersiedelung begünstigen kann.
Wie wird die Entfernungspauschale international gehandhabt?
In den USA und Großbritannien gibt es meist gar keinen Abzug. Finnland und die Schweiz erlauben oft nur den Abzug in Höhe der Kosten für öffentliche Verkehrsmittel.
Sollte die Entfernungspauschale abgeschafft werden?
Die Arbeit analysiert Argumente für beide Seiten: Eine Abschaffung würde Steuersubventionen abbauen, könnte aber Pendler mit geringem Einkommen unverhältnismäßig hart treffen.
- Citation du texte
- Tim Muschiol (Auteur), 2004, Soll die Entfernungspauschale abgeschafft werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38288