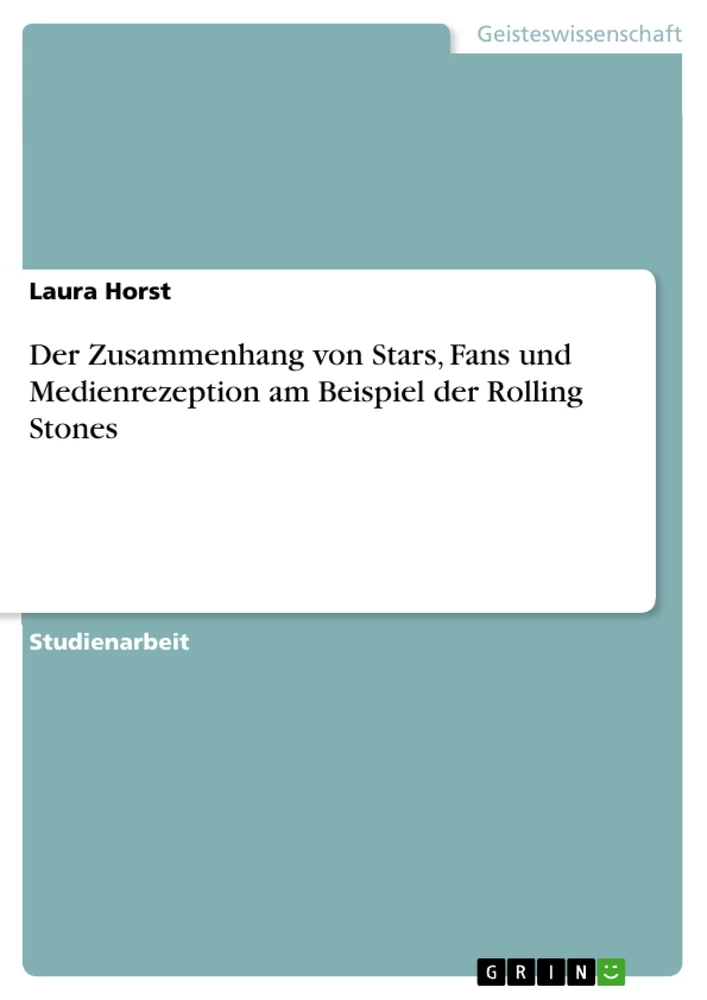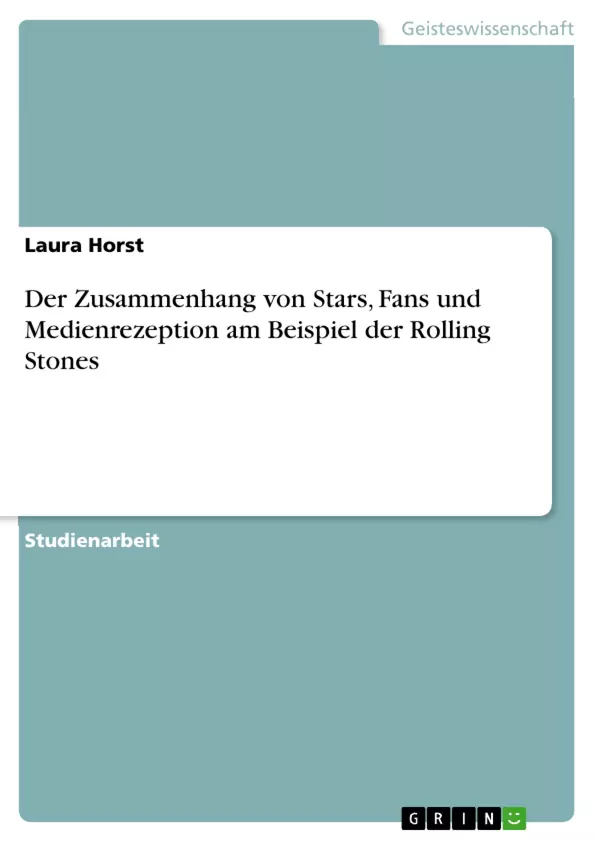Diese Arbeit möchte das Verhältnis zwischen Fans, Stars und der Medienrezeption untersuchen. Daher wird zunächst die Medienrezeption erklärt, wobei die Produktion von Bedeutung durch das Kommunikat und den Rezipienten eine große Rolle spielt. In einem weiteren Schritt ist zu bestimmten, was einen ‚Star‘ ausmacht und welche Rolle dabei der Begriff des ‚Image‘ spielt.
Im fünften Kapitel sollen diese einzelnen Aspekte dann miteinander verknüpft werden. Verdeutlicht werden soll ein Zusammenhang dieser Aspekte am Beispiel der britischen Rockgruppe ‚The Rolling Stones‘. Betrachtet werden dabei die Band und das Verhalten ihrer Fans gegen Ende der 1960er Jahre. Von Bedeutung ist dabei auch der kulturelle Hintergrund, denn die Rolling Stones zählten in ihren Anfangsjahren vor allem Personen aus der sogenannten ‚Subkultur‘ zu ihren Fans. Dieser kulturelle Hintergrund spielt zum einen eine Rolle für die Wahrnehmung der Stones durch ihre Fans, zum anderen aber auch für die Rezeption der Musikstücke dieser Band. Die Protestkultur ist dabei von Interesse, da sie eine besondere Art und Weise der Aneignung medialer Kommunikate darstellt. In diesem Kontext spielt, wie später gezeigt wird, das Lied ‚Street Fighting Man‘, das 1968 von den Rolling Stones veröffentlicht wurde, eine große Rolle, denn es inspirierte viele Anhänger der Stones und motivierte sie zu Protesthandlungen.
Ziel ist es dabei zu zeigen, dass die Wahrnehmung eines Stars durch seine kulturellen Produkte mitbestimmt wird sowie dass umgekehrt das Image, das einem Star anhaftet, mitbestimmt, wie der Fan die kulturellen Produkte wahrnimmt, die der Star hervorbringt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fans
- Medienrezeption
- Der Star und sein Image
- Die Rolling Stones
- Das Image der Rolling Stones
- Die Rezeption von,Street Fighting Man'
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis zwischen Fans, Stars und der Medienrezeption. Das Hauptziel besteht darin, den Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung eines Stars durch seine kulturellen Produkte und dem Einfluss des Images des Stars auf die Rezeption dieser Produkte durch den Fan zu untersuchen. Im Vordergrund steht dabei das Beispiel der britischen Rockgruppe "The Rolling Stones" und ihre Fans gegen Ende der 1960er Jahre.
- Wissenschaftliche Definition des Begriffs "Fan" im Vergleich zum alltäglichen Verständnis.
- Die Rolle der Medienrezeption in der Produktion von Bedeutung.
- Das Konzept des "Stars" und der Bedeutung des "Images".
- Die Rezeption von Musik im Kontext der Protestkultur der 1960er Jahre am Beispiel des Rolling Stones-Songs "Street Fighting Man".
- Der Einfluss des kulturellen Kontextes auf die Wahrnehmung von Stars und deren Produkten.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert den wissenschaftlichen Fokus auf die Beziehung zwischen Fans, Stars und der Medienrezeption.
- Das zweite Kapitel definiert den Begriff "Fan" im wissenschaftlichen Kontext und untersucht die Entstehung des Fanbegriffs im Zusammenhang mit dem Aufkommen von Stars und der Entwicklung der Massenmedien.
- Das dritte Kapitel widmet sich dem Prozess der Medienrezeption und betont die Bedeutung der Produktion von Bedeutung durch den Rezipienten und das Rezipiat.
- Das vierte Kapitel beleuchtet den Begriff des "Stars" und die Bedeutung des "Images" für die Wahrnehmung des Stars durch seine Fans.
- Das fünfte Kapitel analysiert die Rolling Stones als Fallbeispiel und untersucht das Image der Band und die Rezeption des Songs "Street Fighting Man" im Kontext der Protestkultur der 1960er Jahre.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themenbereichen Fanforschung, Medienrezeption, Star- und Imagekonstruktion, Protestkultur und der Rezeption von Musik im Kontext der 1960er Jahre. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Beispiel der Rolling Stones zu, das als Fallstudie für die Interaktion von Fans, Stars und Medien fungiert.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird das Verhältnis zwischen Stars und Fans definiert?
Das Verhältnis ist geprägt von der Medienrezeption und der Produktion von Bedeutung. Ein Fan identifiziert sich über das Image des Stars mit dessen kulturellen Produkten.
Welche Rolle spielt das "Image" eines Stars?
Das Image bestimmt maßgeblich, wie Fans die Werke eines Stars wahrnehmen. Umgekehrt beeinflussen die Produkte (z. B. Songs) die Festigung oder den Wandel des Images.
Warum sind die Rolling Stones ein wichtiges Beispiel für Fanforschung?
Die Band verkörperte Ende der 1960er Jahre ein rebellisches Image, das eng mit der damaligen Subkultur und Protestbewegung verknüpft war.
Wie beeinflusste der Song "Street Fighting Man" die Rezeption?
Das Lied von 1968 motivierte Anhänger zu Protesthandlungen und wurde als Ausdruck der gesellschaftlichen Unruhen wahrgenommen, was das Image der Stones als "Outlaws" festigte.
Was unterscheidet den wissenschaftlichen Fanbegriff vom Alltagsverständnis?
Wissenschaftlich wird der Fan im Kontext der Massenmedien und der aktiven Aneignung von Inhalten betrachtet, statt nur als passiver Konsument.
- Citar trabajo
- Laura Horst (Autor), 2013, Der Zusammenhang von Stars, Fans und Medienrezeption am Beispiel der Rolling Stones, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383024