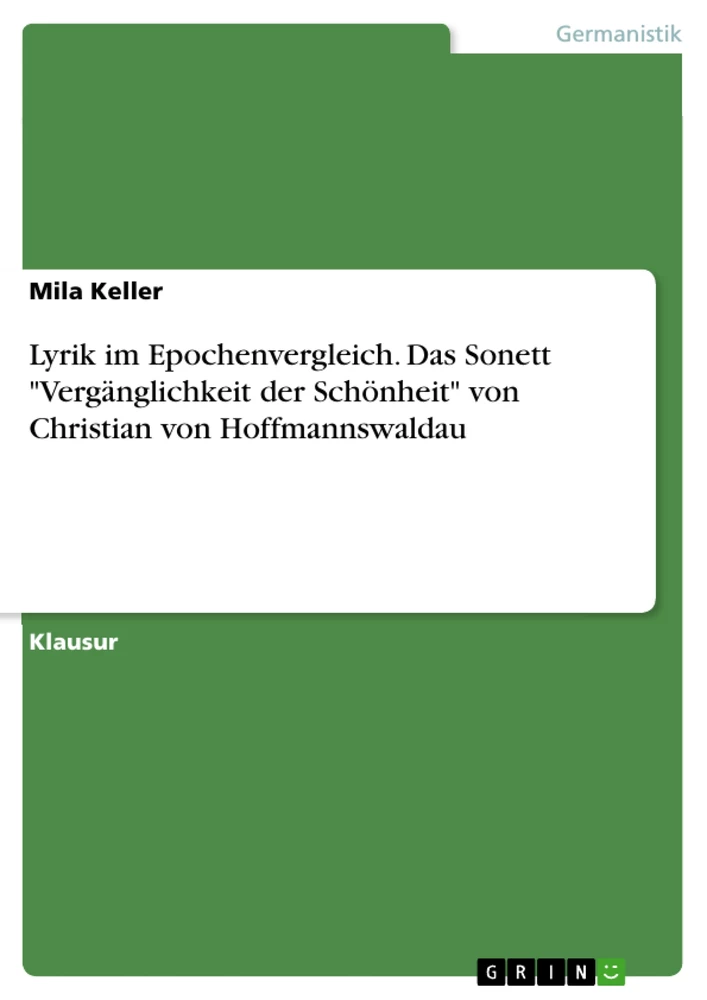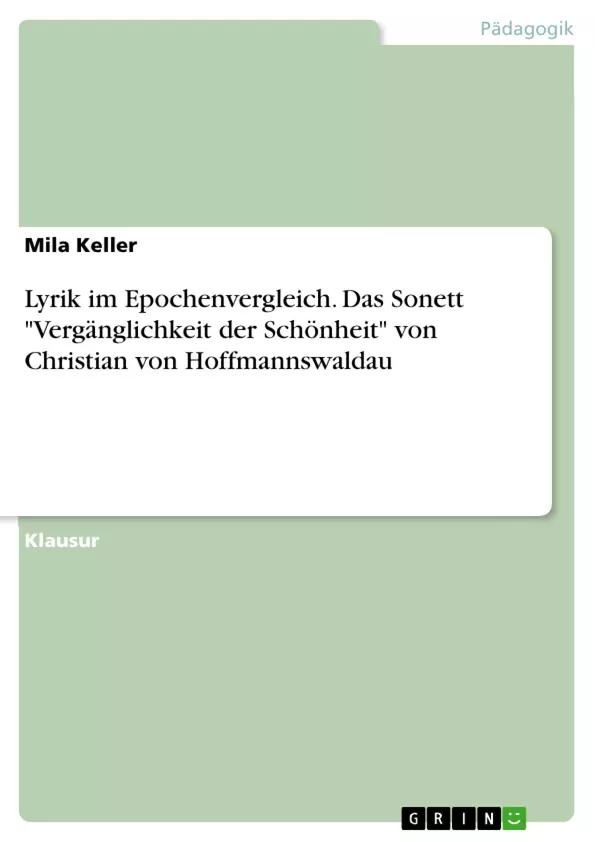Das Sonett „Vergänglichkeit der Schönheit“ von Christian von Hoffmanswaldau erschien 1695 und thematisiert, wie der Titel schon sagt, dass Schönheit nicht ewig währt, aber das Herz immer bestehen bleibt.
Dieses Gedicht entstammt aus der Zeit des Barrock (1600-1750), einer sehr zerrissenen Zeitepoche. Der Dreißigjährige Krieg und die Pest führen den Menschen vor Augen, wie vergänglich das Leben eigentlich ist, „vanitas vanitorum“. Auch „carpe diem!“ (Nutze den Tag!) und „memento mori“ (Denke daran, dass du stirbst) sind Leitmotive dieser Epoche. Die Lyrik wurde inspiriert aus dem Italienischen und erstmals in Deutsch verfasst. Vorher war Latein die genutzte Sprache in der Dichtkunst gewesen. Das „höfische Theater“ wurde von dem Drama an der Oper beeinflusst und unterlag vor allen Dingen einem sehr strengen Regelwerk. Dichtkunst war handwerklich erlernbar. So schrieb Opitz ein komplettes Buch über die Dichtkunst und welche Regeln es zu beachten gab, wie man zum Beispiel eine hübsche Frau mit Metaphern beschrieb.
Inhaltsverzeichnis
- Vergänglichkeit der Schönheit
- Formale Aspekte des Sonetts
- Stilmittel und Interpretation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Christian von Hoffmanswaldau's Sonett „Vergänglichkeit der Schönheit“, erschienen 1695. Die Zielsetzung ist es, die formalen und inhaltlichen Aspekte des Gedichts im Kontext des Barock zu untersuchen und seine Bedeutung zu interpretieren.
- Das Motiv der Vergänglichkeit der Schönheit im Barock
- Formale Elemente des Sonetts (Metrum, Reimschema)
- Verwendung von Stilmitteln (Metaphern, Antithesen, Oxymoron)
- Die Beziehung zwischen lyrischem Ich und „Du“
- Das Motiv der Beständigkeit des Herzens
Zusammenfassung der Kapitel
Vergänglichkeit der Schönheit: Das Sonett thematisiert die Unausweichlichkeit des Todes und die Vergänglichkeit körperlicher Schönheit, repräsentiert durch Leitmotive wie „memento mori“ und „vanitas vanitorum“. Es beschreibt den Verfall äußerer Attraktivität mit konkreten Beispielen (verblassendes Haar, bleiche Haut) und verwendet Metaphern wie „warmer Schnee“ und „kalter Sand“, um den Kontrast zwischen Jugend und Alter zu verdeutlichen. Obwohl die äußere Schönheit vergeht, betont das Gedicht die Beständigkeit des Herzens als etwas Kostbares und Wertvolles, vergleichbar mit einem Diamanten.
Formale Aspekte des Sonetts: Das Gedicht folgt streng der Sonettform mit 14 Versen, aufgeteilt in zwei Quartette und zwei Terzette im Alexandriner. Das Reimschema (abba abba ccd eed) und das Metrum (Jambus) unterstreichen die formale Struktur. Die Analyse der formalen Elemente zeigt die handwerkliche Meisterschaft des Dichters und die Bedeutung der Form für den Ausdruck des Inhalts. Die strenge äußere Form spiegelt sich auch in der Verwendung von Stilmitteln wider, wie der Anapher „Der“ in den Zeilen 3-5, die die kontinuierliche Abnahme der Schönheit betont.
Stilmittel und Interpretation: Hoffmanswaldau verwendet zahlreiche Stilmittel, um seine Botschaft zu verstärken. Metaphern wie „Der liebliche Korall der Lippen“ visualisieren die Schönheit, während Antithesen wie „warmer Schnee“ und „kalter Sand“ den Kontrast zwischen Jugend und Alter hervorheben. Die Personifikation des Todes („Es wird der bleiche Tod […] um deine Brüste streichen“) erzeugt ein eindringliches Bild. Die im Gedicht verwendete Antithetik zwischen „untergehen“ und „bestehen“ im letzten Terzett unterstreicht den zentralen Gegensatz zwischen Vergänglichkeit und Beständigkeit. Die Metapher des Herzens als Diamant symbolisiert die unzerstörbare innere Schönheit und Liebe.
Schlüsselwörter
Vergänglichkeit, Schönheit, Barock, Sonett, Memento Mori, Vanitas Vanitorum, Metapher, Antithese, Herz, Beständigkeit, Lyrik, Alexandriner, Hoffmanswaldau.
Häufig gestellte Fragen zu Christian von Hoffmanswaldau's Sonett "Vergänglichkeit der Schönheit"
Was ist der Gegenstand der Analyse?
Die Analyse konzentriert sich auf Christian von Hoffmanswaldau's Sonett "Vergänglichkeit der Schönheit" (erschienen 1695). Es werden die formalen und inhaltlichen Aspekte des Gedichts im Kontext des Barock untersucht, um dessen Bedeutung zu interpretieren.
Welche Themen werden im Sonett behandelt?
Das zentrale Thema ist die Vergänglichkeit der Schönheit im Kontrast zur Beständigkeit des Herzens. Weitere Motive sind "memento mori" und "vanitas vanitorum". Das Gedicht beschreibt den körperlichen Verfall und stellt diesen der inneren, unzerstörbaren Schönheit gegenüber.
Welche formalen Aspekte werden analysiert?
Die Analyse umfasst die strenge Einhaltung der Sonettform (14 Verse, zwei Quartette, zwei Terzette im Alexandriner), das Reimschema (abba abba ccd eed) und das Metrum (Jambus). Die Untersuchung der formalen Elemente zeigt die handwerkliche Meisterschaft des Dichters und die Bedeutung der Form für den Ausdruck des Inhalts.
Welche Stilmittel werden im Sonett verwendet und welche Wirkung erzielen sie?
Hoffmanswaldau nutzt diverse Stilmittel wie Metaphern (z.B. "warmer Schnee", "kalter Sand", "Der liebliche Korall der Lippen"), Antithesen (z.B. der Gegensatz zwischen Vergänglichkeit und Beständigkeit), Oxymoron und Anaphern. Diese Stilmittel verstärken die Botschaft und erzeugen eindringliche Bilder, die den Kontrast zwischen äußerer und innerer Schönheit verdeutlichen.
Wie wird die Beziehung zwischen lyrischem Ich und dem "Du" dargestellt?
Die Analyse beleuchtet die Beziehung zwischen dem lyrischen Ich und dem "Du", das sich an die Adressatin des Gedichts richtet. Die genaue Natur dieser Beziehung wird durch die Interpretation des Gedichts im Kontext der barocken Ästhetik erschlossen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Sonett und die Analyse?
Schlüsselwörter sind: Vergänglichkeit, Schönheit, Barock, Sonett, Memento Mori, Vanitas Vanitorum, Metapher, Antithese, Herz, Beständigkeit, Lyrik, Alexandriner, Hoffmanswaldau.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist deren Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu „Vergänglichkeit der Schönheit“, „Formale Aspekte des Sonetts“ und „Stilmittel und Interpretation“. Jedes Kapitel analysiert einen Aspekt des Sonetts detailliert, wobei die Kapitel aufeinander aufbauen und sich gegenseitig ergänzen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Analyse?
Die Analyse zielt darauf ab, die formalen und inhaltlichen Aspekte des Sonetts im Kontext des Barock zu untersuchen und dessen Bedeutung zu interpretieren. Es geht um das Verständnis der poetischen Mittel und der Aussage des Gedichts.
Für wen ist diese Analyse gedacht?
Diese Analyse ist für akademische Zwecke bestimmt und richtet sich an Personen, die sich mit der barocken Lyrik, dem Werk von Christian von Hoffmanswaldau und der Interpretation von Gedichten auseinandersetzen wollen.
- Quote paper
- Mila Keller (Author), 2016, Lyrik im Epochenvergleich. Das Sonett "Vergänglichkeit der Schönheit" von Christian von Hoffmannswaldau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383143