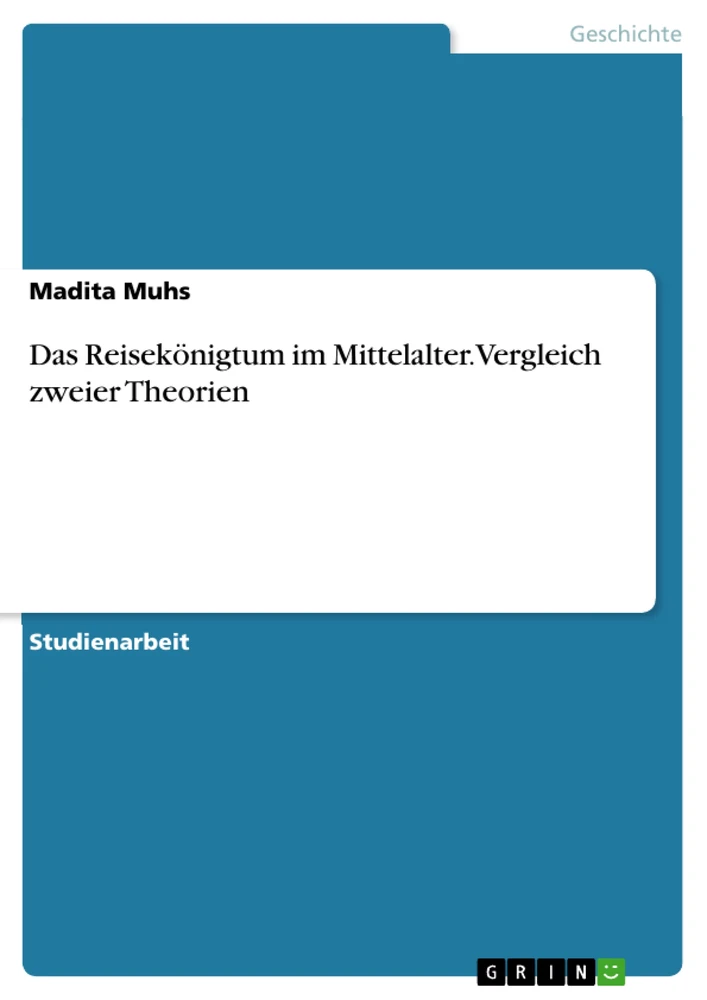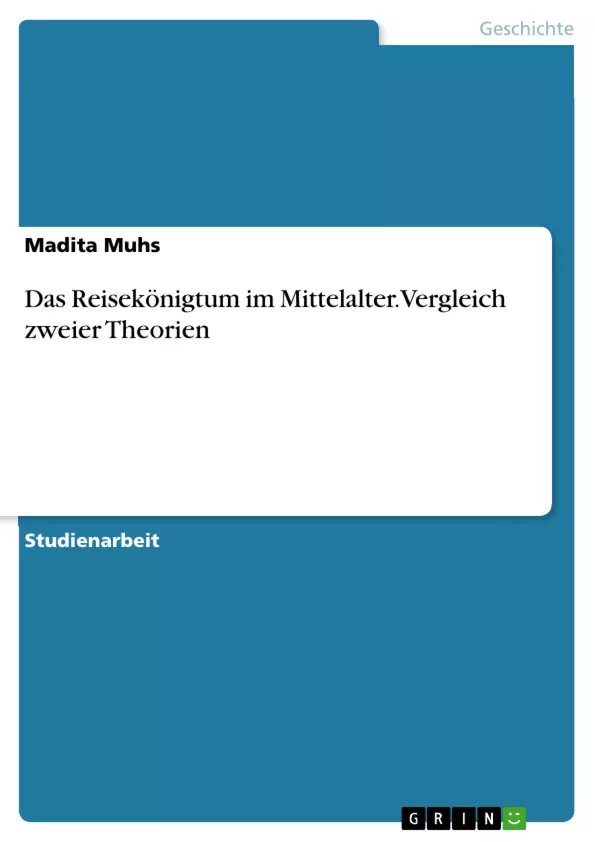Könige regierten im Mittelalter ohne eine feste Residenz. Politische Zentren, wie wir sie heute als Hauptstädte von Staaten kennen und von denen der König seine Handlungen ausführte, existierten nicht.
Doch wie war es den Königen dann möglich ihren Herrschaftsbereich zu regieren und im Überblick zu behalten? Erst im späteren Mittelalter kam es zu einem Wandel der gesellschaftlichen Welt im deutschen Reich und zu einer Entfaltung der Städte. Wirft man einen Blick auf die geographische Fläche, die das heutige Europa darstellt, erkennt man ein mittelmäßig entwickeltes deutsches Reich, das zivilisatorisch hinter Italien und Frankreich liegt, aber moderner als Ost- und Nordeuropa ist.
Der damals mächtigste Adel war der Deutsche. Denn nur der deutsche König konnte Kaiser werden und somit die Tradition des römischen Imperiums der Antike aufrechterhalten. Das Papsttum galt als die universale Kraft. Allein deswegen war der Kaiser berechtigt und verpflichtet mit dem Papsttum und Norditalien in Kontakt zu treten. Der Adel baute die regionalen Herrschaften stärker aus, was dazu führte, dass Bischöfe zu Reichsfürsten wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Das Regieren zu Zeiten der Ottonen......
- Theoretische Einbettung.....
- Die Abweidetheorie........
- Die Präsenztheorie..\n
- Beide Theorien im Vergleich .....
- Quellenverzeichnis.……………………..\n
- Literaturverzeichnis\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie die Ottonen ihr Herrschaftsgebiet ohne eine feste Residenz regierten. Sie untersucht die Gründe für diese Art der Regierung und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen und Konflikte. Die Arbeit analysiert zwei Theorien, die das Reisekönigtum der Ottonen erklären wollen, nämlich die Abweide- und die Präsenztheorie.
- Die Bedeutung des Reisekönigtums in der ottonischen Herrschaftszeit
- Die Abweide- und Präsenztheorie als Erklärungsansätze für das Reisekönigtum
- Die Herausforderungen und Konflikte, die durch das Reisekönigtum entstanden sind
- Der Vergleich der beiden Theorien und deren Erklärungskraft für die Regierungsweise der Ottonen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung gibt einen Überblick über die Problematik des Regierens ohne feste Residenz im Mittelalter. Sie stellt die historischen und geografischen Rahmenbedingungen des Deutschen Reiches zur Zeit der Ottonen dar und erläutert die Bedeutung des Kaisertums für die Ottonen. Die Einleitung führt in die zentrale Fragestellung der Arbeit ein und legt die theoretischen Ansätze dar, die im weiteren Verlauf untersucht werden sollen.
- Das Regieren zu Zeiten der Ottonen: Dieses Kapitel stellt die ottonische Dynastie und ihre Regierungsweise vor. Es beschreibt die wichtigsten Akteure in der ottonischen Reichsverwaltung, wie den König, seine Boten und die Grafen, und analysiert deren Rollen und Machtverhältnisse. Außerdem werden die zentralen Aufgaben des Königs, wie die Organisation des Militärs, die Rechtsprechung und die Verwaltung, dargestellt. Das Kapitel zeigt die Herausforderungen, die mit dem Fehlen einer festen Residenz einhergingen, und skizziert die Entwicklungen, die zu einer Dezentralisierung der Macht führten.
- Theoretische Einbettung: In diesem Kapitel werden die beiden Theorien, die das Reisekönigtum der Ottonen erklären sollen, vorgestellt. Zuerst wird die Abweidetheorie beleuchtet, die davon ausgeht, dass der König durch seine Reisen das gesamte Reich kontrollieren und die Machtverhältnisse im Auge behalten konnte. Anschließend wird die Präsenztheorie dargestellt, die den Fokus auf die Präsenz des Königs an verschiedenen Orten im Reich legt. Diese Theorie betont die Bedeutung des persönlichen Auftretens des Königs, um seine Autorität zu festigen und die Loyalität seiner Gefolgsleute zu sichern.
- Beide Theorien im Vergleich: Im letzten Kapitel werden die Abweide- und die Präsenztheorie einander gegenübergestellt und kritisch bewertet. Das Kapitel analysiert die Stärken und Schwächen beider Theorien und diskutiert, inwiefern sie die Regierungsweise der Ottonen adäquat erklären können. Die Diskussion basiert auf den im vorhergehenden Kapitel vorgestellten Quellen und historischen Ereignissen.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Reisekönigtum der Ottonen. Dabei stehen zentrale Themen wie die ottonische Reichsverwaltung, die Machtverhältnisse innerhalb des Reiches, die Herausforderungen des Regierens ohne feste Residenz und die Bedeutung des persönlichen Auftretens des Königs im Vordergrund. Die beiden wichtigsten Theorien, die das Reisekönigtum der Ottonen erklären wollen, sind die Abweide- und die Präsenztheorie.
- Arbeit zitieren
- Madita Muhs (Autor:in), 2017, Das Reisekönigtum im Mittelalter. Vergleich zweier Theorien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383149