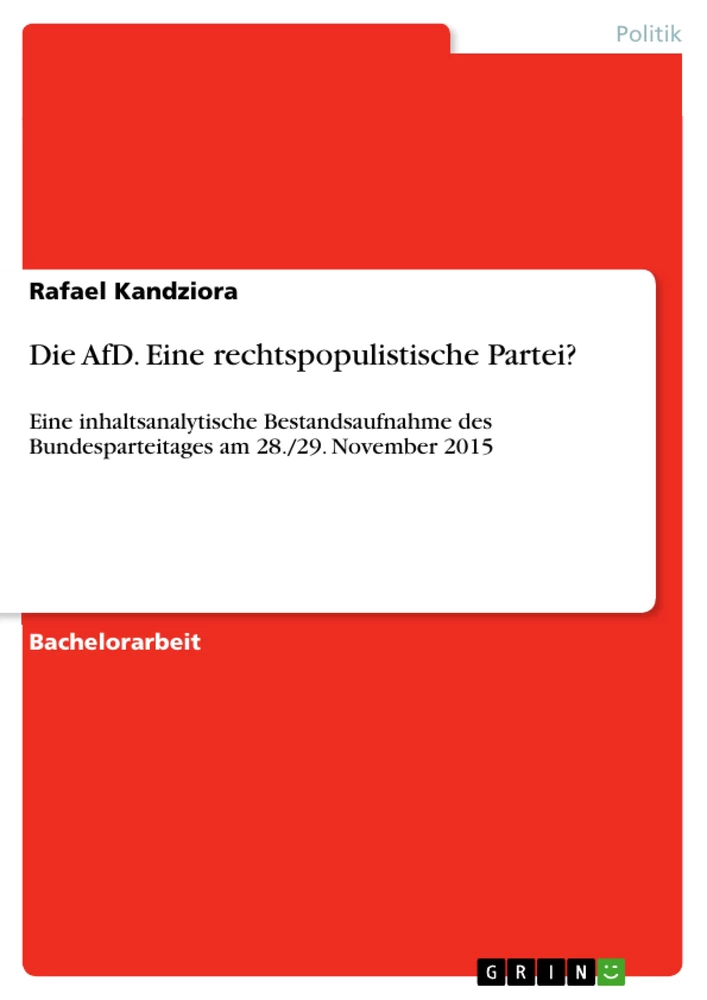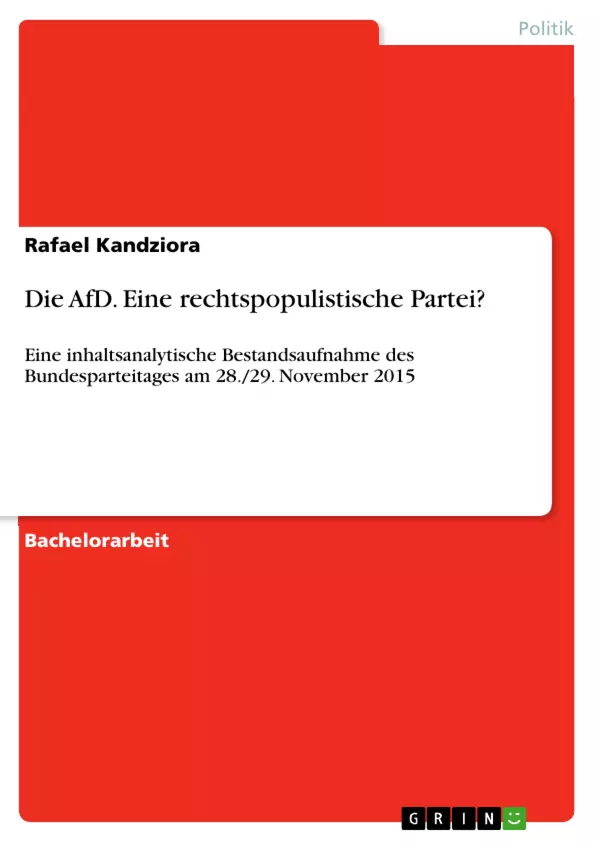Wirft man einen Blick auf die politische Nachrichtenerstattung dieser Tage, so wird man von der Erkenntnis beschlichen, dass ein rechtspopulistisches Ungeheuer in Europa auf dem Vormarsch ist. Bereits im Zuge der Wahlen zum Europaparlament im Mai 2014 wurde die Thematik der rechtsgerichteten Parteien artikuliert und es wurde deutlich, dass in vielen Nationalstaaten solchen Parteiungen über politisches Gewicht verfügen: In Frankreich sorgte der als rechtsextrem eingestufte Front National bei den Kommunalwahlen unmittelbar von den Europaparlamentswahlen für Aufsehen. In Dänemark war die Dansk Folkeparti (Dänische Volkspartei) zehn Jahre lang Mehrheitsbeschafferin, in Finnland stellt die Partei Perussuomalaiset (Basisfinnen oder Wahre Finnen) gar den Außenminister. Die als rechtskonservative Partei eingestufte Fidesz-MPSZ (Ungarischer Bürgerbund) erzielte bei den letzten Parlamentswahlen in Ungarn eine Zweidrittelmehrheit und verfügt somit demokratisch legitimiert über eine verfassungsändernde Mehrheit (vgl. Spiegel Online 2014). Bereits diese kurzen Ausführungen zeigen auf, dass es in Europa - mit Deutschland im Zentrum – Tendenzen der Wählerschaft zu rechtsgesinnten Parteien gibt. Die Alternative für Deutschland (AfD) schickt sich an, diese rechtspopulistische Position zu besetzen. Die Relevanz des Themas einer Partei am rechten Rand gedeiht - zumal in Deutschland - auf historischen Boden. Aber auch im Zuge der bereits angeschnittenen Debatte der Rechtsorientierung in Europa ist es ein interessanter Forschungszweig, ob sich ebenfalls in der Bundesrepublik - welche gemeinsam mit Frankreich als „Motor der Integration“ der EU bezeichnet wird - eine Partei stabilisieren kann, die eher EU-kritische, dafür aber nationalstärkende Positionen vertritt. Ein weiterer relevanter Faktor besteht in der wissenschaftlichen Untersuchung der AfD, da diese vor allem in den Medien als rechtspopulistisch eingestuft wird. Dementsprechend wird die vorliegende Arbeit von der Frage geleitet, ob sich die Alternative für Deutschland in ihrer gegenwärtigen Präsenz als rechtspopulistische Partei darstellt. Diese Überlegungen führen in den komplexen Gegenstandsbereich der Parteienforschung, der einige interdisziplinäre Schnittpunkte aufweist....
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Prolog
- 1.2 Zum Stand der Forschung: Die AfD als rechtspopulistische Partei?
- 1.3 Zur Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse
- 1.4 Zum Rechts-Populismus-Begriff
- 2. Hauptteil: Eine inhaltsanalytische Bestandsaufnahme des Bundesparteitages der AfD in Hannover
- 2.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials
- 2.2 Die Fragestellung der Analyse
- 2.3 Ablaufmodell der Analyse
- 2.4 Theoretisch-konzeptioneller Teil: Merkmale des Rechtspopulismus
- 2.4.1 Modernisierungskritisch
- 2.4.2 Vertikale Orientierung
- 2.4.3 Horizontale Orientierung
- 2.4.4 Identitätspolitik
- 2.4.5 Law-and-Order-Partei
- 2.4.6 Wohlstandschauvinismus
- 2.4.7 Inhaltliche Prinzipien der politischen Kommunikation
- 2.5 Zusammenstellen des Kategoriensystems
- 2.6 Zusammenstellen des Kodierleitfadens
- 2.7 Analyseeinheiten: Kodier-, Kontext- und Auswertungseinheit
- 2.8 Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung
- 2.9 Materialdurchlauf: Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen
- 3. Ergebnisauswertung: Die AfD als tendenziell rechtspopulistische Partei
- 4. Exkurs: Europäischer Blick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht, ob die Alternative für Deutschland (AfD) im November 2015 auf ihrem Bundesparteitag als rechtspopulistische Partei aufgetreten ist. Die Zielsetzung besteht in der inhaltsanalytischen Begutachtung der Parteitagsreden und -resolutionen. Die Methodik basiert auf der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.
- Inhaltsanalyse des AfD-Bundesparteitags 2015
- Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring
- Definition und Kategorisierung von Rechtspopulismus
- Analyse der rhetorischen Strategien der AfD
- Europäischer Vergleich der Rechtspopulismus-Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die steigende Relevanz rechtspopulistischer Parteien in Europa, insbesondere die AfD in Deutschland. Sie begründet die Forschungslücke hinsichtlich einer wissenschaftlichen Untersuchung des AfD-Parteitags 2015 und skizziert die Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse, die zur Beantwortung der Forschungsfrage – ob die AfD als rechtspopulistische Partei zu charakterisieren ist – verwendet wird. Die Einleitung definiert den Fokus auf die inhaltliche Ebene des Rechtspopulismus und benennt die verwendeten Primärquellen (Homepage der AfD, Transkription der Rede von Frauke Petry). Die methodische Vorgehensweise wird erläutert, wobei der Fokus auf der deduktiven Kategorienbildung liegt, die aus der theoretischen Literatur zum Rechtspopulismus abgeleitet wird.
2. Hauptteil: Eine inhaltsanalytische Bestandsaufnahme des Bundesparteitages der AfD in Hannover: Dieser Kapitel beschreibt detailliert den methodischen Ablauf der Analyse. Es wird das Ausgangsmaterial spezifiziert (Resolutionen und Rede von Frauke Petry), die Forschungsfrage präzisiert und das Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse vorgestellt. Der theoretisch-konzeptionelle Teil befasst sich mit der Definition und den Merkmalen von Rechtspopulismus, wobei verschiedene Aspekte wie Modernisierungskritik, vertikale und horizontale Orientierung, Identitätspolitik, Law-and-Order und Wohlstandschauvinismus untersucht werden. Die Kapitel erläutert die Zusammenstellung des Kategoriensystems und des Kodierleitfadens, definiert die Analyseeinheiten und beschreibt den Prozess des Materialdurchlaufs, der Fundstellenbezeichnung und -extraktion.
Schlüsselwörter
Alternative für Deutschland (AfD), Rechtspopulismus, Qualitative Inhaltsanalyse, Parteienforschung, Europa, Bundesparteitag, Hannover 2015, Frauke Petry, Modernisierungskritik, Identitätspolitik, Wohlstandschauvinismus, Law-and-Order.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse des AfD-Bundesparteitags 2015
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Bundesparteitag der Alternative für Deutschland (AfD) im November 2015 in Hannover. Der Fokus liegt darauf, zu untersuchen, ob die AfD auf diesem Parteitag als rechtspopulistische Partei aufgetreten ist. Die Analyse basiert auf den Reden und Resolutionen des Parteitags.
Welche Methode wurde verwendet?
Die Analyse verwendet die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring. Diese Methode ermöglicht eine systematische und strukturierte Untersuchung des Inhalts der Parteitagsreden und -resolutionen auf Merkmale des Rechtspopulismus.
Welche Aspekte des Rechtspopulismus wurden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Merkmale des Rechtspopulismus, darunter Modernisierungskritik, vertikale und horizontale Orientierung, Identitätspolitik, Law-and-Order, und Wohlstandschauvinismus. Diese Merkmale wurden anhand der theoretischen Literatur zum Rechtspopulismus definiert und in einem Kategoriensystem operationalisiert.
Wie wurde die Analyse durchgeführt?
Der Analyseprozess umfasste die Definition des Ausgangsmaterials (Reden und Resolutionen), die Formulierung der Forschungsfrage, die Entwicklung eines Ablaufmodells, die Erstellung eines Kategoriensystems und eines Kodierleitfadens, die Definition von Analyseeinheiten und die Durchführung des Materialdurchlaufs mit Fundstellenbezeichnung und -extraktion.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Primärquellen der Analyse sind die Homepage der AfD und die Transkription der Rede von Frauke Petry. Die Sekundärquellen umfassen die einschlägige Literatur zum Rechtspopulismus.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Analyse werden im dritten Kapitel präsentiert und diskutieren, inwieweit die AfD auf ihrem Bundesparteitag 2015 Merkmale einer rechtspopulistischen Partei aufwies. Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die AfD tendenziell als rechtspopulistische Partei zu charakterisieren ist.
Gibt es einen europäischen Vergleich?
Ja, die Arbeit enthält einen Exkurs, der die Entwicklung des Rechtspopulismus in Europa im weiteren Kontext betrachtet und die Ergebnisse der AfD-Analyse in einen europäischen Vergleich einbettet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Alternative für Deutschland (AfD), Rechtspopulismus, Qualitative Inhaltsanalyse, Parteienforschung, Europa, Bundesparteitag, Hannover 2015, Frauke Petry, Modernisierungskritik, Identitätspolitik, Wohlstandschauvinismus, Law-and-Order.
- Quote paper
- Rafael Kandziora (Author), 2016, Die AfD. Eine rechtspopulistische Partei?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383232