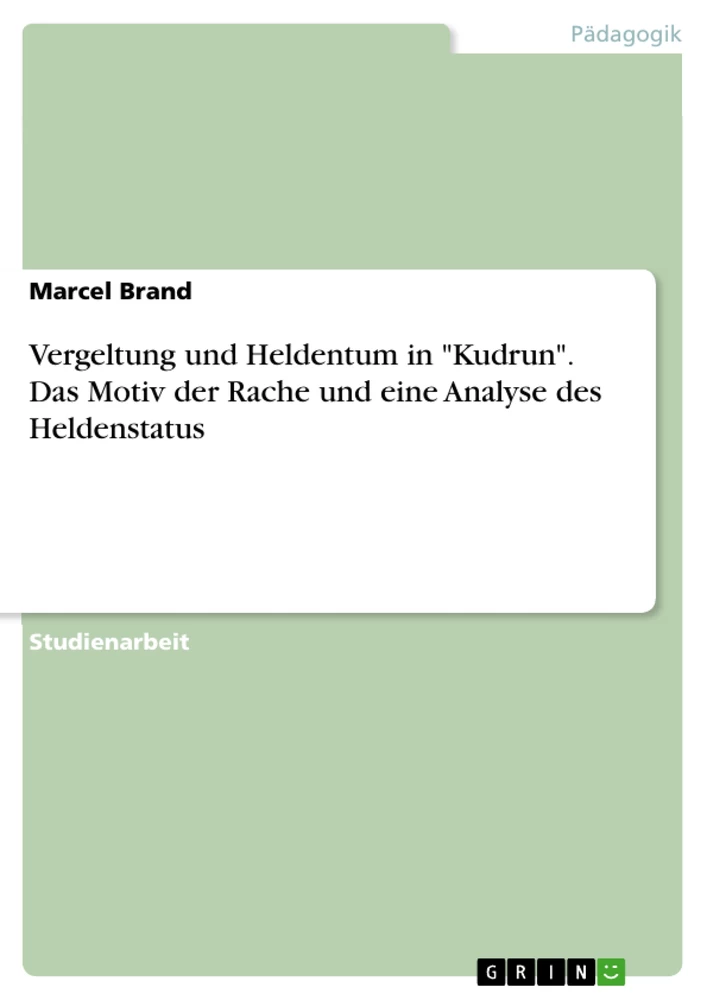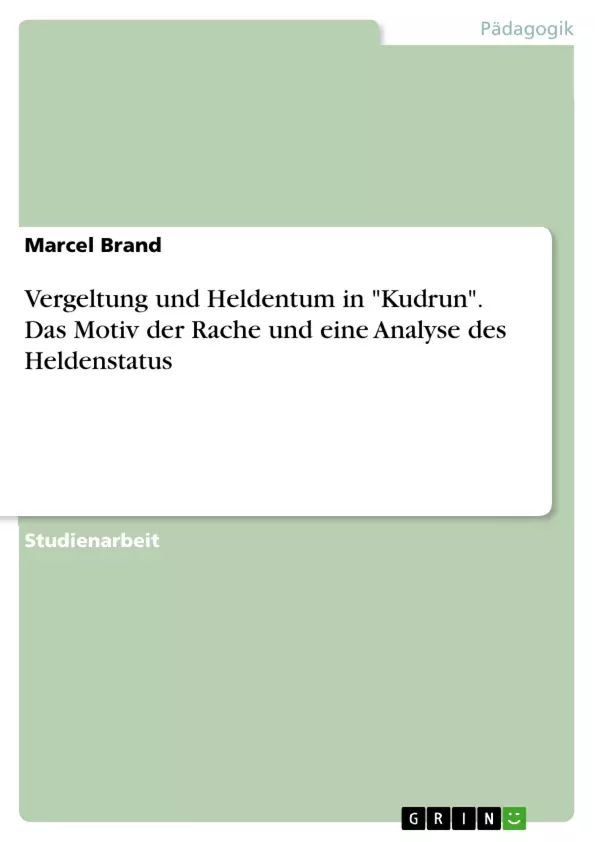In dieser Arbeit geht es um die im Text thematisierten Motive des Heldentums, sowie Rache und Vergeltung. Dabei werden verschiedene Szenen analysiert und interpretiert.
Vergeltung für vergangenes Leid, Rache zur Wiederherstellung der Ehre. Dies sind die Schlagworte, die den Epos Kudrun passend beschreiben können. Während es aus heutiger Sicht unvorstellbar wäre, sich für erlittene Schande in diesem Maße zu revanchieren, war das Mittel der Blutrache die gängige Vorgehensweise für Vergeltung im Mittelalter. Doch Kudrun hat, im Gegensatz zum Nibelungenlied, das entscheidende Merkmal, dass dem exorbitanten Wüten nicht die Auslöschung einer ganzen Sippe folgt, sondern viel mehr die Vereinigung der Gefolgschaften von Täter und Opfer. Davon handelt auch die vorliegende Seminararbeit. Alles in allem ist diese Ausarbeitung in zwei Teile getrennt. Zum einen soll sich im ersten Teil näher mit dem Motiv der Rache auseinandergesetzt werden. Hierzu wird zunächst die Legitimation der Rache bzw. Selbstjustiz im Mittelalter knapp erläutert, bevor ein genauerer Bezug auf das Epos folgt. Die Analyse des Motivs bezüglich der Primärliteratur orientiert sich dabei chronologisch an den Geschehnissen der Erzählung. Dabei erfolgt eine Erarbeitung vom Ursprung des Konflikts bis hin zur Versöhnungsstrategie, welche die verfeindeten Sippen zusammenbringt. Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der in Kudrun dargestellten Form von Heroik. Dafür werden verschiedene Beispiele betrachtet und analysiert, bevor sich der Frage gewidmet wird, ob Kudrun selbst als eine Heldin zu sehen ist, man vielleicht von Heldinnen-Epik sprechen kann?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rache und Versöhnung im Mittelalter
- Das Rachemotiv in Kudrun
- Die Ursache der Rache der Normannen
- Wie Hartmuot Kûdrûnen mit gewalte nam
- Blutrache und Rückeroberung Kudruns
- Kudruns Versöhnungsstrategie
- Heroik in Kudrun
- Kudrun, eine Heldin?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Motiv der Rache und dem Heldenstatus Kudruns im gleichnamigen Epos. Sie untersucht die Legitimation von Rache und Selbstjustiz im Mittelalter und analysiert, wie diese im Kontext der Geschichte Kudruns zum Ausdruck kommen.
- Rache als Mittel der Selbstjustiz im Mittelalter
- Die Rolle der Blutrache im Epos Kudrun
- Kudruns Versöhnungsstrategie als Gegenmittel zur Rache
- Die Darstellung von Heroik in Kudrun
- Die Frage, ob Kudrun als Heldin bezeichnet werden kann
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Seminararbeit vor und skizziert die zentralen Aspekte des Epos Kudrun: Rache, Versöhnung und Heldenstatus.
- Rache und Versöhnung im Mittelalter: Dieses Kapitel beleuchtet die Legitimation von Rache und Selbstjustiz im Mittelalter. Es erläutert die Rolle der Blutrache als gängige Form der Vergeltung im damaligen Kontext.
- Das Rachemotiv in Kudrun: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung und den Verlauf der Rache in Kudrun. Es untersucht die Ursache des Konflikts zwischen den Normannen und den Hegelingen, die Blutrache und Kudruns Strategie zur Versöhnung.
- Heroik in Kudrun: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Darstellung von Heroik in Kudrun. Es analysiert verschiedene Beispiele und stellt die Frage nach Kudruns Heldenstatus.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit konzentriert sich auf die Themen Rache, Blutrache, Versöhnung, Selbstjustiz, Heldenstatus, Heldinnen-Epik und das mittelalterliche Epos Kudrun.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Blutrache im Epos "Kudrun"?
Die Blutrache ist das zentrale Motiv zur Wiederherstellung der Ehre nach erlittenem Leid, was der gängigen mittelalterlichen Rechtspraxis der Selbstjustiz entsprach.
Wie unterscheidet sich "Kudrun" vom "Nibelungenlied"?
Im Gegensatz zum Nibelungenlied endet Kudrun nicht mit der totalen Vernichtung, sondern mit einer Versöhnungsstrategie, die die Gefolgschaften vereint.
Ist Kudrun selbst als Heldin zu betrachten?
Die Arbeit analysiert, ob Kudrun durch ihre Standhaftigkeit und ihre aktive Rolle bei der Versöhnung der Sippen den Status einer Heldin (Heldinnen-Epik) verdient.
Was war die Ursache für die Rache der Normannen?
Der Konflikt entstand aus der gewaltsamen Entführung Kudruns durch Hartmuot und das daraus resultierende Leid der Hegelingen.
Wie funktioniert Kudruns Versöhnungsstrategie?
Statt auf weitere Vergeltung zu setzen, nutzt sie ihre Position, um durch Eheschließungen und Friedensschlüsse die verfeindeten Parteien dauerhaft zu befrieden.
- Quote paper
- Marcel Brand (Author), 2017, Vergeltung und Heldentum in "Kudrun". Das Motiv der Rache und eine Analyse des Heldenstatus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383560