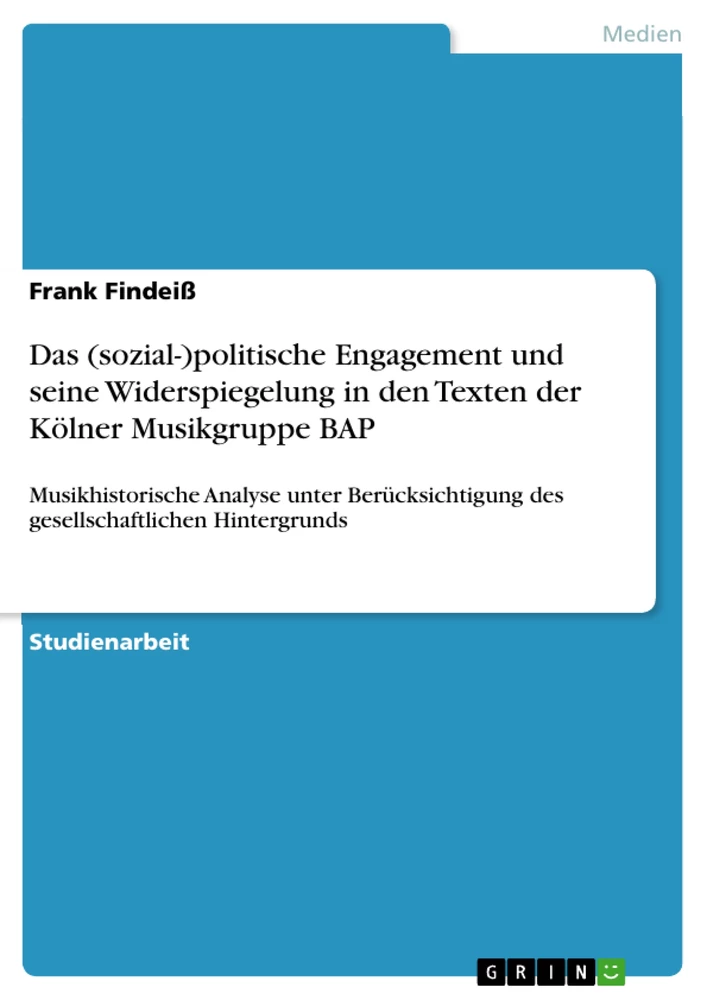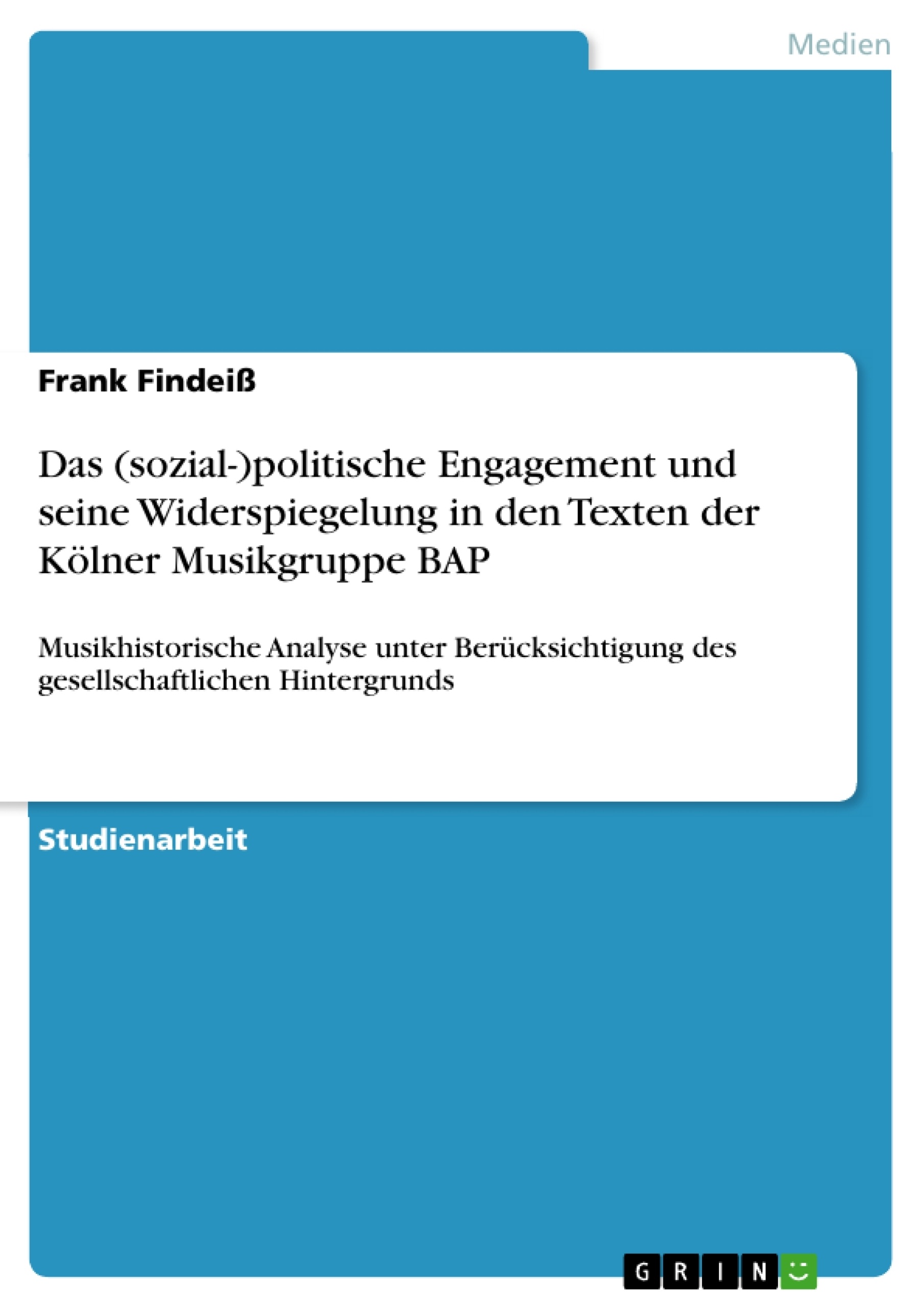Die Arbeit beleuchtet vor dem Hintergrund der Entstehung des Folkrocks und des politischen Liedgutes - ausgehend von den USA und Großbritannien - regional, bundes- und weltpolitische Ereignisse, die in Zusammenhang mit der Entstehung von Songtexten seitens der Gruppe BAP, vornehmlich durch ihren Bandleader Wolfgang Niedecken, stehen. Dabei wird auch die Genese bzw. Bandhistorie von BAP mit einbezogen und das Gesamte (musik-)historisch eingeordnet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesellschaftlicher Nährboden und musikalische Wurzeln
- Musik als Ausdruck von Protest und Haltung nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1950er Jahre
- Folk Music - Bob Dylan und die Wurzeln der Politisierung in der populären Musik der 1960er Jahre
- Die sozialpolitische Situation der späten 1970er Jahre.
- Der popmusikalische Mainstream der späten 1970er und frühen 1980er Jahre: Punk und die Neue Deutsche Welle.
- BAP - eine politische Bandbiographie
- Gesellschaftspolitisches Engagement auf regionaler Ebene (1976-1981)
- Wegweisende Songs der 1. Phase in Bezug auf (sozial)politische Themen – eine Auswahl
- Gesellschaftspolitisches Engagement auf überregionaler Ebene (1982-1986)
- Wegweisende Songs der 2. Phase in Bezug auf (sozial)politische Themen – eine Auswahl
- Gesellschaftspolitisches Engagement auf globaler Ebene (1987-1999)
- Wegweisende Songs der 3. Phase in Bezug auf (sozial)politische Themen – eine Auswahl
- Gesellschaftspolitisches Engagement auf globaler Ebene (2000-2017)
- Wegweisende Songs der 4. Phase in Bezug auf (sozial)politische Themen – eine Auswahl
- Gesellschaftspolitisches Engagement auf regionaler Ebene (1976-1981)
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Kölner Musikgruppe BAP und ihre (sozial-)politische Aussagekraft. Der Fokus liegt dabei auf den Texten der Band und ihrer Einbettung in den gesellschaftlichen Kontext der jeweiligen Zeit. Ziel ist es, die Entwicklung des Bandengagements von der regionalen Ebene bis hin zur internationalen Ebene zu analysieren und die musikalischen und ideellen Wurzeln dieser Entwicklung aufzuzeigen.
- Die Entwicklung von BAP als Band
- Die (sozial-)politische Aussagekraft der Texte von BAP
- Die musikalischen Wurzeln und Einflüsse von BAP
- Die Einbettung von BAP in den gesellschaftlichen Kontext
- Die Entwicklung des Bandengagements von der regionalen Ebene zur internationalen Ebene
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beschreibt die Entwicklung der Band BAP in vier Phasen, die mit der Entwicklung ihres Bekanntheitsgrades und dem zunehmenden politischen Engagement der Band korrespondieren. Die zweite Phase der Arbeit zeichnet einen Überblick über den gesellschaftlichen Nährboden und die musikalischen Wurzeln von BAP. Dabei werden die Entwicklung der Musik als Ausdruck von Protest nach dem Zweiten Weltkrieg, der Einfluss der Folk-Bewegung und Bob Dylans auf die Politisierung in der populären Musik der 1960er Jahre sowie die sozialpolitische Situation in den 1970er Jahren behandelt. Die dritte Phase befasst sich mit der politischen Bandbiographie von BAP und widmet sich jeweils einem Abschnitt für die vier Phasen der Bandgeschichte. Für jede Phase werden exemplarische Songs und ihre (sozial-)politische Aussagekraft analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Musik, Politik, Protest, Gesellschaft, soziales Engagement, Kölner Mundart, Rockmusik, Popkultur, Bob Dylan, Folk Music, Punk, Neue Deutsche Welle, Wolfgang Niedecken, BAP. Dabei wird die Entwicklung der Band BAP von ihren Anfängen als regionale Band bis hin zur internationalen Bekanntheit untersucht und die (sozial-)politische Aussagekraft ihrer Musik im Kontext der jeweiligen Zeit analysiert.
Häufig gestellte Fragen
Wie politisch ist die Musik der Kölner Band BAP?
BAP gilt als sehr politisch engagiert, was sich in Songtexten zu regionalen, bundesweiten und globalen Themen widerspiegelt.
Welche musikalischen Wurzeln beeinflussten Wolfgang Niedecken?
Wichtige Einflüsse sind die Folk-Musik, insbesondere Bob Dylan, sowie die Protestkultur der 1960er Jahre.
Wie entwickelte sich das Engagement von BAP über die Zeit?
Die Bandbiographie wird in vier Phasen unterteilt: von regionalem Engagement (1976-81) bis hin zu globalen Themen (ab 1987).
Welche Rolle spielt die Kölner Mundart für die Botschaften der Band?
Der Dialekt dient als authentisches Ausdrucksmittel für Haltung und Protest und prägt die Identität der Gruppe.
Gegen welche gesellschaftlichen Strömungen grenzte sich BAP ab?
Die Arbeit setzt BAP in den Kontext von Punk und der Neuen Deutschen Welle der späten 1970er und frühen 1980er Jahre.
- Quote paper
- M. A., B. A. Frank Findeiß (Author), 2016, Das (sozial-)politische Engagement und seine Widerspiegelung in den Texten der Kölner Musikgruppe BAP, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383842