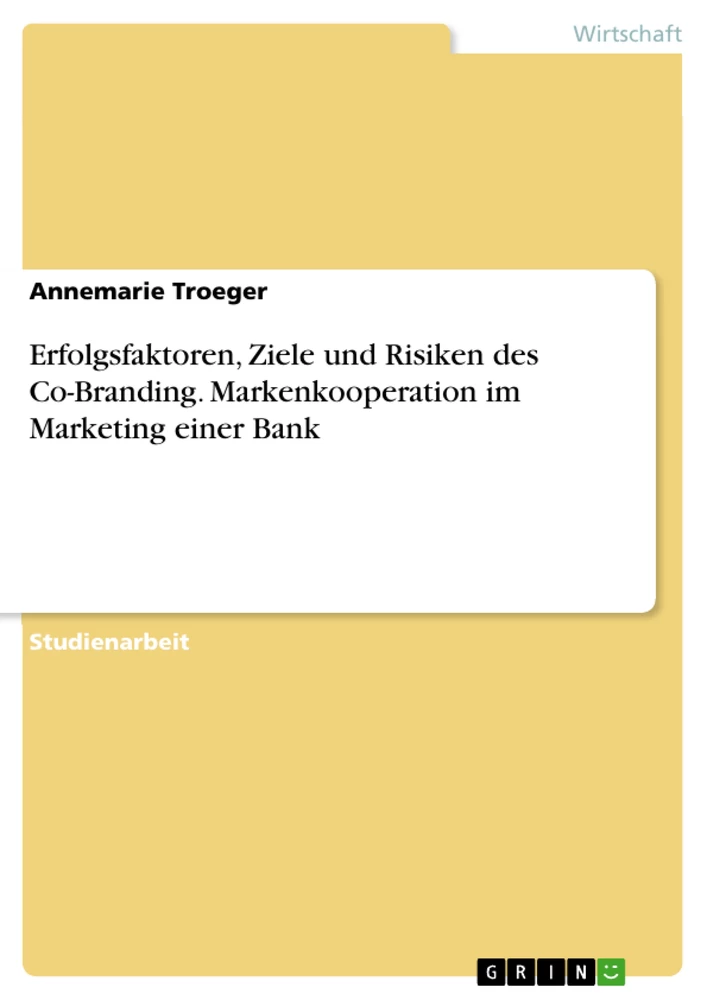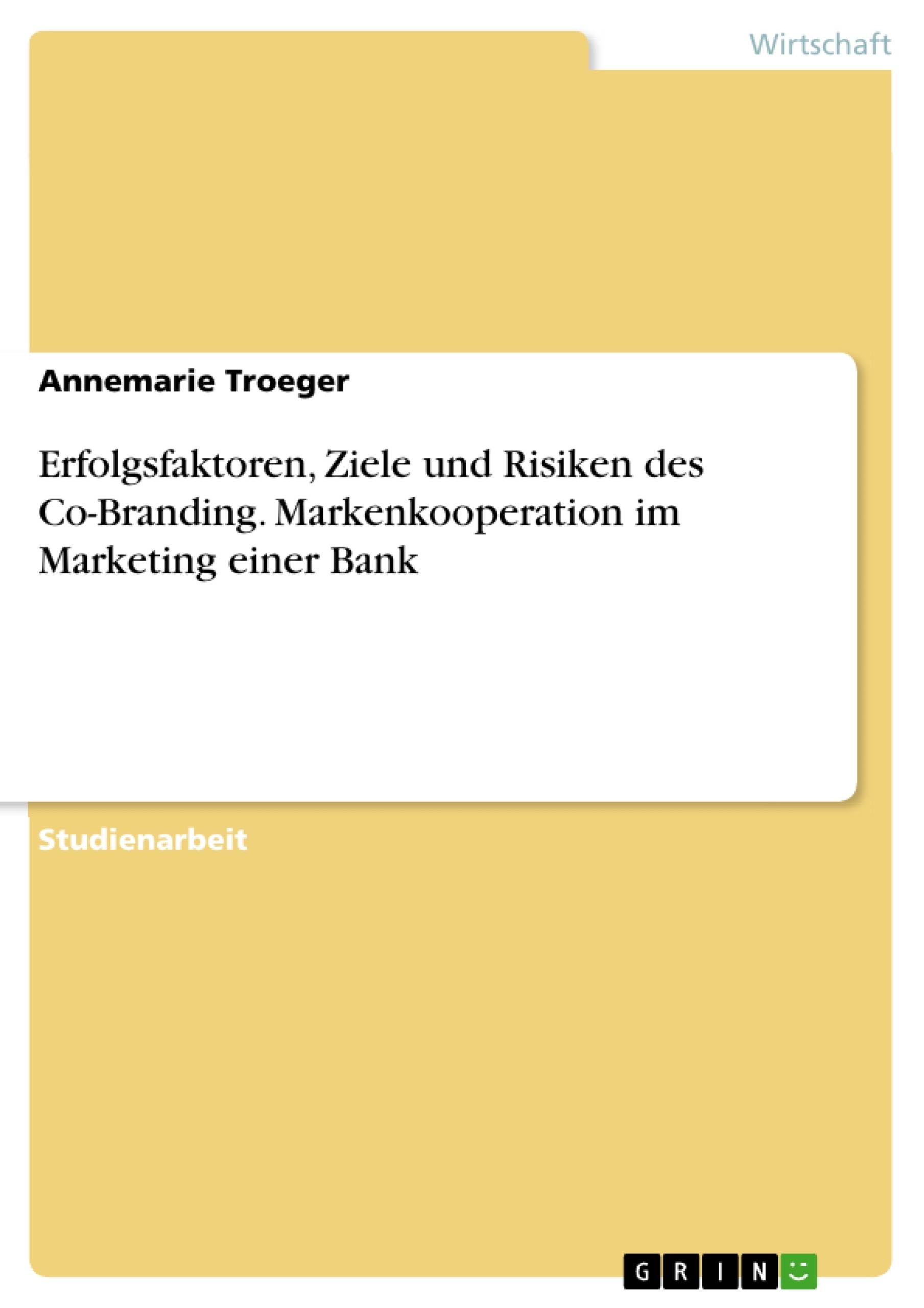Ein Sportwagen und eine Handtasche, Frischkäse und Schokolade, eine Bank und ein Sportverein - manchmal verbindet Ungleiche mehr, als der erste Eindruck vermittelt.
Die zunehmende Digitalisierung und die damit verbundenen neuen Vertriebskanäle, sowie der zunehmende Preiskampf stellen die Unternehmen vor immer größere Herausforderungen hinsichtlich ihrer Marketingstrategie. Gerade in den Jahren der Finanzkrise 2008/2009 bündelten Unternehmen mit wachsendem Interesse ihre Markenstärke, um gemeinsam einen möglichst großen Marktanteil zu erlangen - Kooperationen und Markenallianzen entstanden.
Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick über eine spezielle Form der Markenkooperation zu verschaffen: das Co-Branding. Dass selbst Banken Kooperationsmöglichkeiten mit anderen, inhaltlich weit entfernten, Marken entdecken, wird zum Abschluss der Arbeit betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition
- 3. Formen des Co-Branding
- 3.1. Vertikales Co-Branding
- 3.2. Horizontales Co-Branding
- 3.3. Laterales Co-Branding
- 4. Ziele und Risiken des Co-Branding
- 5. Erfolgsfaktoren von Co-Brandings
- 5.1. Produkt- & Markenfit
- 5.2. Komplementarität der Partnermarken
- 5.3. Zielgruppenüberschneidung
- 5.4. Wirkungseffekte des Co-Brandings
- 5.5. Erfolgskontrolle
- 6. Co-Branding am Beispiel der Kreditinstitute
- 7. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Co-Branding als einer speziellen Form der Markenkooperation. Es werden die verschiedenen Formen des Co-Branding erläutert, die damit verbundenen Ziele und Risiken sowie die wesentlichen Erfolgsfaktoren analysiert. Die Arbeit zeigt, wie sich Co-Branding im Marketing einsetzen lässt und wie Unternehmen durch gemeinsame Aktionen ihre Markenstärke und Marktposition stärken können.
- Definition und Arten des Co-Branding
- Ziele und Risiken von Co-Branding-Kooperationen
- Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches Co-Branding
- Co-Branding-Beispiele aus der Praxis
- Die Rolle des Co-Branding im Finanzsektor
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Co-Branding ein und zeigt die Bedeutung von Markenkooperationen im Kontext der Digitalisierung und des zunehmenden Wettbewerbs auf. Kapitel 2 liefert eine Definition des Begriffs Co-Branding und ordnet ihn in den Rahmen anderer Marketingstrategien ein. Kapitel 3 betrachtet verschiedene Formen des Co-Branding, wie z. B. vertikales, horizontales und laterales Co-Branding. Kapitel 4 beleuchtet die Ziele und Risiken von Co-Branding-Kooperationen, während Kapitel 5 die Erfolgsfaktoren für ein gelungenes Co-Branding analysiert. Kapitel 6 untersucht das Co-Branding anhand des Beispiels der Kreditinstitute und zeigt, wie Banken diese Marketingstrategie zur Steigerung ihrer Bekanntheit und Attraktivität nutzen können.
Schlüsselwörter
Co-Branding, Markenkooperation, Marketingstrategie, Digitalisierung, Wettbewerbsvorteil, Markenstärke, Zielgruppenüberschneidung, Erfolgsfaktoren, Kreditinstitute, Finanzsektor.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Co-Branding?
Co-Branding ist eine Marketingstrategie, bei der mindestens zwei Marken gemeinsam ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten, um ihre Markenstärke zu bündeln und Marktanteile zu gewinnen.
Welche Formen des Co-Branding werden unterschieden?
Es wird zwischen vertikalem (Partner auf verschiedenen Wertschöpfungsstufen), horizontalem (Partner auf gleicher Stufe) und lateralem Co-Branding (Partner aus unterschiedlichen Branchen) unterschieden.
Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine Markenkooperation?
Entscheidend sind ein guter Produkt- und Markenfit, die Komplementarität der Partner sowie eine deutliche Überschneidung der Zielgruppen.
Welche Risiken birgt Co-Branding für Unternehmen?
Zu den Risiken gehören ein möglicher Image-Transfer negativer Aspekte einer Partnermarke, Kontrollverlust über die eigene Marke und eine mögliche Verwässerung des Markenprofils.
Warum nutzen auch Banken Co-Branding-Strategien?
Banken setzen Co-Branding ein, um ihre Attraktivität zu steigern, neue Zielgruppen (z.B. Sportfans) zu erschließen und sich in einem harten Wettbewerbsumfeld zu differenzieren.
- Quote paper
- Annemarie Troeger (Author), 2017, Erfolgsfaktoren, Ziele und Risiken des Co-Branding. Markenkooperation im Marketing einer Bank, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383848