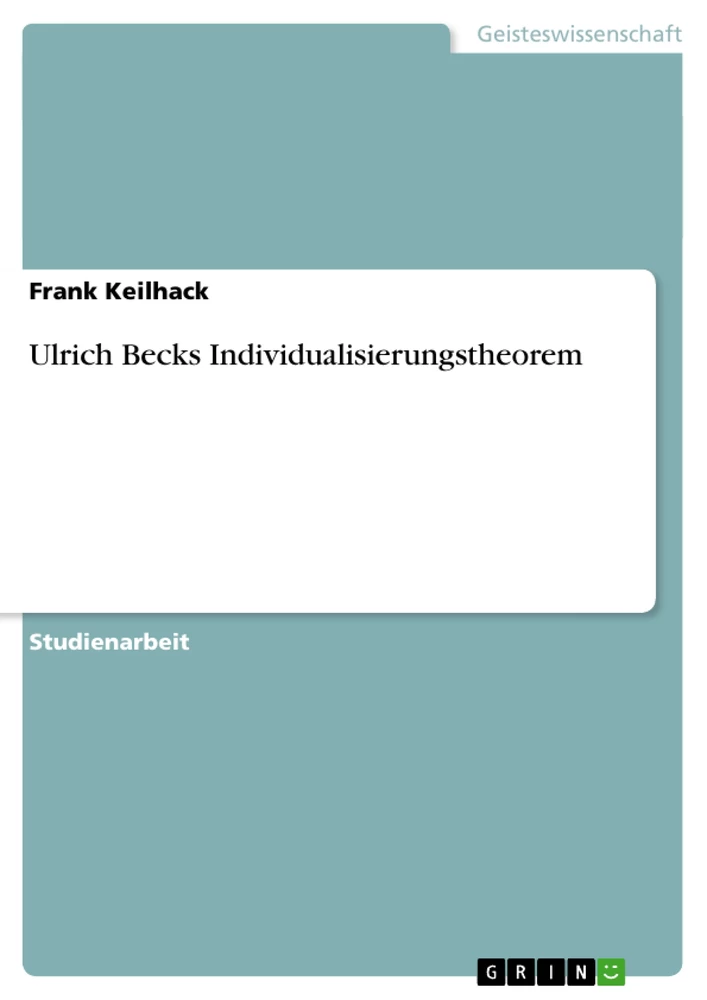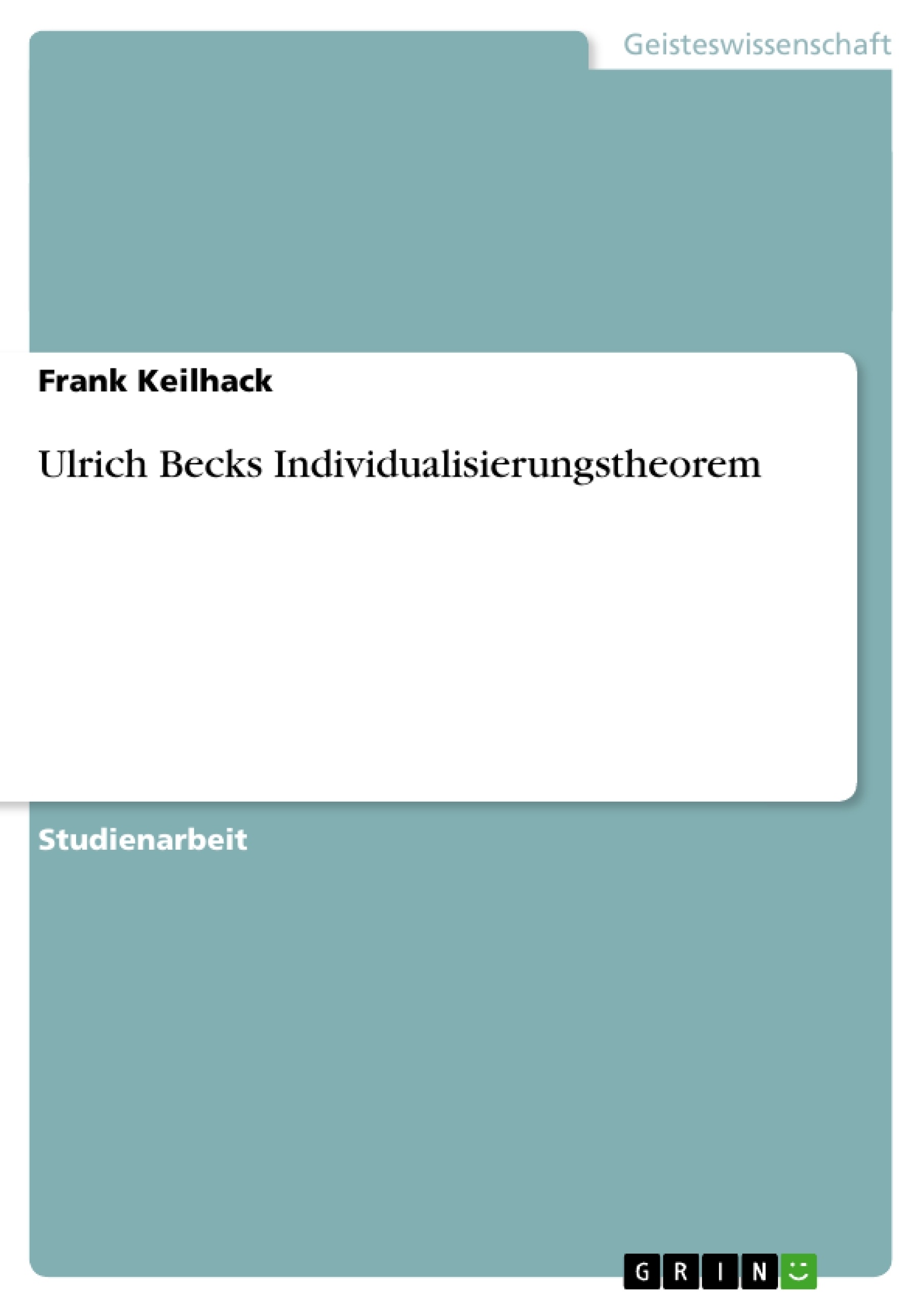Individualisierungstheorien gibt es nicht erst seit der jüngeren Vergangenheit. Die Anfänge des Individualisierungskonzeptes liegen mit der Betonung eines Ich-Bewusstseins unter anderem bei Sokrates, Platon und Aristoteles in der Antike. Um einiges später leistete dann die Reformation ihren Beitrag zu Individualisierungskonzepten, schaltete sie doch die Kirche als Zwischenkommunikator aus und stellte eine direkte Verbindung zwischen Gott und dem einzelnen Individuum her. In der Renaissance und mit Kant vor allem während der Aufklärung entwickelte sich das individuelle Bewusstsein. Während der Industrialisierung wurde der Individualisierungsbegriff im politischen und wirtschaftlichen Leben zur Geltung gebracht. Die Einmaligkeit des Individuums trat im 19. Jahrhundert bei den Liberalen in den Vordergrund, allerdings war dies in erster Linie auf Männer bezogen, vorwiegend der höheren Klasse.2 Die Soziologie beschäftigt sich seit dem 19. Jahrhundert mit dem Individualisierungsbegriff. So beschäftigten sich Marx – für den Individualisierung ein Grundproblem des Kapitalismus war, der den Arbeiter aus vorkapitalistischen Lebensformen löse und ihn von der Gesellschaft entfremde – aber auch Durkheim, Simmel, Weber, Adorno, Habermas oder Luhmann mit Individualisierung. Letzterer sah in ihr eine Selbstverwirklichung, die zu einem normativen Kulturgut geworden ist und soziale Heimatlosigkeit jenseits traditioneller Lebenswelten hervorrufen kann.3
Spricht man heute allerdings von der Individualisierungsthese bzw. dem Individualisierungstheorem, so bezieht man sich auf Ulrich Beck, der sich in seinem Buch „Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne“, 1986 überwiegend mit Individualisierung auseinandersetzt.4 [...] 2 Vgl. Ebers, Nicola, „Individualisierung“. Georg Simmel – Norbert Elias – Ulrich Beck, (=Epistemata, Würzburger wissenschaftliche Schriften, Reihe Philosophie, Bd. 169), Würzburg 1995, S. 34-38. 3 Vgl. ebd., S. 38-43. 4 Vgl. Beck, Ulrich, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt a.M. 1986.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Beck'sche Individualisierungstheorem
- Ulrich Beck
- Die Risikogesellschaft
- Thesen zum Individualisierungstheorem
- Untersuchungen und Meinungen zum Beck'schen Individualisierungstheorem – eine Auswahl
- Untersuchungen von Hans Bertram und Simone Kreher zu Lebensformen und Familienstrukturen
- Untersuchungen von Hans Bertram zu regionalen Unterschieden
- Weitere Kritikpunkte und Einschätzungen
- Schlussbemerkungen: Bewertung des Beck'schen Theorems
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Individualisierungstheorem von Ulrich Beck, das in seinem Buch „Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne“ (1986) vorgestellt wurde. Die Arbeit analysiert Becks Thesen zur Individualisierung und setzt diese in Bezug zu weiteren Untersuchungen und Meinungen zum Thema. Ziel ist es, das Beck'sche Theorem zu beleuchten und zu bewerten.
- Das Konzept der Risikogesellschaft als Ausgangspunkt von Becks Individualisierungstheorem
- Die Kernaussagen des Individualisierungstheorems
- Untersuchungen und Kritik am Beck'schen Theorem
- Die Bedeutung von Individualisierung in der modernen Gesellschaft
- Die Relevanz des Individualisierungstheorems für die Soziologie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die Entwicklung des Individualisierungsbegriffs in der Geschichte und führt in das Werk von Ulrich Beck ein. Kapitel 2 stellt Beck und sein Individualisierungstheorem im Kontext der Risikogesellschaft vor. Es werden die wichtigsten Thesen des Theorems erläutert. Kapitel 3 analysiert Untersuchungen und Meinungen, die sich mit dem Beck'schen Theorem auseinandersetzen, darunter Arbeiten von Hans Bertram und Simone Kreher. Es werden auch weitere Kritikpunkte und Einschätzungen zum Theorem beleuchtet.
Schlüsselwörter
Individualisierungstheorem, Risikogesellschaft, Ulrich Beck, Moderne, Lebensformen, Familienstrukturen, regionale Unterschiede, Kritik, Soziologie
- Citation du texte
- Frank Keilhack (Auteur), 2004, Ulrich Becks Individualisierungstheorem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38415